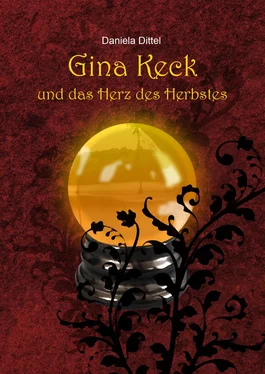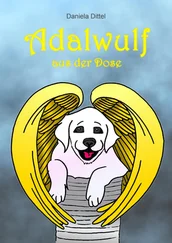Mit einem eleganten Hofknicks hob sie ihr Rosenkleid leicht an und stellte sich selbst vor: «Gestatten, ich heiße Sommer.»
Gina verstand das alles nicht. Vor ihr stand leibhaftig der Sommer in Gestalt eines hübschen, aber sehr traurigen Mädchens, das bestimmt nicht viel älter als Gina selbst war. Die roten Augen zeigten deutlich, dass sie viel geweint hatte. Außerdem war ihr verängstigtes Verhalten auffallend, denn wer würde sich schon vor einer Neunjährigen verstecken? Die Geschwister des Mädchens, der Frühling, Herbst und der Winter waren ebenfalls da, aber versteinert. Was hatte das alles zu bedeuten?
Eine Weile schwieg Gina nachdenklich. Alles zusammen ergab keinen Sinn und gerade deshalb schien eine Sache noch unverständlicher, darum fragte sie: «Warum bist du noch hier? Es müsste längst Herbst sein und dein Bruder sollte die Blätter der dicken Bäume hier zum Fallen bringen?»
Um ihre Worte zu unterstreichen, klatschte sie mit der flachen Hand auf die alte Eiche, die neben ihr stand.
Das Mädchen nickte bedächtig und ihre Augen füllten sich erneut mit Tränen.
«Er ist nicht da. Alle... alle sind sie weg.»
Ihr Blick hing an den drei Statuen, während sie weitersprach: «Nur ich bin noch da. Mich haben sie nicht mitgenommen. Ich musste hier bleiben, denn ohne mich, würde die Welt in Dunkelheit und Kälte versinken.»
Schweigend setzte sich Gina auf den Moos bewachsenen Waldboden und hörte dem Mädchen gespannt zu.
Leise sprach Sommer weiter: «Ich wollte mit... habe mich an meine Geschwister geklammert, aber die gemeinen Männer stießen mich weg... traten mich mit den Füßen und sagten, ich müsse hier bleiben...».
Sie senkte ihren Kopf und flüsterte: «Sie haben recht. Ihr braucht mich, denn ohne Sonne kein Licht, ohne Licht keine Pflanzen, ohne Pflanzen keine Tiere und Menschen. Ihr würdet sterben.»
Wütend sprang Gina auf und schrie: «Wer sind die Kerle? Warum haben sie das getan? Ich verstehe das nicht.»
Aufgebracht marschierte sie auf und ab und versuchte hinter das Geheimnis des Geschehenen zu kommen.
«Ich weiß es nicht», seufzte Sommer.
«Ich weiß nur, dass sie vor etwa drei Monaten plötzlich da standen. Sie tauchten wie aus dem Nichts auf – drei große, fürchterlich drein blickende Männer. Sie trugen grüne Gewänder und besaßen Waffen, wie man sie beim Jagen oft benutzt – keine Gewehre, sondern Pfeil und Bogen und scharfe Jagdmesser, die in der Sonne blitzten, als sie uns damit bedrohten. Ehe wir wussten, wie uns geschah, hatten sie uns überwältigt und gefesselt.
«Du Narr! Das ist Sommer, die bleibt hier!», hatte einer zu dem gesagt, der mich und meine Schwester festhielt. Er schleuderten mich in die Büsche und als ich mich wieder aufgerappelt hatte, waren sie weg.»
«Weg? Wohin weg? Wo sind sie hingegangen?», fragte Gina ungehalten.
Sie atmete heftig vor Wut.
«Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind... Ich weiß nur, dass ich sie dort, wie durch Zauberhand, verschwinden sah. Zurück blieben diese drei Statuen.»
Das Mädchen deutete auf die grauen Geschwister-Felsen.
Gina trat näher an die Steine heran und während ihre Finger aufmerksam über die raue Oberfläche glitten, war ihr selbst nicht klar, wonach sie eigentlich suchte. Es fand sich nicht der kleinste Hebel oder Schalter, der ein Geheimfach hätte öffnen können und somit einen Blick in das Innere der Statuen ermöglicht hätte. Immer und immer wieder schritt sie um die Steine herum, fand jedoch keinen brauchbarer Hinweis, was mit den restlichen Gezeiten passiert war.
«Gina, es ist vergebens. Tag für Tag stehe ich davor und suche nach einer Möglichkeit meinen Geschwistern zu folgen. Aber es gelingt mir nicht.»
Sommer zuckte resigniert mit den Schultern, ließ sich erschöpft und müde zwischen den Felsen nieder und begann leise zu weinen.
Zur selben Zeit in Autum, dem Reich des mächtigen Grafen von Eberstein, rannte ein schmächtiger Junge, bedeckt mit einer gelb-roten Laubhose, behände die scharfen Steine des Donnerbergs hinauf, gleich so als würde er vom Wind getragen.
Gehetzt wie ein wildes Tier, hüpfte er leichtfüßig von einem Fels zum Nächsten, im Zick-Zack-Kurs die steile Bergwand hinauf.
Seine kupferfarbenen, bis zu den Schultern reichenden Haare wehten ihm ins Gesicht, als er zurückblickte, um zu sehen, wie dicht ihm seine Verfolger auf den Fersen waren.
Sie trugen leichte Rüstungen, waren mit Schwert und Armbrust bewaffnet und folgten dem Entflohenen keuchend, knurrend und mit bitterbösem Blick, um ihn auf die Burg Eberstein zurückzubringen, von der er geflohen war.
Dort herrschte Graf Eberstein, der letzte seiner Ahnenreihe. Seine Gattin war bei der Geburt der gemeinsamen Tochter Helena gestorben und so blieb ihm ein männlicher Erbe versagt, der den ruhmreichen Namen seines uralten Geschlechts hätte fortpflanzen können.
Dieser Gedanke betrübte den Grafen sehr, dennoch war ihm seine liebliche Tochter eine Freude und erfüllte sein Herz jeden Tag mit väterlichem Stolz und Wonne. Sie wuchs mit den Jahren zu einer wahren Schönheit heran. Deshalb bekümmerte ihn die Vorstellung, dass er sie eines Tages verlieren würde, wenn sie einem geliebten Manne als Gattin folgte. Dann würde er als einsamer Mann sterben mit dem Wissen, dass niemand in seine Fußstapfen treten und in seinem Namen über das Land Autum herrschen würde.
Allein mit der Jagd vermochte er diese trüben Gedanken kurzweilig zu verscheuchen. Deshalb liebte er den Herbst mehr als all die anderen Jahreszeiten. Denn erst wenn er die Jagdhörner durch die Wälder tönen hörte; wenn er die scheuen Hirsche und Rehe zwischen den Bäumen davon preschen, sie mit pochendem Herzen in die Enge getrieben und mit ängstlichen Augen auf ihr ungewisses Ende blicken sah; wenn er die kläffende Hundemeute vernahm, die mit wildem Gebell verängstigte Kaninchen aus ihrem Bau scheuchten; wenn er die Rebhühner aufgeregt in die Lüfte steigen sah, obwohl sie ihre Nester bis zur letzten Sekunde zu beschützen gedachten; erst dann wenn er die Macht besaß, über das Leben und den Tod zu richten; erst dann vergaß er seinen Kummer.
Eines Morgens zu Beginn des Monats Oktober stand Graf Eberstein auf der Wehrmauer seiner Burg und starrte düster, mit kleinen nahezu schwarzen Augen, die unter buschigen dunkelgrauen Augenbrauen saßen, in den dichten feuchten Nebel, der tief und schwer über den Wäldern hing.
Der riesige Mann seufzte tief, während sich dabei die Nasenflügel seiner aristokratischen Hakennase nach außen wölbten. Seiner stattlichen Erscheinung tat diese Mimik der Melancholie jedoch keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, wirkte sie doch eher einschüchternd und unnahbar. Die derben Züge seines Kampf gezeichneten Gesichts blieben ansonsten unberührt und schienen wie versteinert.
Er schlug den pelzigen Kragen seines braunen ledernen Umhangs nach oben, um sich die frostige Kälte vom Leib zu halten. Mit Widerwillen gestand er sich die unumstößlichen Vorboten des bevorstehenden Winters ein, dem der Herbst allmählich wich.
«So ist der Herbst nun bald vorbei», sprach er zu sich selbst und seufzte wieder.
«Oh, wie wird mir. Stehen doch nur Kälte und Tristesse ins Haus. Obwohl noch nicht vergangen, wünschte ich mir die liebste Jahreszeit zurück. Ach, du mein Herbst...,
...versetzt die Welt in warmen Ton,
erst grün, dann gelb, am Ende rot,
und fallen die letzten Blätter schon,
fand manch ein Tier des Jägers Tod.»
Es schauderte ihn, nicht nur der Kälte wegen, sondern aufgrund der Schwermut seiner eigenen Worte und der unausbleiblichen Trennung von seiner geliebten Jahreszeit. Eberstein versank in tiefe Gedanken.
Читать дальше