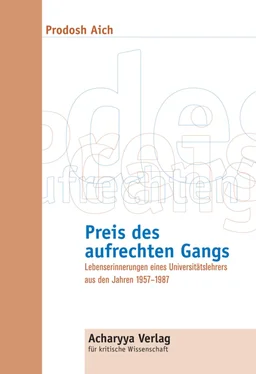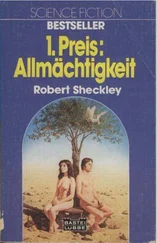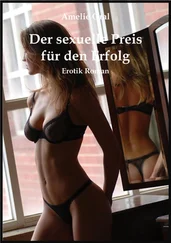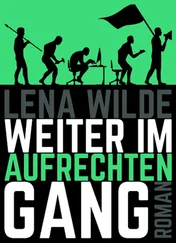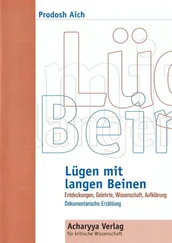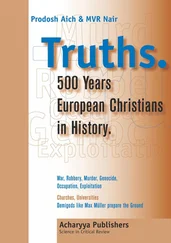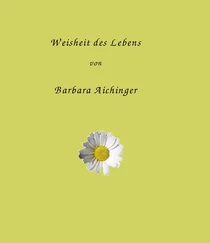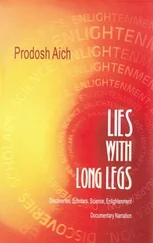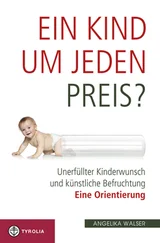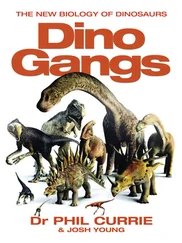Nach Gesprächen mit dem anderen Geschäftsführer der Carl–Duisberg–Gesellschaft, Dr. H. Deimann – Winfried Böll ist in dieser Zeit kaum erreichbar – beantrage ich auch ein Ergänzungsprojekt über Praktikanten, die nach einer Ausbildung in Deutschland nach Indien zurückgekehrt sind, wiederum beim BMZ. Kostenpunkt: 19 564,- DM. Nach telefonischer Übereinstimmung erläutert Deimann noch schriftlich das besondere Interesse seiner Gesellschaft dem Ministerium gegenüber:
„ Unter Bezugnahme auf die Besprechungen und Ausarbeitungen zusammen mit Herrn Diether Breitenbach (früherer Mitarbeiter der Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer) sind wir der Auffassung, daß das Forschungsvorhaben von Herrn Dr. Aich unter Umständen interessant sein könnte für die Problematik der Erfolgskontrolle im Bereich auch der Praktikanntenprogramme. Unabhängig von möglichen Einzelergebnissen scheint uns der Versuch von Herrn Dr. Aich, eine Definition des Begriffs ‚Erfolg‘ im Zusammenhang mit einer Berufsfortbildung im Ausland zu erarbeiten, sehr interessant zu sein. ... Sollte eine Förderung des Projektes in Aussicht genommen werden, so schlagen wir eine gemeinsame Planung zwischen Ihnen, Herrn Dr. Aich und uns vor. Gleichzeitig stellen wir anheim, Herrn Breitenbach hinzuzuziehen.“
Die Mittel für mein Forschungsvorhaben waren nicht bewilligt vor unserer Abreise nach Indien, eben nach Jaipur in Rajasthan, wo ich die erste Nacht so friedlich hinter mich gebracht habe. Welche Qualität hatte meine Ausbildung in Köln, daß ich alle diese und noch andere Ungereimtheiten einfach nicht wahrgenommen habe? Wie konnte ich bereit gewesen sein, Dienstverpflichtungen in einer völlig obskuren Universität, in einer mir völlig fremden Gegend in Indien aufzunehmen? Ohne einen bewilligten Forschungsauftrag als Stütze? Ohne dienstliche Reisekosten? Daß ich nicht in der Lage gewesen bin, diese und ähnliche Fragen zu stellen, belegt meine Blindheit, aber stellt auch die Qualität einer Wissenschaftsdisziplin in Frage, die die gesellschaftliche Wirklichkeit wissenschaftlich beschreiben will.
Vieles läßt sich entschuldigen. Vieles läßt sich plausibel erklären. Richtiger wird es dadurch nicht. Sicherlich läßt der Dauerstreß von lernen, arbeiten, Zukunft planen, über mehrere Jahre – immerhin bis Juni 1966 –, und das ganz ohne Urlaubspause, wenig Möglichkeiten, über die abgelaufenen Monate und Jahre gründlich nachzudenken und daraus für die Zukunft zu lernen. Man läßt sich möglicherweise auch lange wie Strandgut treiben, bis Spitzen von Felsen oder Stromschnellen sichtbar werden. Möglicherweise.
Die Seereise beginnt in Rotterdam. Wir steigen nur mit leichtem Gepäck in den Zug in Köln. Alle Gepäckstücke, es sind 15 Koffer unterschiedlicher Größe, sind schon mit einer Spedition zur Reederei vorausgeschickt. Bis Rotterdam ist es ja eine kurze Reise. Dort angekommen nehmen wir ein Taxi zum Reedereiagenten. Wir dürfen sofort auf das Schiff, obwohl es erst am nächsten Tag auslaufen soll. Ohne einen Arzt auf dem Schiff dürfen die Frachtschiffe höchstens 12 Passagiere transportieren. Wir sind insgesamt 7 Personen. Die Kabinen sind wie die der ersten Klasse in den Passagierschiffen. 24 Stunden Service. Kein Kleiderzwang im Gegensatz zu den Passagierschiffen. Eigentlich ideale Voraussetzungen für ruhiges Nachdenken und für Erholung.
Voraussichtliche Reisezeit: ca. 4 Wochen. Die Reiseroute sieht das Anlaufen von Beirut und Aden vor. Später wird noch Jidda hinzukommen. Und dazwischen natürlich der obligatorische Aufenthalt vor Port Said am Suez Kanal. Bei einer so langen Seefahrt durchlebt man alle Rauhheiten der Meere. Bis Windstärke 11. Bewegliche Gegenstände in den Kabinen werden festgebunden. Die Tischplatten im Eßsaal werden entfernt, damit der darunterliegende wattierte Teil des Tisches durchnäßt werden kann. Sonst fliegen die Kaffeetasse oder der Suppenteller beim Wellengang über den Tisch. Zum Glück werden wir nicht seekrank.
In Beirut ist der Ladevorgang so kurz, daß der Frachter außerhalb des Hafens ankert, um die Hafengebühren zu sparen. Also können wir nicht an Land. Aber fliegende Händler kommen, einige dürfen sogar auf das Schiff. Nicht die Händler lenken uns ab, sondern der Blick auf die wunderschöne Silhouette des noch unzerstörten Beiruts, der Perle des Orients, durch die farbenprächtigen Daus, die in unterschiedlicher Entfernung ankerten oder die an unserem industriell gebauten Frachtschiff vorbei segeln.
Ablenkung haben wir erst in Port Said. Nicht durch die fliegenden Händler, obwohl diese um das Schiff herum reichlich touristische Andenken lautstark feil bieten. Nein. Die Ablenkung beginnt mit unserem Wunsch, an Land gehen zu wollen. Die zufällige Tischordnung hat uns den Kapitän und den ersten Offizier beschert. Beim Frühstück erwähnen wir, daß wir gern an Land gehen wollen. Wir werden ernstlich gewarnt. Port Said soll einer der berüchtigten Häfen sein, was Nepp, Raub etc. angeht. Sie würden nie in den ägyptischen Häfen an Land gehen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Nach dem Frühstück steigen wir ins Motorboot der Hafenbehörde. Wir werden gebeten, noch im Hellen zurückzukommen, obwohl das Schiff erst am nächsten Morgen den Kanal passieren kann.
Außer uns beiden ist sonst keiner ins Motorboot gestiegen. Von dem Ankerplatz ist die Stadt so weit entfernt, daß unser Frachter nur langsam aus dem Blick verschwindet. In Augenblick kommen nur Schiffe aus Port Suez. Der Ausstieg aus dem Motorboot ist problemlos. Es ist nicht viel los am Vormittag. Wir laufen langsam in Richtung Stadt. Eigentlich wissen wir nicht, wohin wir gehen sollen. In einiger Entfernung sehen wir eine Moschee. Wir nehmen diese Richtung. In der Nähe der Moschee spricht uns einer an. Auf Englisch. Ein älterer, freundlicher Herr. Er ist erfreut, nachdem wir uns alles erzählt haben, was in so einer Situation zu erzählen ist. Indien, das heißt Nehru, ein großes Land, meint der ältere, freundliche Herr. Ich habe nicht gewußt, in welcher Hochachtung Indien im muslimischen Ägypten trotz der Kriege zwischen Indien und Pakistan steht. Und deutschfreundlich waren die Ägypter schon immer. Er heißt uns willkommen und fragt uns, ob wir die Moschee von innen besichtigen wollen. Wir wollen.
Er verhält sich wie ein Fremdenführer. Innen ist die Moschee sehr weitläufig. Mit vielen unterteilten Räumlichkeiten. Eine große Halle und viele kleinere Hallen unterschiedlicher Größe. Die Fußböden der Hallen sind mit Teppich bedeckt, praktisch von Wand zu Wand. Nicht wie in Europa mit Teppichböden. Die Teppiche haben unterschiedliche Muster, unterschiedliche Farbtöne, auch unterschiedliche Größen. Aber zusammen wirken sie wie ein einziger Schmuck, wie ein Gemälde in einem riesigen, sonst schmucklosen Bauwerk. Wie nehmen uns Zeit. Draußen ist es schon heiß. Im Inneren der Moschee ist es angenehm kühl. Als wir schließlich aus der Moschee kommen, wollen wir uns von unserem ägyptischen „Fremdenführer“ verabschieden. Er ist damit nicht einverstanden. Er will uns doch die Stadt noch zeigen. Wir stimmen zu. Wir spazieren gemächlich immer auf der Schattenseite der Straßen und besichtigen die wenigen Sehenswürdigkeiten. Am frühen Nachmittag haben wir Hunger, obwohl die Hitze bereits unappetitlich stark ist. Wir suchen so etwas wie ein Café auf und imbissen. Während dessen unterhalten wir uns, über nichts Bestimmtes und fragen beiläufig, warum die Stadt so leer ist. Wir haben den Freitag erwischt. Als wir im Café bezahlen wollen, ist er uns fast böse. Wir sind heute seine Gäste. Er hätte sich so gefreut, mit uns durch die Stadt zu spazieren und daß wir keine Hetze hatten und überhaupt. Nichts zu machen. Er setzt seinen Willen durch. Er weiß und wir wissen, daß wir uns im Leben nie wieder begegnen werden. Was für eine Gastfreundschaft!
Читать дальше