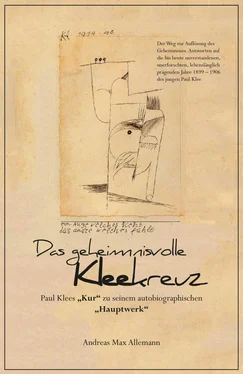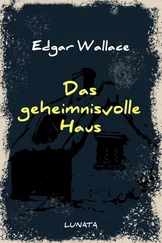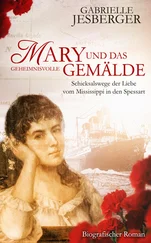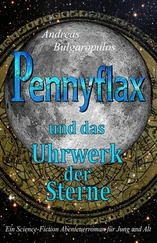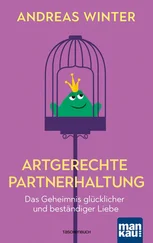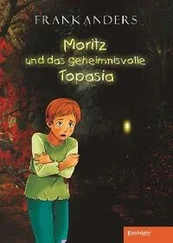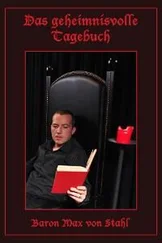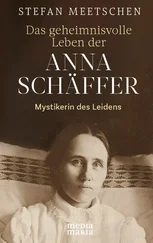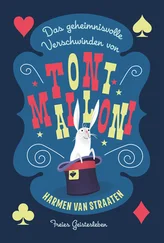Das ist der Ansatz nach dem wir vorgehen, um die Systematik der Methode seines gesamten Schaffens zu verstehen. In seinen Aufzeichnungen schilderte er nicht, sondern deutete an oder hin, vertiefte es andernorts und bezog sich gleichzeitig auf weitere Inhalte. Alles zusammen verbleibt in einer Rätselhaftigkeit die nicht im Einzelnen, nur in Zusammenhängen gelöst werden kann. Wir werden den Zusammenhang an folgenden Beispielen erkennen:
„Neapel (Ostern 1902)“
385 „Der Epigon. In mir kreist das Blut einer besseren Zeit. Durch die Gegenwart schlafwandelnd, hänge ich an der alten Heimat, am Grab meiner Heimat. Denn alles verschlang der Boden. Die südliche Sonne hilft nicht meinem Leiden.
Die spanische Tänzerin Guerrero ist schön gewachsen und von einer entzückenden Heiterkeit. Das Ganze ist zu leicht, um mehr als unterhaltend zu sein. Tech – 103 nisch fehlts an der Beweglichkeit des Oberkörpers, er bleibt in dem sonst freien Fluss der Linie zu aufrecht, was dem Tanz manchmal den Eindruck des Haftens gibt. Der Rhythmus der Füsse ist besonders gut.
Mogens, von Jacobsen, ist eine wundervolle Novelle. Auch Niels Lyhne ist dem Inhalt nach eine Novelle, aber leider zu episch behandelt. Nachdem mir dieses Buch von Schmoll überreicht worden war, konnte ich mich eine Zeit lang schwer über das Anstreichen verschiedener Stellen ärgern. Man ist parteiisch, denn als ich entdeckte, dass die Anmerkungen von Dir herrührten, verwandelte sich mein Gefühl ins Gegenteil, und ich küsste diese Stelle.“
Juni 1900
103 „Oft bin ich vom Teufel besessen, mein Missgeschick auf jenem so problemreichen Sexualgebiet machte mich nicht besser. In Burghausen hatte ich grosse Schnecken auf verschiedene Weise geärgert. Jetzt unterliege ich in dieser, womöglich noch entzückenderen Thunerseegegend ähnlicher Versuchungen. Unschuld reizt mich. Der Gesang der Vögel geht mir auf die Nerven, jeden Wurm möchte ich zertreten.“
Den 385 bezeichnet Klee als Epigon. Das Wort Epigon leitet sich aus dem Griechischen epigonos ab und ist als Nachkomme, Nachgeborenes oder danach entstehend, zu übersetzen. Daher sind die beiden Zitate nachahmende Verweise auf einen Vorgang mit ausserordentlichen Folgen.
Er spricht ein früheres, sehr leidvoll empfundenes Ereignis an, in das er ohne grosses Nachdenken hineinstolperte, gleichsam „schlafwandelnd“, mit für ihn schmerzlichen Konsequenzen. „Denn alles verschlang der Boden“, womit er an ein Grab denkt.
Im zurückweisenden 103, lässt Klee das Vorgefallene erfühlen. Es geht um sein „Missgeschick auf jenem so problemreichen Sexualgebiet.“
In diesem Zusammenhang sind die „Burghausen-“ und „Thunerseegegend-“ Gefühle und Erlebnisse epigonisch zu verstehen. Sie weisen auf Tod und Tötung hin.
Zurück zum 385. Dort benennt Klee und wertet die Novelle „Mogens, von Jacobsen.“
Jens Peter Jacobsen, geboren am 7. April 1847 in Dänemark.
Mogens, als autobiographisch anmutende Figur erlebt, in für Novellen typischer Art, eine wohlgeordnete und sorgenfreie Phase. Dann eine überaus grosse Erschütterung die ein immenses persönliches Chaos auslöst. In der dritten Phase die Auflösung des Chaos zur neuen Ordnung.
Nach ungetrübter Jugend lernte Mogens die Tochter eines Justizrates kennen und der gegenseitigen Liebe folgte die Verlobung. Eine Feuersbrunst in der nachbarlichen Fabrik erfasste auch das Landhaus des Justizrates. Trotzdem Mogens alles unternahm, die Verlobte zu retten, starb sie qualvoll im brennend zusammenbrechenden Holzhaus. Mogens, selbst, durch herabstürzende Balken eingeklemmt, konnte nur tatenlos zusehen. Dieses schreckliche Erlebnis hinterliess bei Mogens tiefe und langanhaltende depressive Spuren, die ihn ins Chaos stürzten.
Die Erlösung aus dem Chaos kam mit „Thora“, einer neuen Liebe. Die fügte das Chaos wieder zusammen in eine neue Ordnung.
Zitat aus der Novelle:
[….] „Es ist wie im Märchen, wenn Hans und Grete draussen im Wald an das Pfefferkuchenhäuschen kommen“ sagte Thora [...] (Ende Zitat)
Erwähnenswert im 385 „der Epigon“ ist folgendes:
Als Paul Klee entdeckte, dass die Anstreichungen im Buch mit der Novelle „von Dir“, nämlich von seiner Braut Lily stammten, wechselte sein Ärger in Freude.
[…] „und ich küsste diese Stelle.“
Warum wohl küsste er diese Stelle? Für Paul Klee war seine Braut Lily das Gleiche wie Thora für Mogens, nämlich die Erlösung aus dem Chaos in eine neue alles ordnende Liebe.
Dieser von Paul Klee vorgezeigte methodische Weg ist die einzige Möglichkeit, den Geheimnisschleier zu lüften.
Paul Klee übertitelte sehr viele Eintragungen mit allgemein verständlichen, sinngebenden Wortbedeutungen.
Wir erkannten vorher die Novelle und das Epigon. Im 286 verwendet er das Epigramm, abgeleitet vom lateinisch-griechischen „darauf schreiben.“
Der zweifache Sinn ist mit, erstens Inschriften auf Monumenten oder Grabmälern und zweitens, als eigenständige Dichtform von kurzen, prägnanten Versen oder Gedanken von grosser Ernsthaftigkeit, teils spöttischer Natur, zu definieren. (Mit spitzer Feder)
Rom, November 1901
286 „Epigramme mit Reimen:
Dahin / fürs Malen kein Sinn
verscherzt die geliebte Musik mein Sohn / Hohn
Die Liebe als Sonne, ich als Sumpf:
Sonnenverpester als Dank
weil es bei mir von Sümpfen stank.
Bewahren / an Jahren / verstanden / vorhanden.
Welt / dann kosteten andere mein Geld
das selber ich meinen Vater kostete.
Geboren / geschoben / Herde, Erde
Angst des Weibes / Wunden und Schwären,
am Berge gebären / der Schande
Befreier / Dohlen und Geier
wurde ich los das Gewächs meines Leibes.
Freier / Leiber / Geleier / Weiber.“
Das eben gelesene Epigramm beschreibt Klees psychische situative Verfassung im Erinnern eines früheren, ihn sehr tief treffenden Ereignisses. Ich vermeide das Wort Traumatisierung bewusst, weil ich das Ereignis in allen Einzelheiten später beschreiben werde.
Fassen wir die Inhalte des Epigramms zusammen: Unlust am Malen und an der Musik. Die Zweideutigkeit der Liebe, sowohl als Licht, wie als Sumpf. Die Liebe als Sumpf kostete viel Geld. Das Hoffen, Bangen und die Angst vor der Geburt. Die Schande, die Befreiung des „Gewächs meines Leibes.“ Die Befreiung, durch „Dohlen und Geier“, beides Raubvögel.
Was soll das heissen?
Diese Frage wird sich auflösen.
Vorerst eine Anmerkung.
Paul Klee schuf 18 Jahre nach dem Eintrag 286 („Epigramm“) ein Werk namens „Sumpflegende“
[...] „die Liebe als Sonne, ich als Sumpf,; Sonnenverpester als Dank weil es bei mir von Sümpfen stank.“ [...]
Der Sumpf ist ein ständig feuchtes Gelände. Umgangssprachlich bildeten sich verschiedenste Redensarten oder Sprichwörter wie, sich aus dem Sumpf von Lügen, von Korruption, von schlechter Gesellschaft retten, sich aus einer fast ausweglosen Lage befreien.
Die Legende ist eine bildhaft spezielle Erzählung, die im Kern eine historische oder religiöse Wahrheit enthält, um die Tatsache eines Geschehens vermitteln zu versuchen. Die Legende ist mit der Form eines Märchens, der einer Sage verwandt.
Das nähere Betrachten des Bildes, datiert mit 1919 unter Zuhilfenahme des Titels einerseits und der schriftlich formulierten Inhalte des Epigramms von 1901, lassen uns Formen der Graphik erkennen:
In der Ecke links unten sehen wir eine kleine Sumpflandschaft, links und rechts umsäumt mit Tannen. Eine kleine Figur mit Kopfbedeckung trägt auf seinen Schultern eine Stange mit einem grossen Netz und hat etwas aus dem Sumpf befreit. Das Etwas entpuppt sich als winzige menschliche Gestalt, weiss gekleidet und vom Sumpf bedeckt. Die Kopfbedeckung der grösseren, rettenden Figur markiert der Künstler mit einer 1.
Читать дальше