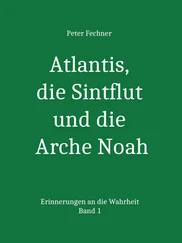Alana Maria Molnár
EINMAL IM JAHR
DIE SINTFLUT
Roman
Imprint
Einmal im Jahr die Sintflut - Roman
Alana Maria Molnár
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: © 2012 Alana Maria Molnár
ISBN 978-3-8442-3674-3
Das Leben in einem Dorf im Nordosten Ungarns in den Jahren 1956–1965. Den Krieg kennt meine Generation nur noch vom Hörensagen, die Hungerjahre unmittelbar danach hat sie nicht erlebt; auf dem Land gab es immer reichlich zu essen.
Das tägliche Leben wird von den Jahreszeiten und der Arbeit auf den Feldern, im Garten, im Haus und Hof bestimmt. Die Strukturen der Großfamilie sind noch lebendig, mit all ihren Vor- und Nachteilen.
Die Auswirkungen des Aufstandes 1956 (in der offiziellen Sprache "Konterrevolution" genannt) bekommt fast jede Familie zu spüren, auch in der Provinz. Im Geschichtsunterricht wird das Thema erst Mitte/Ende der 1960-er Jahre vorsichtig behandelt.
Sonst funktioniert die politische Schizophrenie im Alltag tadellos: Die Parteifunktionäre lassen ihre Kinder zwei-drei Dörfer entfernt in der Kirche taufen und wenn diese das heiratsfähige Alter erreichen, erhalten sie eben noch ein Dorf weiter den priesterlichen Segen zur Eheschließung.
In der Familie Márton herrscht größte Einigkeit der Ansichten und Werte: Der Vater ist nach eigenem Bekennen Atheist (und stolzer Besitzer des Parteibüchleins samt Abzeichen, das er stets am Revers seiner Jacke zur Schau trägt), die Großmutter praktizierende Katholikin (und erbitterte Gegnerin von allem "Rotgefärbten") und die Mutter steht mit allem Mystischen auf Du und Du (sie stammt aus Siebenbürgen und ist trotz ihrer "Spinnerei" die bodenständigste von allen).
Die Autorin: Übersetzerin für die ungarische Sprache und bildende Künstlerin, lebt seit 1972 in Berlin.
„Jedermann erfindet sich früher oder später
eine Geschichte, die er für sein Leben hält.“
Max Frisch
Für meine Eltern
Letzter Arztbesuch
Beim Einsetzen meiner ersten eigenen Erinnerungen bin ich knapp fünf Jahre alt. Mein Großvater ist neunundfünfzig und krank. Er ist so krank, daß er im Bett liegen bleiben muß, er ist halbseitig gelähmt. Weder die rechte Hand noch den rechten Fuß kann er bewegen, er spüre darin nichts, sagt er, nur eine große Kälte. Doktor Horváth kommt zweimal die Woche zum Großvater, um ihn zu behandeln. Feri, der Barbier auch, nur an anderen Tagen als der Arzt. Feri hat ein Friseurgeschäft in der Hauptstraße, eine kleine dunkle Kammer mit immer schmutzigen Fensterscheiben. Während er Hausbesuche macht, bedient seine betagte Mutter die Kundschaft; rasieren und Haare waschen kann sie schließlich auch. Feris gewellte blonde Haare duften nach Pomade, sein rosiges Gesicht ziert eine noch rosigere Nase und er bringt immer gute Laune mit. Mit ihm weht ein frischer Wind ins Krankenzimmer, das eigentlich die Wohnküche meiner Großeltern ist.
Wie ein Zauberer im Varieté holt Feri ein großes Tuch aus seiner Tasche, die ein bißchen wie die Arzttasche von Doktor Horváth aussieht, nur daß sich ab und an eine sorgfältig verkorkte Flasche zwischen die Utensilien seiner Zunft verirrt. Die Flasche sieht genauso aus wie die, die Großmutter für zahlende Kundschaft im Weinkeller abfüllt.
Feri wedelt ein paarmal mit dem blütenweißen Tuch, bevor er es Großvater umbindet. Großvater sitzt jetzt aufrecht im Bett, im Rücken von mehreren Kissen gestützt. Inzwischen hat Großmutter schon warmes Wasser in die Schale gegossen, die Feri aus den Untiefen seiner Tasche hervorgezaubert hat. Dann kommt der große Auftritt des Figaro: Mit lockeren Bewegungen aus dem Handgelenk rührt er Seifenschaum in der Schale an, vorher hat er das ausklappbare Rasiermesser an einem Lederriemen geschärft. Ich halte jedesmal vor Spannung die Luft an, wenn Feris Messer an Großvaters faltigem Hals und an dem hervorstehenden Adamsapfel hinauf- und hinuntergleitet.
Am Nachmittag kommt wieder Doktor Horváth zum Großvater. Großmutter schickt mich wie immer hinaus.
»Du kannst bald wieder hereinkommen«, sagt sie, »wenn der Herr Doktor fertig ist.«
Vor der Tür lausche ich auf jedes Geräusch. Ich höre Großvater stöhnen. Als der Arzt weg ist, tröste ich ihn damit, daß ich ihn garantiert heilen werde, weil der Doktor das offensichtlich nicht kann.
Früher als sonst schläft Großvater an diesem Abend ein.
»Sei leise, wenn du hinausgehst«, ermahnt mich Großmutter, »ich bin froh, daß er jetzt schläft und keine Schmerzen spürt.«
Großvater ist gegangen
Großvater liegt auf dem kalten Fußboden der guten Stube. Sein Kinn ist mit einem Tuch hochgebunden. Wie bei dem Hasen mit Zahnweh in meinem neuen Bilderbuch. Aus dem Bett kann er nicht gefallen sein.
Das schwarzgestrichene Eisenbett, in dem er die letzten anderthalb Jahre gelegen hat, steht in der Wohnküche, Fuß an Kopf zum Zwillingsbett der Großmutter, gleich neben dem alten, emaillierten Herd. Der Herd hat auf der Oberseite drei Platten in unterschiedlicher Größe und jede Platte hat eine kleine Mulde, in die man mit dem Schürhaken hineinlangen kann, um die Platte abzuheben. Das hat Großvater immer beim Feueranmachen getan. »Damit das Feuer Luft bekommt«, erklärte er mir.
Jetzt aber sagt er gar nichts, obwohl ich ihn schüttele und rüttele, er soll vom kalten Fußboden endlich aufstehen. Er holt sich noch den Tod. Das sagt Großmutter immer, wenn meinem kleinen Bruder irgendwas nicht paßt, sich auf den Boden schmeißt und brüllt.
Nur Großvater sagt nichts.
»Wer hat Júlia in die Stube gelassen?«
Die Tonlage der Mutter ist so hoch, daß es in den Ohren schmerzt. So hört sich ihre Stimme an, wenn sie wütend ist, in der Küche steht und nach etwas Ausschau hält, was sie auf den Fußboden werfen könnte. Manchmal findet sie auch was, dessen Zertrümmerung ihr nicht leid tut. Meistens aber schleicht sie nach dem Anfall geknickt im Hof herum und trauert um das gute Stück Geschirr oder den verbeulten Kochtopf.
Jetzt scheint die Ursache der bedrohlichen Stimmlage der qualmende Herd zu sein, denn sie hat mich aus der guten Stube der Großeltern in die Küche gezerrt. Mutter stochert im Herd und im Nu ist die Küche voller Rauch. Der kriecht mir in die Nase und von dort in die Kehle, daß ich husten muß.
»Ihr könnt alle nicht heizen«, hustet auch Vater, der gerade hereinkommt. Er sieht wieder mal nach dem Rechten. Er öffnet ein wenig die Tür vom Herd, schiebt den Regler von links nach rechts und zurück, mit dem Ergebnis, daß noch mehr Rauch aus dem Inneren des Herdes herausquillt. Der Qualm kriecht durch alle Ritzen.
»Der Schornstein ist verstopft und der Herd müßte neu ausschamottiert werden«, bemerkt Mutter, »das bete ich seit Jahren schon vor«.
»Was versteht ihr davon«, blafft Vater sie an.
Wer sonst noch außer Mutter gemeint ist, kann man bei Vater nie genau wissen, er tadelt immer im Plural.
»Was macht Großvater auf dem Fußboden?« frage ich dazwischen, bevor die Eltern erneut zum Streit ansetzen, der manchmal Marathonlänge erreichen kann.
»Nichts«, antwortet Vater und dreht sich weg.
»Wieso erklärst du es deiner Tochter nicht?« hakt Mutter nach und das ist das Stichwort für Vater. Wie im Theater: die Akteure brauchen eine Merkstelle, an der sie wissen, daß jetzt ihr Einsatz kommt. Damit das Stück weitergehen kann. Meine Eltern haben viele Stücke für das Familientheater, in dem jeder eine feste Rolle mit festen Stichwörtern hat. Mein Bruder und ich sind Statisten, Zuhörer und Zuschauer in einem und je älter wir werden, bedenken uns die Eltern zunehmend mit kleineren Nebenrollen.
»Sag du es ihr, wenn du es besser weißt«, nimmt Vater sein Stichwort auf und beeilt sich, aus der Küche zu kommen. Anstatt die Tür offen zu lassen, damit der Rauch abziehen kann, knallt er sie zu, daß die Scheiben scheppern. Und damit es keinem einfällt, ihn mit weiteren lästigen Fragen zu löchern, schlägt er auch noch die dicke fensterlose Außentür aus Holz zu.
Читать дальше