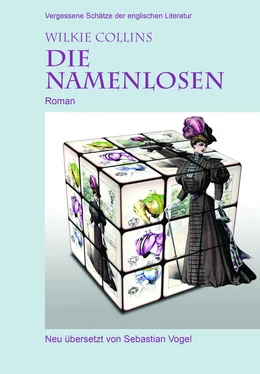„Gott helfe mir, was soll ich nur tun?“, brach es aus ihr heraus. „Wie soll ich es ihnen sagen?“
„Es ist nicht notwendig, es ihnen zu sagen“, sagte eine Stimme hinter ihr. „Sie wissen es schon.“
Miss Garth fuhr hoch und sah sich um. Vor ihr stand Magdalen – und Magdalen hatte gerade gesprochen.
Ja, es war die anmutige Gestalt in ihrer Trauerkleidung. Groß und schwarz und unbeweglich stand sie vor dem Hintergrund aus Blattwerk. Es war Magdalen selbst mit einer unveränderlichen Stille im Gesicht und einer eisigen Resignation in den ruhigen grauen Augen.
„Wir wissen es schon“, sagte sie in klarem, bedächtigem Ton. „Mr. Vanstones Töchter sind Niemandes Kinder; und das Gesetz überlässt sie hilflos der Gnade ihres Onkels.“
Ohne eine Träne auf der Wange, ohne ein Stocken in der Stimme wiederholte sie die Worte des Anwalts, wie er sie ausgesprochen hatte. Miss Garth stolperte einen Schritt rückwärts und griff nach der Bank, um sich festzuhalten. In ihrem Kopf drehte sich alles; sie schloss die Augen in einem kurzen Schwächeanfall. Als sie wieder zu sich kam, wurde sie von Magdalens Arm gestützt; Magdalens Atem wehte über ihre Wange, Magdalens kalte Lippen küssten sie. Sie zog sich vor dem Kuss zurück; die Berührung der Lippen des Mädchens erfüllte sie mit Entsetzen.
Sobald sie wieder sprechen konnte, stellte sie die unvermeidliche Frage. „Du hast uns gehört“, sagte sie. „Wo?“
„Unter dem offenen Fenster.“
„Die ganze Zeit?“
„Von Anfang bis Ende.“
Sie hatte gelauscht. Dieses Mädchen von achtzehn Jahren hatte in der ersten Woche als Waise die ganze schreckliche Offenbarung belauscht – Wort für Wort, wie sie von den Lippen des Anwalts kam. Und sie hatte sich dabei kein einziges Mal verraten! Die einzigen Bewegungen, die sie nicht unterdrücken konnte, waren so beherrscht und geringfügig gewesen, dass man sie fälschlich für den Hauch der sommerlichen Brise in den Blättern halten konnte!
„Versuchen Sie jetzt nicht zu sprechen“, sagte Magdalen in weicherem, zarterem Ton. „Sehen Sie mich nicht mit so zweifelnden Blicken an. Welches Unrecht habe ich getan? Als Mr. Pendril mit Ihnen über Norah und mich zu sprechen wünschte, überließ er uns in seinem Brief die Entscheidung, ob wir bei den Gespräch zugegen sein oder fernbleiben wollten. Meine ältere Schwester entschloss sich, fernzubleiben – wie konnte ich da kommen? Wie konnte ich meine eigene Geschichte anders hören als so? Mein Lauschen hat keinen Schaden angerichtet. Es hat etwas Gutes bewirkt – es hat Ihnen den Kummer erspart, mit uns zu sprechen. Sie haben schon genug für uns gelitten; es ist an der Zeit, dass wir lernen, selbst zu leiden. Ich habe es gelernt. Und Norah lernt es gerade.“
„Norah!“
„Ja. Ich habe getan, was ich konnte, um Sie zu verschonen. Ich habe es Norah erzählt.“
Sie hatte es Norah erzählt! Der Mut dieses Mädchens hatte der entsetzlichen Notwendigkeit ins Auge geblickt, vor der eine Frau, die alt genug war, um ihre Mutter zu sein, zurückgeschreckt war. War das noch dasselbe Mädchen, das Miss Garth groß gezogen hatte? Das Mädchen, dessen Charakter sie ebenso gut zu kennen glaubte wie ihren eigenen?“
„Magdalen“, rief sie leidenschaftlich, „du machst mir Angst!“
Magdalen seufzte nur und wandte sich ermattet ab.
„Bitte denken Sie nicht schlechter von mir als ich es verdiene“, sagte sie. „Ich kann nicht weinen. Mein Herz ist taub.“
Langsam entfernte sie sich über die Wiese. Während die große schwarze Gestalt davonglitt, sah Miss Garth ihr nach, bis sie allein unter den Bäumen war. Solange Magdalen sich im Blickfeld befand, konnte sie an nichts anderes denken. In dem Augenblick, da sie verschwunden war, dachte sie an Norah. Zum ersten Mal in ihrer Erfahrung mit den Schwestern führte ihr Herz sie instinktiv zu der älteren der beiden.
Norah war noch in ihrem Zimmer. Sie saß auf der Couch am Fenster. Das alte Notenheft ihrer Mutter – das Andenken, das Mrs. Vanstone am Todestag ihres Mannes in dessen Studierzimmer gefunden hatte – lag aufgeschlagen auf ihrem Schoß. Sie blickte mit so stiller Trauer davon auf und wies mit einer so bereitwilligen Freundlichkeit auf den freien Platz an ihrer Seite, dass Miss Garth im ersten Augenblick zweifelte, ob Magdalen die Wahrheit gesagt hatte. „Sehen Sie“ sagte Norah einfach und blätterte die erste Seite des Notenheftes auf, „da steht der Name meiner Mutter und auf der nächsten Seite ein paar Verse für meinen Vater. Wenigstens das können wir behalten, wenn uns auch sonst nichts bleibt.“ Sie legte den Arm um Miss Garth’ Hals, und ein schwacher Hauch von Farbe stahl sich auf ihre Wangen. „Ich sehe ängstliche Gedanken in Ihrem Gesicht“, flüsterte sie. „Haben Sie Angst um mich? Zweifeln Sie daran, dass ich es gehört habe? Ich habe die ganze Wahrheit erfahren. Vielleicht spüre ich sie bitter – später. Um es jetzt zu spüren, ist es noch zu früh. Haben Sie Magdalen gesehen? Sie ist hinausgegangen, um nach Ihnen zu suchen – wo haben Sie sich getrennt?“
„Im Garten. Ich konnte nicht mit ihr sprechen, ich konnte sie nicht ansehen. Magdalen hat mir Angst gemacht.“
Norah erhob sich hastig; erhob sich, verblüfft und bekümmert über Miss Garth’ Antwort.
„Denken Sie nicht schlecht von Magdalen“, sagte sie. „Magdalen leidet insgeheim mehr als ich. Versuchen Sie, sich nicht wegen der Dinge zu quälen, die Sie heute Vormittag über uns erfahren haben. Ist es von Bedeutung, wer wir sind und was wir haben oder verlieren? Welchen Verlust gibt es noch für uns nach dem Verlust von Vater und Mutter? Ach, Miss Garth, das ist das einzig Bittere! Was ist von ihnen in Erinnerung geblieben, als wir sie gestern ins Grab gelegt haben? Nichts als die Liebe, die sie uns gegeben haben – die Liebe, auf die wir nie wieder hoffen dürfen. Woran können wir uns heute sonst noch erinnern? Was kann die Welt, was können die grausamsten Gesetze der Welt in unserer Erinnerung an den gütigsten Vater verändern, an die gütigste Mutter, die Kinder jemals gehabt haben?“ Sie hielt inne, kämpfte mit ihrem aufsteigenden Kummer, hielt ihn still und entschlossen zurück. „Würden Sie hier warten, während ich gehe und Magdalen hole?“, fragte sie. „Magdalen war immer Ihr Liebling: Ich möchte, dass sie auch jetzt Ihr Liebling ist.“ Sie legte das Notenheft sanft auf Miss Garth’ Schoß und verließ das Zimmer.
„Magdalen war immer Ihr Liebling.“
So zärtlich sie diese Worte auch gesprochen hatte, in Miss Garth’ Ohren klangen sie vorwurfsvoll. Zum ersten Mal in der langen Gemeinschaft zwischen ihren Schülerinnen und ihr drängte sich ein Zweifel in ihren Geist, ob nicht sie und alle um sie herum im Verhältnis ihrer Wertschätzung für die Schwestern einen verhängnisvollen Fehler begangen hatten.
Zwölf Jahre lang hatte sie das Wesen ihrer beiden Schülerinnen im täglichen vertrauten Umgang studiert. Dieses Wesen, das sie in all seinen Tiefen ausgelotet zu haben glaubte, war plötzlich in der Qual der Bedrängnis auf die Probe gestellt worden. Wie waren die Schwestern aus der Prüfung hervorgegangen? So wie sie auf Grund ihrer früheren Erfahrungen vorbereitet war, sie zu sehen? Nein, genau im Gegenteil.
Was hatte ein solches Ergebnis zu sagen?
Als sie sich diese Frage stellte, kamen ihr Gedanken, die uns alle schon einmal aufgerüttelt und betrübt gemacht haben.
Gibt es in jedem Menschen hinter dem äußeren, sichtbaren Charakter, der durch die gesellschaftlichen Einflüsse aus seiner Umgebung geformt wird, eine innere, unsichtbare Veranlagung, die ein Teil unserer selbst ist und durch Erziehung vielleicht indirekt abgewandelt werden kann, ohne dass aber jemals die Hoffnung besteht, sie zu verändern? Ist die Philosophie, die dies verneint und erklärt, wir würden mit Veranlagungen geboren wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, in Wirklichkeit auch eine Philosophie, die nicht zur Kenntnis nimmt, dass wir nicht mit einem leeren Gesicht geboren werden – eine Philosophie, die niemals zwei erst wenige Tage alte Säuglinge verglichen hat, die nie beobachtet hat, dass diese Säuglinge nicht mit einem leeren Temperament geboren werden, das Mütter und Ammen nach Belieben füllen können? Gibt es in uns allen, unendlich schwankend in jedem Einzelnen, angeborene Kräfte des Guten und des Bösen, die tief unterhalb der Reichweite sterblicher Ermutigung und sterblicher Unterdrückung liegen – verborgenes Gutes und verborgenes Böses, beide gleichermaßen abhängig von der befreienden Gelegenheit und der ausreichenden Versuchung? Sind irdische Umstände innerhalb dieser irdischen Grenzen stets der Schlüssel? Und kann noch so viel menschliche Wachsamkeit uns vielleicht im Vorhinein nicht vor den Kräften warnen, die in uns eingeschlossen sind und die dieser Schlüssel freisetzen kann?
Читать дальше