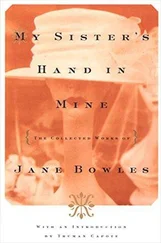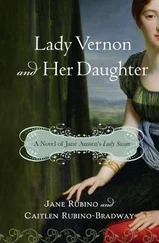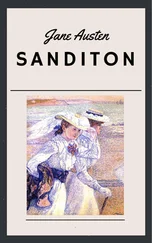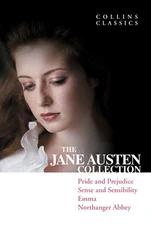Jane D. Kenting - Verkennung
Здесь есть возможность читать онлайн «Jane D. Kenting - Verkennung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Verkennung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Verkennung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Verkennung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Angsttherapeut Arnd Weyden hat eine Schwäche für Unheimliches. Von der Großstadt ins stille Tiefenwald gezogen, fragt er sich schon bald: Warum brennt in einer bewohnten Villa nie Licht? Was verbirgt Irina vor ihm, die nahe dem düsteren Gebäude wohnt und deren Widersprüche ihn immer mehr faszinieren? Während der Psychologe sich tief in Rätsel verstrickt, nimmt sein Patientenfall Jander verstörende Formen an. Zu spät bemerkt Weyden, was wirklich geschieht …
Verkennung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Verkennung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Den zweiten Spaziergang zum Westhang machte ich samstags bei Nieselregen und Tageslicht. Es war neun Uhr morgens, und fast wäre ich an der glitschigen Stiege vorbeigelaufen, welche die Straßenbiegung für Fußgänger abkürzte. Beim ersten Mal hatte ich sie offenbar übersehen. Ich stellte mich unten an den Fuß der Treppe und fotografierte sie, um sie meiner Sammlung unheimlicher Bilder hinzuzufügen. Ich staunte über die ausgetretenen Stufen, den hohler werdenden Stein, denn die Anwohner dieser Straßen bewegten sich nur mit dem Auto fort. Lange musste es her sein, dass die Sohlen auf- und abwärts laufender Menschen die Treppe geformt hatten.
Achtundfünfzig Stufen zählte ich, während sich meine Füße über den feuchten Stein nach oben tasteten. Links und rechts wucherte Efeu um verwitterte Zäune.
Oben grenzte die Treppe seitlich an das Fachwerkhaus mit dem gedrungenen Dach. Schräg gegenüber, am anderen Ende der Kreuzung, lag Villa Tann auf ihrem Hügel, der hinten – anders, als ich es im Dunkeln gesehen hatte – in einen Park überging. Rasch lief ich auf das Anwesen zu. Im Vorgarten streckten hohe Bambussträucher ihre Säbelblätter durch den Zaun. Dahinter glitzerte eine schwarze Wasserfläche.
Ich machte noch ein Foto.
Als ich die Kamera sinken ließ, sah ich am Rand der Kreuzung das Schild. Kaltenseestraße.
Langsam wandte ich mich ab und ging wieder auf die Stiege zu. Als ich meinen Fuß auf die oberste Stufe setzte, bemerkte ich vor dem Fachwerkhaus eine Gestalt. Ein langer Rock oder Mantel umspielte die Beine, der Kopf war in eine Kapuze gehüllt. Die Gestalt saß auf der Türschwelle, sog an einer Zigarette und sah in meine Richtung. Ihre Augen mussten schon auf mir geruht haben, als ich zur Stiege kam, und sie lösten in mir eine Beunruhigung aus, die ich mir nicht erklären konnte – so wenig, dass ich sofort dagegen ansteuerte. Eine Frau an einem Oktobermorgen, rauchend vor ihrem Haus, bedachte mich mit einem Blick, der für eine Fremde vielleicht Sekundenbruchteile zu lang, doch keineswegs auffällig war.
»Sie haben recht«, rief ich. »Man sollte jeden Regentropfen nutzen.«
Still saß sie auf der Türschwelle und blies Rauchwolken in die Luft. Ich überlegte, ob sie es überhört haben konnte. Bevor ich zu einem Ergebnis kam, stand sie auf und ging auf mich zu. Den Zigarettenstummel warf sie ins Gras. Sicher war es nicht der erste, der dort seine letzte Ruhe fand. Dicht vor den schmiedeeisernen Schnörkeln des Zauns blieb sie stehen. Auch ich trat so nah wie möglich heran. Das Gesicht in der Kapuze war matt. Die Frau sah aus, als wäre sie gerade erst aufgestanden, hätte sich das Nötigste übergezogen und sofort zu Zigarette und Feuerzeug gegriffen.
Sie stand einfach da und betrachtete mich. Nicht neugierig, nicht verwundert, eher so, wie man ein ausgestelltes Kunstobjekt ansieht, mit einer Mischung aus Langeweile und Aufmerksamkeit. Durch ihr schwarzes Haar zogen sich ein paar weiße Fäden. Sie war vielleicht Mitte vierzig, nur wenig jünger als ich.
»Habe ich Sie gestört?« Ich versuchte das Grinsen zu verhindern, das sich auf meinem Gesicht ausbreitete, schaffte es aber nicht.
In der Körpersprache ist unsere Mimik angeblich das, was wir am leichtesten kontrollieren können. Alle Lehrbücher stimmen darin überein. Seit jener Begegnung gebe ich nichts mehr darauf.
»Falsche Frage«, sagte sie, ohne ihren Gesichtsausdruck zu verändern. »Störungen gibt es hier nicht. Nur Ablenkungen.« Sie forschte weiter in meinem Blick.
»Wovon lenke ich Sie ab?«
Sie lächelte. Und sie schwieg.
»Vielleicht ist es genau anders herum, denn …«, begann ich und ärgerte mich, da ich selbst nicht wusste, was ich damit bezweckte.
Dann fiel es mir ein. »Sie lenken mich vom Ziel meines Spaziergangs ab.«
»Passiert Ihnen so etwas oft?«
»Nein. Ich frage mich nur, was es mit dem Geisterschloss dort drüben auf sich hat.« Ich deutete mit dem Daumen hinter mich und beobachtete gespannt ihre Reaktion.
Nichts an der Frau veränderte sich. Kein Erstaunen war sichtbar, nicht einmal Desinteresse.
Ich war darin geübt, mich vom Schweigen meines Gegenübers nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ganz gleich, ob es um ein provokatives Schweigen, ein ratloses oder ein gleichgültiges ging. Das hier war aber anders. Hier war ich der Patient – derjenige, der mit einem Anliegen kam. Jemand mit einem Anliegen war meistens in der schwächeren Position.
»Die Villa ist doch bewohnt?«, fragte ich.
Die Frau zog ihre schmalen schwarzen Augenbrauen hoch, und ich dachte, sie würde weiter schweigen, als sie plötzlich flüsterte: »Haben Sie hier oben schon ein Haus leerstehen sehen?«
Es stimmte. Leeren Wohnraum gab es in solchen Vierteln nicht. Umzüge vollzogen sich in fliegendem Wechsel, diskret und von den Nachbarn hinter vorgehaltener Hand diskutiert.
»Nein. Aber normalerweise brennt in einem bewohnten Haus nach Sonnenuntergang Licht.«
Jetzt wandte sie den Blick ab, wenn auch nur für einen Moment. Als sie mich wieder ansah, erschrak ich über den Ausdruck in ihren Augen: eine Mischung aus Trauer und Angriffslust.
»Was ist normal?«, fragte sie. »Sagen Sie es mir. Was ist normal?«
Ausgerechnet mich fragte sie das.
»Normal ist es, sich ab und zu diese Frage zu stellen.«
»Ich stelle sie aber Ihnen.«
Ich war der Patient.
Bevor ich etwas erwidern konnte, drehte sie sich um und eilte zum Haus zurück, als hätte sie etwas vergessen. Auf der Schwelle rief sie mir über die Schulter zu: »Ein anderes Mal.«
Mit einer festen Bewegung schloss sie die Tür hinter sich.
Zu Hause ging ich in meinem Kalender die Termine der kommenden Woche durch. Ein neu angemeldetes Paar mit den bewährten Eheproblemen und ein Mann namens Lank, der mir schon zweimal seine dubiose Liebesgeschichte geschildert hatte und sich von der Aussicht auf eine dritte Sitzung ohne das von ihm erhoffte Ergebnis nicht abschrecken ließ. Das war alles. Privatpatienten fielen nicht vom Himmel, auch nicht für Spezialisten. Ich erwog verschiedene Möglichkeiten. Branchenverzeichnisse, Netzportale …
Portale.
In meiner Vorstellung tauchte das Schild Kaltenseestraße auf. Ein paar Augenblicke dachte ich nach, bevor ich mich an den Laptop setzte. Nach einigem Suchen fand ich die Nachricht im Papierkorb des Mailprogramms.
Ich wählte Janders Nummer und wartete acht Freizeichen ab. Kein Mensch und keine Maschine meldete sich. Ich notierte die Ziffern auf einem Zettel, den ich mit der Schreibtischlampe beschwerte. Dann zog ich die Jacke an und ging noch einmal nach draußen, um für das Wochenende einige Sachen in der Stadt zu besorgen. Wann immer ich konnte, erledigte ich solche Dinge zu Fuß, und entsprechend häufig lief ich an den benachbarten Häusern vorbei.
In einer Nachbarschaft wie dieser war es schwer, mit den Menschen Bekanntschaft zu machen. Jeder wohnte in seinem Haus, jeder kümmerte sich um seine Belange und allenfalls noch um jene derer, mit denen er seit Jahrzehnten bekannt oder verwandt war. Auch in Großstädten blieben die meisten Leute einander fremd, aber das hier war anders. Es war eine Anonymität auf hohem Niveau, eine Fremdheit, die mehr von den Überlegenheitsgefühlen jedes Einzelnen herrührte als von der natürlichen Scheu eines Städters vor anderen, deren Leben vom eigenen vielleicht weniger abwich, als ihm lieb war.
Von der eisigen Aura der Nachbarn ließ ich mich nicht beirren. Jeden Tag ging ich an ihren Hecken und Zäunen vorbei, während meine Gedanken zu Villa Tann schweiften. Denn mehr als die Leute in meiner direkten Umgebung, die zwar reserviert, nicht aber rätselhaft waren, beschäftigte mich die Frage, wer so ein riesiges lichtloses Haus bewohnte – und vor allem, warum er es tat. Wie sollte ich das ohne die Nachbarn erfahren? Irgendjemand musste doch bereit sein, sein Wissen und seine Gedanken über die Menschen in diesen seltsamen Straßen mitzuteilen. Jemand, der solche Dinge mit einer ähnlichen Art von Interesse betrachtete. Auf meinen verstorbenen Onkel konnte ich mich nicht berufen, da er meistens auf Reisen gewesen war und keine Kontakte zur Umgebung gepflegt hatte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Verkennung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Verkennung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Verkennung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.