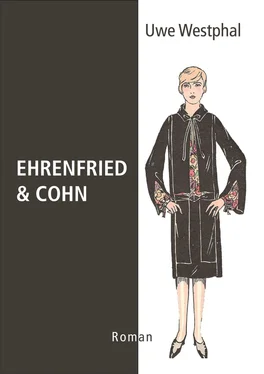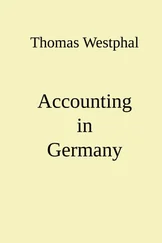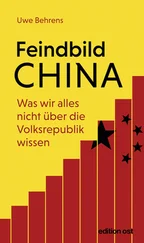Ehrenfried mochte Landauer – aber er war für ihn auch die Vergangenheit, das Alte Testament, und beides passte, so meinte Ehrenfried, weder in die heutige Zeit noch in seine Lebenserfahrung. Landauer ging nicht ins Café Reimann. Er mied die Revuen und das Kino, er scheute vor den Tanzveranstaltungen der Konfektionsbranche zurück. Stattdessen ging Landauer jeden Freitag und überhaupt an allen jüdischen Feiertagen in die orthodoxe Synagoge. Obwohl gerade mal Mitte 20, hatte Landauer schon drei Kinder. Er lebte mit ihnen und seiner Frau in einer muffigen Wohnung am Prenzlauer Berg.
Ehrenfried wohnte in einem Haus in der Bleibtreustraße. Sieben Räume, neben der Küche ein Aufenthaltsraum und gleichzeitig der Schlafraum für Hertha, die Köchin und Haushälterin der Ehrenfrieds. An der Rückseite des Hauses ein kleiner Garten, um den sich Lore mit Hingabe kümmerte. Ehrenfried hatte sich diesen Wohlstand hart erarbeitet. Und genau deshalb war er oftmals entnervt und verärgert, wenn Landauer zu hohen jüdischen Feiertagen, etwa zu Pessach, Rosh ha-Schana oder Jom Kippur einen Tag frei haben wollte, weil er seinem Glauben nach nicht arbeiten könne – oder, da war sich Ehrenfried niemals ganz sicher, einfach nicht wollte. Ob Landauer nicht wollte oder nicht konnte, dieser Unterschied war Ehrenfried letztlich egal, weil die Wirkung im Betrieb die gleiche war. Landauer war viel öfter außerhalb der Firma als Glasow und Windschild, die höchstens zu Weihnachten einmal nach einem zusätzlichen freien Tag fragten.
Ehrenfried machte Landauer nicht selten Vorwürfe. „Was interessiert es unsere Kunden in Dresden, in München, in Amsterdam, in Wien oder Sydney“, hatte er ihm noch im vergangenen Jahr beim Neujahrsfest vorgehalten, „ob du die Thora lesen oder beten musst?“ Landauer war für Ehrenfried eine stete und ungewollte Erinnerung daran, wo er selber herkam. Und Simon Cohn polterte manchmal: „Landauer ist ein aus dem Zeitrahmen gefallener Moses.“ Auch Ehrenfried hätte ihm das gerne oft gesagt, aber er wollte ihn nicht zu sehr kränken. Landauer war labil und sehr empfindlich. Außerdem war er ein guter Zwischenmeister und vertrat mit größter Sachkunde eine lange Familientradition von jüdischen Schneidern. Jetzt also stand Landauer in seinen ausgewaschenen Hosen vor Ehrenfried und rauchte. Das Rauchen war wohl seine einzige schlechte Angewohnheit, die er zuhause nicht ausleben durfte. Er hatte fast etwas Messianisches an sich.
„Herr Ehrenfried“, fing er sehr bedachtsam an zu reden, flüsterte fast und vermied aus Respekt vor Ehrenfried sogar jeden Anflug von jiddisch oder Berliner Dialekt, „meine Familie und ich werden in einigen Monaten nach England auswandern. Wir haben bereits unsere Papiere aus London bekommen. Ich kann nicht mehr lange für Sie arbeiten.“ Und dann, gleich nachsetzend: „Bitte behalten Sie das aber für sich, und sagen Sie niemandem etwas davon, vor allem nicht hier in der Werkstatt.“ Landauer blickte Ehrenfried nun ziemlich unsicher an. Beide hatten, seit Landauer vor vier Jahren begonnen hatte, für die Firma zu arbeiten, nur sehr selten private Worte miteinander gewechselt.
Einmal allerdings hatte Ehrenfried eher unfreiwillig gleich die ganze Familie Landauer kennen gelernt. Es war Mitte November 1933. Die Mutter von Landauers hochschwangerer Frau Irina rief völlig aufgeregt und fast atemlos in Ehrenfrieds Büro bei der Perschke an. Sie entschuldigte sich immer wieder für diesen Anruf. Im Hintergrund hörte die Perschke Kneipenlärm. Schließlich kam heraus, dass David jetzt sofort nach Hause kommen müsse. Sein drittes Kind würde heute noch zur Welt kommen, die Wehen hätten schon begonnen. So kam es, dass Ehrenfried sich großherzig bereit erklärte, Landauer sofort in seinem fast neuen Mercedes Benz 200 in die Schönhauser Allee 188 zu dessen Wohnung zu fahren.
Ehrenfried liebte es, seine Luxuslimousine zu steuern. Diese mächtige Maschine. Lore hatte ihn oft gebeten, einen Chauffeur zu engagieren. „Kurt“, so sagte sie, „wir können uns das doch leisten. Die anderen haben doch auch einen Chauffeur.“ Aber Ehrenfried wollte das nicht. „Es mag sein“, hatte er entgegnet, „dass Hitler den Staat lenkt. Aber meinen Wagen lenke ich immer noch selbst. Dafür brauche ich niemand anderen.“
Als Landauer in die Limousine einstig, bemerkte er einen missbilligenden Seitenblick Ehrenfrieds. Denn dem war der alte und abgetragene Wintermantel seines Zwischenmeisters aufgefallen. „Wohl vom Vater geerbt“, dachte Ehrenfried. „Furchtbar.“ Noch unangenehmer als diese verschmutzte Kleidung war für Ehrenfried der Anblick, als sich Landauer beim Verlassen der Zwischenmeisterei eine Kippa aufsetzte. Dann zündete er sich eine Zigarette an. Ehrenfried beschloss sofort, keinesfalls über den Hausvogteiplatz zu fahren. Nicht auszudenken, wenn ihn dort jemand aus der Konfektion sehen würde. Er, Ehrenfried, der Chef, chauffiert einen Kippatragenden Mann in einem abgewetzten Mantel. Die Fragen, ja die Missbilligungen, hätten vermutlich kein Ende genommen.
Im Wagen war es kalt. Die Heizung brauchte eine Weile, bis sie Wärme verströmte. Trotz der winterlichen Eiseskälte und des nun einsetzenden Schneefalls kurbelte Ehrenfried das Fahrerfenster hinunter. Lieber wollte er frieren, als den penetranten Zigarettengeruch ertragen zu müssen, den Landauers Kleidung ausdünstete. Ehrenfried beschloss, freundlich zu bleiben, aber das gelang ihm nicht ganz. Er ärgerte sich darüber, dass ein halber Arbeitstag nun so einfach verloren sein würde.
„Hat Ihre Frau denn noch nichts gemerkt, als Sie heute Morgen zur Arbeit gegangen sind?“, fragte er in fast vorwurfsvollem Ton.
„Eigentlich nicht“, antwortete Landauer. Jetzt verfiel er vor lauter Aufregung über die bevorstehende Geburt seines dritten Kindes doch ins Jiddische. Dieses osteuropäisch-jiddische Deutsch überwältigte Ehrenfried; einerseits dachte er an seinen Vater, und das wärmte ihm das Herz, andererseits drehte er seiner Herkunft lieber den Rücken zu und fühlte sich erst einmal als Deutscher und dann erst als Jude.
„Jetzt ist sie ein bisschen früher dran als geplant. Ich bin so aufgeregt! Aber bei den ersten beiden Kindern lief ja auch alles glatt. Außerdem ist Irinas Mutter seit ein paar Monaten bei uns. Die sorgt sich um alles. Die hat schon vielen Gören ins Leben geholfen. Und jetzt werden wir ja dann bald Chanukka mit unserer neuen Rebecca feiern.“ „Wieso Rebecca, woher wissen Sie denn, dass es ein Mädchen wird?“, entgegnete Ehrenfried erstaunt. „Weil die anderen Gören auch Mädchen sind“, erwiderte Landauer etwas rätselhaft und zündete sich schon wieder eine Zigarette an. Ehrenfried ließ das Fahrerfenster geöffnet.
Die Fahrt zur Schönhauser Allee führte über breite Kopfsteinpflasterstraßen in den Nordosten Berlins. Sie waren nur zum Teil vom Schnee geräumt. Immer wieder spritzte während der Fahrt Schneematsch auf. Ehrenfried begann, um seinen Mercedes Benz mit den schicken Weißwandreifen zu fürchten. Außerdem ärgerte er sich, dass Landauer seine Hilfsbereitschaft gar nicht wirklich zu würdigen wusste, sondern ihn über die Schönhauser Allee dirigierte, als befände sich Ehrenfried hier auf völlig unbekanntem Berliner Territorium. Je näher sie der Hausnummer 188 kamen, desto deutlicher hatte Ehrenfried das Gefühl, sich immer mehr von Landauer und seiner großherzigen Hilfe zu entfernen. Hier reihte sich jetzt Wohnblock an Wohnblock: graue, schrecklich aussehende Häuser. Als Ehrenfried den kleinen Turm auf dem Dach des S-Bahnhofs Schönhauser Allee erkannte, waren sie nur noch drei Minuten von Landauers Wohnung entfernt. Ehrenfried versuchte, unmittelbar vor dem Haus mit der Nummer 188 zu parken. Doch weil auf den Bürgersteigen Schnee aufgehäuft war, fuhr er in eine Toreinfahrt und stoppte dort. Landauer öffnete eilig die Wagentür, wollte offenbar sofort zu seiner Wohnung laufen, besann sich dann und wartete, bis Ehrenfried das Fahrerfenster hochgekurbelt hatte, ausgestiegen war und die Türen abschloss. Der nahm jetzt die schwere und drückende Luft der Kohleheizungen wahr. Er folgte Landauer durch den Hofeingang und dann noch durch zwei weitere Höfe, bis der eine Tür im vierten Hinterhof, nämlich die Tür zum Gartenhaus, aufschloss.
Читать дальше