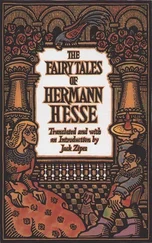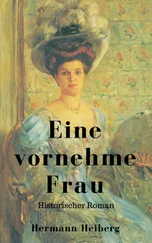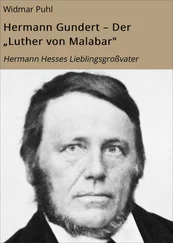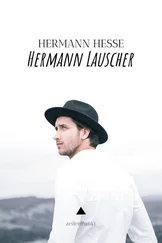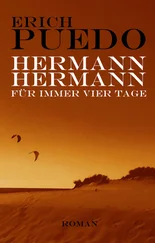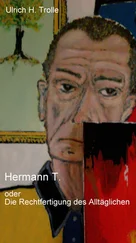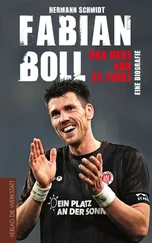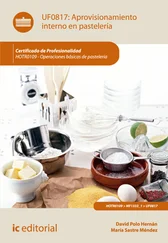„Also ein Impingementsyndrom.“
„Genau. Es hieß, das müsse operiert werden, weil bei mir durch eine Formvariante des Schulterdaches von vornherein der darunter liegende Raum verschmälert sei. Die Supraspinatussehne sei bereits hochgradig degeneriert.“
„Und, ist schon operiert worden?“
„Nein. Bei der präoperativen Vorbereitung zeigte sich im EKG und der nachfolgenden Myokardszintigraphie eine Minderdurchblutung des Herzmuskels, obwohl ich bis zu diesem Zeitpunkt niemals Beschwerden gehabt hatte. Es wurde ein Herzkatheter geschoben. Dabei stellten sich erhebliche Verengungen an drei Herzkranzgefäßen dar. Man setzte mir zwei Stents ein. Doch die brachten nichts, weil das Gefäß aufgespalten war und sich die Stents nicht voll entfalten konnten.“
„Ja, das kann vorkommen. Man nennt das Gefäßdissektion.“
„Nach diesem Eingriff ging es mir schlechter denn je. Aus dem orthopädischen Patient war ein kardiologischer Patient geworden. Bereits bei geringsten körperlichen Belastungen wurde ich kurzluftig. Eine zweite Herzkatheteruntersuchung nach einem Monat zeigte eine Verschlimmerung der Gefäßverschlüsse. Jetzt würde nur noch eine Bypassoperation helfen, sagte mir der Herzchirurg.“
„Und, haben Sie die machen lassen?“
„Ja, einen Monat später. Seitdem bin ich körperlich wieder voll leistungsfähig. Schweres Heben und Tragen geht aber immer noch nicht, obwohl die Operation schon vier Monate her ist. Ich habe Schmerzen im Brustbein. Das haben sie mir bei der Operation durchtrennt. Die Drähte liegen noch. Dadurch kann ich auch die krankengymnastischen Übungen für meine rechte Schulter nicht richtig durchführen.“
„Sie haben Ihr rechtes Bein nachgezogen, als Sie bei mir rein gekommen sind.“
„Ja, seit der Herzoperation bestehen bei mir starke Bewegungsschmerzen im rechten Hüftgelenk. Der Orthopäde redet von Umformungen des Gelenkkopfes. Das sei ein Arthrosevorstadium. Ohne Schmerzmittel kann ich kaum laufen.“
„Das gibt es häufig, dass die Schwere des Röntgenbefundes nicht mit dem Ausmaß der Gelenkbeschwerden übereinstimmt. Summa summarum liegt bei Ihnen Berufsunfähigkeit vor. Mit der Coxarthrose, dem Impingementsyndrom und dem Morbus Dupuytren können Sie Ihren Beruf als Landwirt auf nicht absehbare Zeit nicht mehr ausüben. Es steht in den Sternen, ob eine Schulteroperation und ein künstliches Hüftgelenk hier Abhilfe schaffen können. Leider kann ich Ihnen keine bessere Botschaft übermitteln.“
„Ich habe mir so was schon gedacht. Was bedeutet das dann für mich?“, fragte Lohner.
„Das bedeutet, dass Sie Ihr Krankentagegeld noch drei Monate lang bekommen. Und dann werden Sie bei der Kasse ausgesteuert. Wie viel kriegen Sie denn?“
„Ich bekomme fünfzehn Euro pro Tag. Das reicht weder zum leben noch zum sterben.“
Kahler hatte gerne in der Klinik gearbeitet, als Assistenzarzt. Als Patient war er noch nie im Krankenhaus gewesen. Jetzt war es so weit, er hatte einen Termin in der Urologie. Die Perspektive veränderte sich radikal. Er wurde vom Handelnden zum Behandelten. Dabei lernt man einige Dinge neu, z. B. Geduld, Demut und Vertrauen in das Tun anderer. Man lernt auch eine Menge neue Leute kennen, denen man Sachen erzählt, die man normalerweise niemals preisgeben würde, z. B. beantwortet man die Frage nach dem Zeitpunkt des letzten Geschlechtsverkehr oder nach der Dicke des Urinstrahls.
Wenn Kahler seinen Klinikaufenthalt rekapitulierte, dann standen zwei Sachen im Vordergrund. Das eine war die Farbe seines Urins als sensibler Indikator für den Zustand seines Epithels in den ableitenden Harnwegen, und das andere waren die Menschen, die dafür sorgten, dass sich Dunkelrot in Hellgelb verwandelte. Diese Klinikmitarbeiter sind Menschen wie du und ich. Vielleicht bestand bei dem einen oder anderen das Bedürfnis, anderen helfen zu wollen. Dieses Motiv findet man aber auch in anderen Berufsfeldern.
In der Anmeldung zur urologischen Abteilung, einem fensterlosen und nur spärlich beleuchteten Raum saß eine Dicke und bewachte die Formulare. „Sie dürfen jetzt reinkommen“, sagte sie.
Dieses Sie dürfen begleitete Kahler bei allen persönlichen Kontakten mit dem Klinikpersonal. Ausgenommen die Ärzte, die bevorzugten eine andere Diktion. Sie sagten einfach würden Sie bitte mal oder so ähnlich. Die Schwestern und Labormäuse gaben sich mit ihrem Dürfen den Anstrich der Servicefreundlichkeit, artikulierten aber das glatte Gegenteil. Sie dürfen bedeutet, ich erlaube dir etwas zu tun. In der Klinik aber ist doch sicherlich gemeint, ich würde mich freuen, wenn du das jetzt machst.
„Sie dürfen jetzt reinkommen“, schallte das Echo in Kahlers Kopf. Sei nicht so pingelig, sagte er sich, die weiß es nicht anders. Kahler setzte sich behutsam auf den Stuhl. Er spürte den Dauerkatheter in seiner Harnröhre. Er reichte seine Versicherungskarte rüber. Die Dame war wahrhaft mächtig. Sie hantierte im Halbdunkel mit einem Wust von Papieren. Dann gab sie Kahlers Personendaten ins System ein. Der Drucker spuckte einen Bogen mit selbstklebenden Minietiketten aus. Die Etiketten zupfte sie sehr routiniert vom Papier ab und pflasterte damit ihren linken Unterarm. Der verschwand fast vollständig hinter dem Schilderwald. Hier hat die Arbeit die Arbeiterin gefunden, dachte sich Kahler. Nur ein derartig mächtiger Körper mit einer Armoberfläche, groß wie eine Pinwand, ist in der Lage, eine solche Dokumentationstechnik umzusetzen. Wie bei einer Etikettiermaschine flogen dann die kleinen Schildchen auf die Formulare. Als alle Papiere gekennzeichnet waren, stauchte sie den Stapel und schob ihn über den Tisch. „Wo ein Kreuz ist, bitte unterschreiben.“
Mit Wohlgefallen sah Kahler, dass Titel und Name vollständig und korrekt wiedergegeben waren: Prof. Dr. P. H. Kahler stand da. Er legte zwar keinen übersteigerten Wert auf die akademischen Würden, freute sich aber, wenn sie doch zumindest wahrgenommen wurden. Kahler unterschrieb blind diverse Einverständnis- und Garantieerklärungen. Das konnte man unmöglich in der gebotenen Kürze der Zeit alles durchlesen. Es ging wohl in erster Linie um die Kostenerstattung.
Die nächste Station war die Erhebung der Eingangsanamnese. Ein Jungkollege, der eine noch jüngere Ärztin im Praktikum im Schlepptau hatte, übernahm diese Aufgabe. Kahler log, dass sich die Balken bogen.
„Rauchen Sie?“—„Och, gelegentlich, maximal fünf am Tag.“
„Und wie steht es mit Alkohol?“—„Ein Glas Wein zum guten Essen, vielleicht auch zwei.“
„Was ist mit Sport?“—„Na klar, regelmäßig.“—„Und was machen Sie da?“—„Ich spiele Golf.“—„Oh.“
Kahler ärgerte sich, dass er das mit dem Golf rausgelassen hatte, der hierzulande weniger als Sportart und mehr als Bewegungsart wahrgenommen wird. Bei der nachfolgenden Sonographie—das war jetzt bereits die vierte innerhalb von zwei Wochen—meinte Kahler, dass es ihm der Jungmediziner heimzahlen würde, seine schnöselige Golfaffinität. Der steckt mir mehr als einen Finger in den Arsch. So fühlte sich die Untersuchung an. Und nach getaner Arbeit ließ er Kahler mit dicken Schichten von Sonographiegel am Bauch und in der Kimme einfach so liegen. „Sie dürfen sich dann wieder anziehen“, sagte er und outete sich als Mitglied der unteren Servicekaste.
Kahler fand eine Kleenexrolle und versuchte, mit dem Papier das Gel loszuwerden. Bei seinen hektischen Wischbewegungen schien es aber so, als wenn das glibberige Zeug immer mehr werden würde. Es war jetzt überall. Frustriert zog er sich die Hosen hoch und hatte in der nächsten Zeit das Gefühl, unter sich gelassen zu haben.
Die Ambulanzschwester drückte ihm einen Stapel Formulare in die Hand und forderte ihn auf, sich auf Station anzumelden. Die befände sich in der zweiten Etage. Prompt erwischte Kahler den falschen Fahrstuhl. Auch die moderneren Krankenhausbauten haben eine unergründliche Logistik und Topographie. Schließlich fand er sie aber doch, die urologische Station, sein Zuhause für voraussichtlich sieben Tage. In einer Art Slalomlauf um die auf dem Gang geparkten Betten erreichte er die Stationszentrale. Er traf dort eine Schwester, die ihre etwas reservierte Haltung ab dem Zeitpunkt änderte, als sie Kahlers Status als Privatpatient erkannte.
Читать дальше