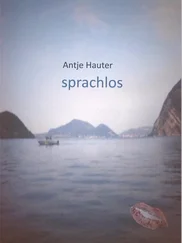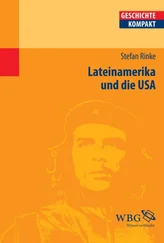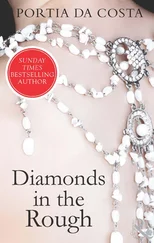Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Puntarenas
4. Kapitel Inhalt Vorwort 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel Puntarenas 4. Kapitel Jacó 5. Kapitel 6. Kapitel Manuel Antonio 7. Kapitel Tamarindo 8. Kapitel San Isidro de El General 9. Kapitel Monteverde 10. Kapitel 11. Kapitel Puerto Viejo 12. Kapitel Chirripó 13. Kapitel 14. Kapitel 15. Kapitel Impressum
Jacó
5. Kapitel
6. Kapitel
Manuel Antonio
7. Kapitel
Tamarindo
8. Kapitel
San Isidro de El General
9. Kapitel
Monteverde
10. Kapitel
11. Kapitel
Puerto Viejo
12. Kapitel
Chirripó
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Impressum
Seit Beginn meines Fotografiestudiums führe ich einen Blog, den ich zur Präsentation meiner aktuellen Hochschulprojekte nutze. Naheliegend, dort von meiner Zeit im Auslandssemester zu berichten.
- Mein Blog war ein virtueller Raum, in dem ich meine Geschichten in Form von Fotografien ausstellte.
Bald stand ich auf dem Campus der Universidad de Costa Rica; unter blauem Himmel, zwischen Palmen und kunterbunten Gebäuden, saß im Sprachkurs, erlernte eine fremde Sprache mit allen dazugehörigen Höhen und Tiefen und lernte in dem fremden Universitätssystem zu funktionieren. Gleichzeitig wohnte ich bei einer costa-ricanischen Familie, aß täglich Reis mit Bohnen, kämpfte mit dem Visum und reiste durch verschiedene tropische Klimazonen. Fotos reichten nicht mehr aus, um meine neuen Erfahrungen zu teilen.
- Mein Blog wurde ein virtueller Raum, in dem ich meine Bilder in Form von Texten und Fotografien erzählte.
Ich lernte viele Austauschstudenten kennen, die sich ebenfalls trauten und das anstrengende, aber vor allen Dingen großartige Semester bestritten. Alle waren nach ihrer Auslandszeit reicher als vorher.
Auslandssemester - müsste, sollte, könnte oder möchte das nicht jeder erleben? Denn wollen wir nicht alle reich werden? ... oder einen Berg besteigen?
- Aus einzelnen Szenen meines virtuellen Raums wurde dieses Buch. Die Bilder darin verweisen auf Textpassagen und die Zahlen am Text zurück auf die Bilder.
Viel Spaß bei der Lesereise!
Manuela
In den Bergen der Cordillera de Talamanca, oberhalb der Baumgrenze auf fast viertausend Metern Höhe, erstreckt sich ein Flickenteppich aus wuchtigen Steinen und gelbgrünen Gräsern. Sie ragen aus den Gesteinsschichten empor und trotzen dem pfeifenden Wind. Hier rauscht eine Böe nach der anderen um die Gipfel und breitet sich auf jeder Anhöhe aus, bevor sie sich auf der anderen Seite des höchsten Punktes Costa Ricas, vereint mit trübem Nebel und Eiskristallen, wieder durch den Regenwald zum Ozean hinabstürzt.
„Wir sind gleich oben!“, rufe ich Clémence über die Schulter zu. Ich setze einen Wanderschuh vor den anderen und versuche die schmerzenden Blasen an den Zehen, die schon gestern dick geschwollen waren, zu ignorieren. Mein rechtes Bein zittert vor Erschöpfung. Hätte ich doch nur keine Jeans angezogen, ärgere ich mich, eine Leggins mit Shorts, wie ich sie beim Tanzen manchmal trage, wäre viel bequemer gewesen. Mein Blick wandert zum Gipfel, der sich östlich von mir befinden müsste.
„Endspurt! Ab jetzt steigt jeder in seiner Geschwindigkeit auf“, hatten wir abgesprochen und Sekunden später war Matthias in den Nebelbergen verschwunden. Er legt mit seinen langen Beinen ein flottes Tempo vor.
Um mein Gleichgewicht zu halten, kralle ich mich am tiefschwarzen Felsvorsprung fest, darüber verliert sich mein Weg in den Wolken. Ich halte inne, hauche eine Rauchwolke vor mir in die kalte Nachtluft und ziehe meinen Sommerschal tiefer ins Gesicht.
„Da oben kann man beide Ozeane sehen, Pazifik und Atlantik! Es lohnt sich! Aber es ist eiskalt, zieht euch bloß warm an!“, hatten uns die Ticos, wie die Bewohner Costa Ricas sich nennen, in San José gewarnt. Ich bin dankbar, dass ich zumindest halbwegs auf sie gehört habe und mehrere Schichten Sommerkleidung und die von meiner Kommilitonin María José geliehene Regenjacke übereinander trage. Aber obwohl ich mich wie ein Michelin Männchen fühle, friere ich.
„Manuela…“, keucht es aus der Dunkelheit, „sind wir richtig? … kann nicht mehr …“. Der Nebel lässt mich die Gestalt meiner französischen Mitbewohnerin und Begleiterin erahnen.
„Si se puede!“ motiviere ich sie, schaue wieder nach vorne und stapfe weiter. Meine Haare peitschen mir ins Gesicht und bleiben auf meinen Wangen kleben. Bloß nicht vom Wind zurück gedrückt werden, den glitschigen Halt im Geröll verlieren und abrutschen. Keinen Fehler machen!
Ich bändige meine langen braunen Strähnen zu einem festen Zopf. Dann greife ich in meine Jackentasche und fische nach Proviant, bis ich neben meinem Handy in einer Tüte fünf Erdnüsse und zwei Rosinen finde. Während ich inne halte und schwer atmend kaue, werfe ich einen Blick zurück.
„Clémence?“, frage ich ins Nichts, esse die letzte Nuss und warte einige Sekunden, „kommst du?“
Stille. Ich bin alleine, alleine in der Natur. Alleine an einem Ort in fast viertausend Metern Höhe, von dem ich vor vier Monaten, im Januar, noch nie gehört hatte. An dem niemand ist, auch keine Verantwortung, Sprache, Pflicht oder Rettung.
Er hupt zweimal laut, dann rast er mit Vollgas über die Kreuzung. Er scheint keine Acht auf die anderen Taxen und Monster-LKW zu geben, deren farbige Stahlkarosserien im Sonnenlicht glänzen. Die knallgelbe Ampel, die an einem über die Straße gespannten Drahtseil baumelt, war gerade erst auf rot umgeschlagen. Ich werde abrupt in den Sitz gedrückt.
„Nicht… links abbiegen?“, weise ich den Fahrer des signalroten PKWs irritiert an, schließlich kenne ich den Weg. Er scheint sich ertappt zu fühlen und biegt an der nächsten Kreuzung ab. Entspannter lehne ich mich wieder zurück und suche vergeblich den Anschnallgurt und dessen Steckplatz in der Sitzreihe. Im Rückspiegel sehe ich den Fahrer, der meine Suche belächelnd verfolgt, sodass ich aufgebe, um mich nicht weiter als Tourist zu enttarnen. Wir brausen durch kleine Straßen, nehmen eine scharfe Linkskurve, die überwuchert ist mit verflochtenen Büschen, sodass kein Lichtstrahl hindurch kommt. Wir scheinen Kreise in der Hauptstadt zu drehen und sie nicht zu verlassen. Fast immer stehen Häuser am Straßenrand, in deren Vorgärten Laubbäume oder Sträucher über die in allen Farben bemalten Gitter und Mauern ragen. Nach zehn Minuten rasanter Fahrt stoppt er endlich.
„Viertausendfünfhundert Colones“, raunt er nach hinten und streckt mir seine Hand entgegen, um das Geld in Empfang zu nehmen. Angeblich sind wir mit dem Taximeter namens ‚María‘ zu meiner neuen Vermieterin gefahren, doch ich kann kein Gerät entdecken.
Ich zögere, das sind fast sechs Euro fünfzig und laut Juan, dem hilfsbereiten Hostelmitarbeiter, dürfte die Fahrt maximal drei Euro kosten. Mir fallen die spanischen Wörter zum Diskutieren nicht ein, deshalb gebe ich nach und zahle den Wucher. Immerhin, der stämmige Fahrer wuchtet mein dreiundzwanzig Kilogramm schweres Koffermonster aus dem Wagen, als ich aus dem leuchtenden Taxi steige, und stellt es vor der Haustür ab. Dann steigt er wieder ein und braust in einer Staubwolke davon.
Das ist mein neues Zuhause für die nächsten fünf Monate!
Mein Blick fällt auf die große weiße Mauer, auf der sich ein dreißig Zentimeter hoher Stacheldraht windet. Während ich den kleinen Knopf der Klingel drücke, lasse ich meinen Blick über die vergitterten Nachbarhäuser und die einsame Straße schweifen. Ob es hier wirklich so sicher ist?
Читать дальше