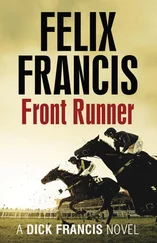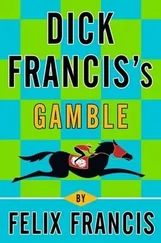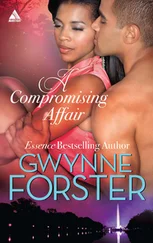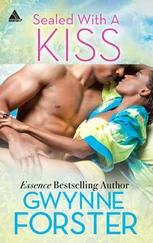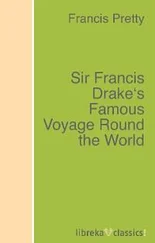»Nun gut. Sechs Jahre geht der Bub bei mir in die Lehre, dann sehen wir weiter.«
Er spuckte sich in die schwielige Pranke, hielt sie meiner Großmutter hin, und sie schlug ein.
»Er steht nun unter deiner Obhut, Esau«, sagte sie mit steifer Miene. »Jetzt bist du in der Pflicht. Behandle ihn gut oder tritt ihn. Aber achte auf ihn, und sieh zu, dass aus ihm etwas Gescheites wird!«
Sie ging davon, ohne mich noch einmal anzusehen. Ich stand allein mit dem Meister vor dem Tor.
Der Oktober neigte sich dem Ende zu, und an den Bäumen hing das letzte bunte Laub, als des Schreiners Heim auch zu meinem wurde.
Ein wenig unbeholfen strich er mir durchs Haar.
»Komm mit, Junge! Ich zeig dir deinen Platz.«
*
II
Mein Platz war in der Kammer neben der Küche. Der kleine Raum war im Sommer angenehm kühl und im Winter wegen des Ofens hinter der Wand immer mollig warm. Im Herbst wurde die Matratze mit frischem Stroh und das Kissen mit neuen Federn gestopft. Es war ein guter Platz, auch wenn die Kammer so eng war, dass kaum das schmale Bett hinein passte. Mehr brauchte ich nicht. Bei Tag arbeitete ich in der Werkstatt, gegessen wurde gemeinsam mit der Familie in der Küche, und zum Schlafen zog ich mich in mein kleines Himmelreich zurück. Jeden Abend gab es einen großen Kanten Brot, ausreichend Schmalz mit Schweinespeck und immer eine kräftige Suppe.
Trotz seiner strengen Miene war Meister Esau ein ruhiger und gutmütiger Mann, der seine Töchter über alles liebte. Von Natur aus groß und breitschultrig, ging er doch meist gebeugt, so als drückte ihn ein Kummer, was, wie mir Ida einmal erzählen sollte, mit dem frühen Tod seiner Frau zusammen hing. Ich habe den Meister selten lachen hören, doch wenn wir zum Nachtmahl in der Küche um den Tisch saßen und er seine drei Töchter betrachtete, dann strich oft ein Lächeln über sein Gesicht – ein schwermütiges Lächeln allerdings, in das sich die Trauer über seinen Verlust mischte. Elena-Maria, Katharina-Maria und Ida-Maria mussten jede auf ihre Weise ein Abbild der toten Mutter sein, denn anders als der Vater waren sie zierlich, anmutig und großäugig. Jeden Tag gleich dreifach an sein Unglück erinnert zu werden, jeden Tag aufs Neue, schien mir ein hartes Los für diesen Mann zu sein, was seine Liebe zu ihnen jedoch keinesfalls minderte, sondern ihr im Gegenteil eine besondere Innigkeit verlieh. Er behütete die Mädchen wie seinen Augapfel, und abends, wenn sie in ihren Betten lagen und schliefen, zog er die große Standuhr in der Küche auf, und von meinem Lager nebenan hörte ich ihn dabei mit dem Lieben Gott reden; dass dieser die Güte besitzen möge, seine Töchter auf allen Wegen zu begleiten, sie zu beschützen und alles Leid von ihnen fern zu halten.
So nachsichtig der Meister mit mir war, so sehr forderte mein eigener Eifer mir alles ab, was ich geben konnte und oftmals gar mehr. Beinahe verbissen stürzte ich mich auf jede Arbeit, die Meister Esau mir zuwies und sog alles, was er mir sagte, zeigte und beibrachte, begierig in mich auf.
Abends fiel ich erschöpft, aber froh in mein Bett und war bereits eingeschlafen, bevor auch nur ein einziger Gedanke in meinem Kopf zu Ende gedacht werden konnte. Tagsüber schwang ich den Besen, kehrte Holzspäne zusammen, schichtete Bretter, lernte Raubank, Falzhobel und Ziehklinge zu unterscheiden. Mit dem Fuchsschwanz hatte ich daheim schon oft gearbeitet, Fein- und Gratsäge jedoch waren mir neu. Nicht lange, und ich durfte Geißfuß, Fäustel und Stechbeitel an minderwertigen Reststücken ausprobieren, um die Eigenheiten der vielen unterschiedlichen Holzarten zu erfassen. Die Kiefer war sanft und nachgiebig, weich und federnd, freundlich und unterwürfig. Die Birke roch aromatisch. Die Eiche widersetzte sich nur vordergründig und wollte eigentlich genommen werden. Bei der Kirsche musste man mit fester Hand vorgehen, sonst entzog sie sich dem Griff und ging ihren eigenen Weg.
«Holz lebt, und jedem noch so kleinen Stück wohnt ein wenig von der Seele des Baumes inne. Finde die Seele, und du kannst mit dem Holz machen, was immer du möchtest«, lehrte Meister Esau mich.
Manchmal schnitt ich mich oder rutschte mit der Feile ab und rieb mir die Fingerkuppen blutig. Einmal sägte ich mir so tief in den Daumen, dass Elena mir einen Verband aus Leinen anlegen musste.
Der Meister lachte darüber nur. »Das gehört dazu«, meinte er. »Sonst begreifst du es nicht recht.«
Zum Glück verheilten die kleinen Wunden immer schnell, und mit jedem Tag wurden meine Finger geschickter im Umgang mit den Werkzeugen und dem Material. Irgendwann tischlerte ich meinen ersten Schemel, ein unscheinbares Möbel aus einer runden Holzscheibe und drei gedrechselten Füßen – einfach und ohne Schnörkel. Dann einen Hocker mit verzapften Querstreben, später eine Kassette, eine Schmuckschatulle und, als ich besser wurde, sogar ein Schränkchen, das mit einfach geschmiedeten Beschlägen versehen war und bald einen Käufer fand, was mich stolz machte.
Dank meiner guten Auffassungsgabe begriff ich schnell, worauf es ankam, verstand, welche Öle die Oberflächen zum Leuchten bringen konnten, erkannte, welche Pasten aus Wurzeln und Wachs die Holzstruktur am besten hervor hoben. Man musste mir eine Sache nur einmal zeigen, schon sah ich, was zu tun war und konnte so den Meister bei seiner Arbeit entlasten.
Dem Meister wiederum gefielen mein Eifer und meine Wissbegier. Ganz offensichtlich fand er Gefallen daran, mich zu unterrichten und mir die vielen kleinen Geheimnisse der Tischlereikunst zu verraten. Diese ungewohnte Aufgabe vertrieb seine dunklen Gedanken, und des Morgens begann er das Tagewerk mit zunehmender Freude. Die alte Lust an der schöpferischen Tätigkeit war wieder erwacht, die Qualität seiner Arbeiten gewann stetig, was sich herumzusprechen begann, und so kamen nach wenigen Wochen selbst aus weiter abgelegenen Dörfern neue Kunden.
Meister Esau war sehr zufrieden mit mir, und ich glaube, er fing an, mich als den Sohn zu sehen, den er nur wenige Stunden gehabt hatte, und der kurz nach der Nottaufe gestorben war.
»Gute Arbeit, Junge«, brummte er oft.
»Danke, Meister«, sagte ich mit dem Lächeln, von dem ich wusste, dass er es sich von seinem Sohn gewünscht hätte, und tatsächlich nannte er mich eines Abends versehentlich »Albert« statt »Adam« und schien seinen Fehler nicht einmal zu bemerken.
So verging Monat für Monat. Sechs Tage in der Woche arbeitete ich hart. Sonntags nach der Messe lernte ich weiterhin mit den anderen Kindern aus dem Dorf Lesen und Schreiben bei Fräulein Rinker.
Nach der Sonntagsschule besuchte ich den Hof meiner Großmutter, brachte mal einen Schinken, mal einen Laib Brot als Aufmerksamkeit vom Meister mit. Meinen Vater traf ich selten an, und meine Großmutter murmelte auf meine Frage nach ihm irgendetwas von einer »Dirne« und wischte das Thema damit beiseite.
In den späten Nachmittagsstunden machte ich mich dann wieder auf den Weg zur Schreinerei, die ich mittlerweile als mein eigentliches Zuhause betrachtete.
Der Winter kam und ging, und mit ihm zogen Weihnachten, mein Geburtstag und das Dreikönigsfest vorbei. Von der ungeliebten Fastenzeit, die in Großmutters Haus streng eingehalten worden war und die ich gehasst hatte, war in der Schreinerei wenig zu spüren.
»Was soll das für ein Handwerker sein, der sich nicht ordentlich stärken darf?«, war des Meisters Ansicht, der ansonsten ein frommer Mann war und dem lieben Gott selbst den Verlust seiner geliebten Frau nicht zum Vorwurf machen wollte.
Mir tat das gut, und schon im Mai war ich ein gutes Stück gewachsen, und ich war größer und kräftiger als noch wenige Monate zuvor.
Das Leben in der Schreinerei gefiel mir. Die Werktage hatten ihren festen Rhythmus aus Arbeit und Schlaf, die Sonntage, mit ihren Predigten in der Kirche und dem Schweinebraten auf dem Tisch, rahmten die Wochen, die ins Land zogen. Die Fastenzeit endete mit dem Osterfest, der Sommer mit den ersten Herbststürmen, und in der Weihnachtszeit zog der Duft von Zimt und Sternanis durch die Schreinerei.
Читать дальше