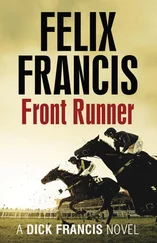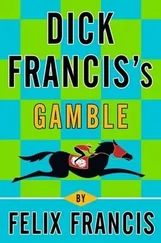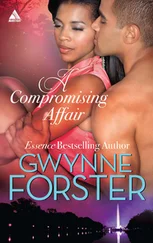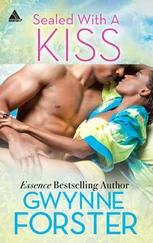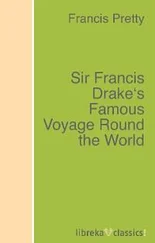Im Gegenlicht dauerte es ein paar Sekunden, bis ich die Gestalt, die dort im Hof stand und wüste Beschimpfungen ausstieß, erkannte. Es war mein Vater. Ganz offensichtlich hatte er getrunken, denn er schwankte heftig und schien sich nur mühsam auf den Beinen halten zu können. Jetzt torkelte er ein paar Schritte auf uns zu.
Ich hatte ihn längere Zeit nicht gesehen, und was ich jetzt im fahlen Schein der Abendsonne sah, widerte mich an. Das Haar war ungeschnitten und fettig, sein Bart hatte begonnen zu verfilzen. Die Kleider waren fleckig und auf der Brust, ich war mir sicher, klebten die angetrockneten Reste von Erbrochenem. In der gesunden Hand hielt er eine fast leere Flasche Wein, während er den vernarbten Stumpen wild in unsere Richtung schüttelte, was seinem Auftritt etwas Lächerliches und Groteskes verlieh.
Es fällt mir nicht schwer, zuzugeben, dass ich mich in diesem Moment für den dreckigen, heruntergekommenen Haufen Elend, der uns lallend anfeindete, zutiefst schämte.
»Elendiger Viehdieb!« schrie er. »Das war mein Vieh, du Scheißkerl, mein Vieh, das du mit deinen dreckigen Fingern geklaut hast!«, und immer wieder »Elender Bastard!« und sogar »Du Sohn eines feigen Bastards und einer dreckigen Hure!«
Ich spürte, wie brennender Zorn in mir aufstieg, doch der Meister bemühte sich gelassen zu bleiben und legte mir eine Hand auf die Schulter.
»Nimm dich zurück, Johannes, du weiß nicht, was du da redest!«
Aber mein Vater war nicht zu beruhigen. Der Wein in seinem Blut tat seine Wirkung und trieb ihn zur Rage. Abfällig spuckte er uns vor die Füße. »Er ist ein dreckiger Bastard, von einer dreckigen Hure in die Welt geschissen!«
»Du gehst wirklich zu weit mit deinen unflätigen Beschimpfungen!«
»Ich sage, wie es ist. Ein verdammter Hurensohn ist er, nichts anderes!«
Er beleidigte mich und meine tote Mutter gleichermaßen, und da seine Worte mich tief trafen, ja demütigten, wünschte ich mir in diesem Augenblick, dass er Recht haben möge, und dass ich in der Tat nicht sein Sohn wäre.
»Du bist betrunken, Johannes.«
Ich kannte den Meister mittlerweile recht gut, und obwohl er versuchte, beschwichtigend auf meinen Vater einzureden, war seinem Ton der unterdrückte Ärger anzuhören. »Du solltest jetzt besser nach Hause gehen und deinen Rausch ausschlafen! Morgen bringen wir dir dein Vieh, wenn dir soviel daran liegt.«
»Und wenn ich betrunken bin – ja und? Ich weiß genau, was ich rede! Viehdieb, Bastard! Belogen habt ihr mich. Belogen und bestohlen!«
Er verzog den Mund, seine Lippen begannen zu zittern, und unversehens fing mein Vater an zu greinen wie ein kleines Kind. Schluchzend taumelte er ein paar Schritte rückwärts, dann stolperte er und stürzte, die Flasche hielt er fest im Griff. Beim Aufstehen stützte der Krüppel sich auf den Armstumpf, den er sich dabei blutig schürfte, doch die Weinflasche mochte er nicht loslassen.
»Behaltet doch das Scheißvieh, ich will es gar nicht« heulte er. »Ich will es nicht. Und dich will ich nie wieder auf meinem Hof sehen!«
Er zeigte mit dem Finger auf mich und schwenkte die Flasche dabei so ruckartig in meine Richtung, dass der Wein heraus schwappte, und obwohl er einige Meter entfernt stand, trafen mich ein paar blutrote Spritzer auf die Brust.
»Verfluchter Bastard. Fahr zur Hölle!«
Er torkelte endlich davon.
Wir sahen ihm nach, stumm und hilflos, dann ging ich ins Haus zurück. Ich spürte die Blicke von Meister Esau, Katharina, Ida und Martha auf mir ruhen, traurig, verlegen und beschämt.
Mit den Strahlen der untergehenden Sonne traf mich hinterrücks ein letztes jähzorniges »Bastard!«
Ja ...
Der Teufel hatte um meine Hand angehalten, und ich hatte sie ausgeschlagen!
*
IV
Montag, 16. Mai 1881
Das Haus erwacht.
Die vertrauten Zeichen von Betriebsamkeit künden den neuen Tag an; bekannte Geräusche, wie das dezente Klirren von Porzellan, das vorsichtig aufgetragen wird, oder das simmernde Pfeifen eines Wasserkessels, kurz bevor er vom Herd genommen wird.
Pantoffeln huschen bemüht leise über die Marmorstufen und verharren vor meinem Zimmer. Das Mädchen klopft an die Tür; ich bitte es herein.
»Haben Sie gut geschlafen?«
Ich bejahe und strecke mich. In Wahrheit habe ich so gut wie gar nicht geschlafen.
»Das freut mich«, sagt sie und legt frische Wäsche auf einem der Sessel ab. Sie zieht die Vorhänge zurück; der Morgenhimmel zeigt sich in dunstigem Blau.
»Es scheint ein sonniger Tag zu werden.«
Im Hinausgehen wirft sie einen Blick auf das zerwühlte Bett.
Phillip hat die letzte Nacht hier bei mir verbracht. Lange vor Sonnenaufgang ist er aufgestanden und hat sich hinaus geschlichen. Um diese Zeit hat er schon die ersten Brote aus dem Ofen gezogen.
Natürlich weiß sie es, denke ich und überlege, ob sie mit ihren Freundinnen, ihren Schwestern, ihrer Mutter darüber tratscht. Über den Mann, der von Zeit zu Zeit bei mir nächtigt. Über das verwirrte Geschöpf, das ein paar Türen weiter im ständigen Halbdunkel vor sich hindämmert. Über mich.
Soll sie nur.
Es kümmert mich nicht.
*
V
Mit dem folgenden Winter kroch nicht nur die Kälte unter meine Bettdecke. Auch Katharina hatte diesen Weg gefunden.
Ich hatte kein Interesse an dem Mädchen, doch die wohlige Wärme ihres Körpers tat gut, ihre weichen Brüste unter ihrem Nachtkleid fühlten sich angenehm zart an. In den ersten kalten Wochen passierte zunächst nichts, wir lagen still nebeneinander, genossen einfach die Anwesenheit des anderen und verhielten uns ansonsten sittsam. Natürlich sollte es nicht dabei bleiben.
Katharina war nicht so schön wie Elena, nicht so geschmeidig. Ihre Bewegungen waren weniger fordernd, ihren Küssen fehlte es an Sehnsucht, die nach Erfüllung verlangte. Vielmehr schmiegte sie sich an meinen Körper wie ein schnurrendes Kätzchen an den warmen Kachelofen, um Frost und Einsamkeit zu vertreiben. Auf dem Feld der Möglichkeiten standen wir beide hilflos herum, ackerten nicht, zupften kein Unkraut. Aber wir säten.
Und die Saat fiel auf fruchtbaren Boden.
Katharina-Maria war schlank, fast knabenhaft. Niemand dachte sich etwas dabei, als ihre Brüste praller wurden, als ihre Rundungen zunahmen. Katharina aß mehr als sonst, und ihre Wangen wurden rosiger. In ihrem Blick lag ein ungewohnter Glanz. Man hielt es wohl für die übliche Entwicklung eines Mädchens ihres Alters. So blieb die Schwangerschaft unentdeckt – von allen im Haus, sogar von ihr und mir.
Zumindest eine Zeit lang.
Es war Martha, die Katharina und mich eines Abends zur Seite nahm.
»Was denkt ihr euch? Lange könnt ihr das nicht geheim halten«, zischte sie.
»Was geht es dich an? Das ist unsere Sache«, gab ich grob zurück. Ich glaubte, dass sie auf Katharinas nächtliche Besuche bei mir anspielte.
»Eure Sache, ach ja? Ist es das? In ein paar Wochen wird das ganze Dorf Bescheid wissen!«
Ich fuhr sie an: »Wenn du deinen Mund hältst, wird niemand etwas erfahren.«
»Du denkst, ich ginge tratschen? Das brauche ich gar nicht! Ich habe neun jüngere Geschwister und die letzten fünf Schwangerschaften meiner Mutter habe ich mit offenen Augen und klarem Verstand miterlebt. Und ich bin nicht die einzige im Dorf, die Augen im Kopf hat. In spätestens drei Wochen sieht auch der Dümmste, was Sache ist.«
Mir fuhr der Schreck in die Glieder. Während ich verstanden hatte, wovon Martha da sprach, blieb Katharina gefangen in ihrer unbedarften Kindlichkeit.
»Was meinst du?«
»Ich rede von dem Bündel, das da unter deinem Herzen heranwächst.«
Jetzt begriff auch sie. Ich sah, wie Katharina alles Blut aus dem Gesicht wich. Sie fasste sich an die Brust. Ihr Mund ging langsam auf und wieder zu. Ihre Lider flatterten, dann brach sie ohnmächtig zusammen.
Читать дальше