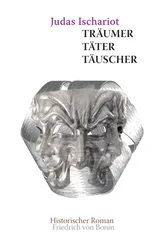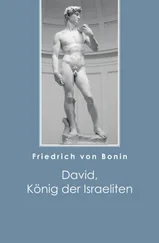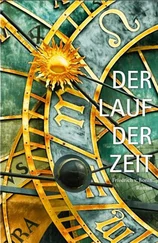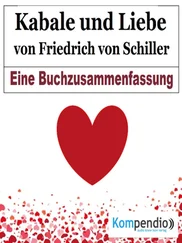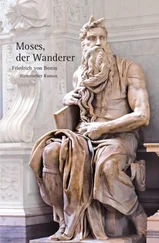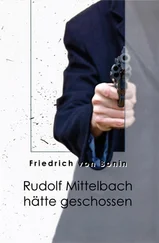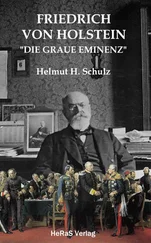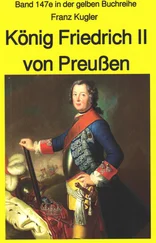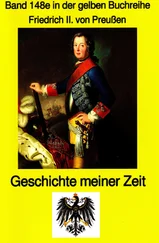„Wenigstens hier, im inneren Lager, scheint einigermaßen Ordnung zu herrschen“, antwortete er.
Und schließlich langten wir im Zentrum des Lagers an. Ein kleines Dorf hatte man aufgebaut, die Unterkunft des Generals war deutlich zu erkennen, sie überragte alle anderen und schien groß genug, um Besprechungen mit Offizieren durchzuführen. Rund herum waren andere Zelte errichtet, offenbar größere für die höheren Offiziere, kleinere für uns, die wir Kammerdiener und Schreiber des Generals waren. Am Rande stand eine kleine Hütte, die man mir später als das Klosett der Offiziere benannte, das wir ebenfalls zu benutzen hatten.
Ich teilte mein Zelt mit dem Kammerdiener und kaum hatten wir es nur besichtigt, kam schon ein Bote.
„Schreiber Rheidt, zum Generalissimus befohlen“, rief er durch den offen stehenden Vorhang und ich konnte noch Jean bitten, auf mein Gepäck zu achten, da führte er mich schon zum General.
„Na, hat der Herr eine gute Reise gehabt?“, fragte er, und ich kannte ihn kaum wieder.
Sein Gesicht, sonst blass, war gerötet, die Augen blitzten, offenbar hatten ihm die Reise und der Anblick seines Heeres gutgetan.
„Ich hoffe, der Herr ist nicht zu durchgeschüttelt, um zu schreiben“, scherzte er, „ich habe den Befehl für den morgigen Tag zu diktieren. Setze sich der Herr und schreibe.“
Und Wallenstein diktierte mir seine Befehle für morgen. Die gesamte Armee hatte sich um sieben Uhr zum Abmarsch bereit zu machen. Es ging nach Norden, ins Deutsche Reich, so befahl er, gegen die Protestanten, gegen die Dänen, und die Soldaten, die ihren Sold von Wallenstein im Unterschied zu den anderen Heerführern, regelmäßig bekommen hatten, jubelten.
5.
Der dänische König Christian führte die protestantischen Waffen mit seiner Armee an, unterstützt von Christian von Braunschweig und dem Grafen von Mansfeld, einem Abenteurer, der mit einem von England und den Generalstaaten unterstützten Heer in die Kämpfe eingegriffen hatte.
Knapp eine Woche nach dem Aufbruch in Nordböhmen vereinte sich unsere Armee mit den Truppen des Grafen Tilly, der unter dem Befehl des bayerischen Kurfürsten Maximilian in Norddeutschland gegen die Protestanten kämpfte.
General Tilly hielt die Weser, während wir uns an der Elbe festgesetzt hatten. Der Stab des dänischen Königs war in Wolfenbüttel, er hatte Festungen in Minden, Northeim und Göttingen und ließ seine Armee bis tief nach Hessen streifen, Nahrung und Beute suchen, plündern, sengen und vergewaltigen. Niemand hielt sich freiwillig mehr in den Dörfern auf, im ganzen Herrschaftsbereich des dänischen Königs waren die Menschen auf der Flucht, hungernd, frierend, zitternd vor Furcht.
Wallenstein hatte sich im späten Herbst westlich der Elbe niedergelassen und seine Truppen, ebenso wie unser Verbündeter Tilly und die feindlichen Protestanten, in das Winterlager geschickt. Er hatte vorher einen Brückenkopf zu dem östlichen Ufer der Elbe gebildet, den er den ganzen Winter hindurch hielt. Es gab nur noch wenige Kampfhandlungen in diesem Jahr, nur Mansfeld beunruhigte immer wieder unsere Truppen östlich der Elbe, immer wieder griff er sie an, zog sich aber sofort wieder zurück. So verging der Winter.
Das änderte sich schlagartig mit der ersten Schneeschmelze des nächsten Jahres. Mansfeld drang nun energisch vor, unseren vorgeschobenen Posten an der Elbe zurückzudrängen, Wallenstein setzte, den Brückenkopf nutzend, so schnell wie möglich über den Strom. Es entwickelte sich eine wütende Schlacht, in der tausende von Soldaten starben. Wallenstein siegte, Mansfeld war geschlagen und auf der Flucht.
„Wir haben einen großartigen Sieg errungen“, musste ich an den Kaiser schreiben, „einen Sieg, von dem sich der Mansfeld auf Jahre hinaus nicht wird erholen können.“
Aus den Antworten des Kaisers wurde deutlich, dass auch andere ihn von der Schlacht unterrichtet hatten.
„Wir können nicht verstehen“, schrieb der Kaiser, „warum man den Mansfeld nicht verfolgt und bis auf den letzten Mann aufgerieben hat. Der Mansfeld hat uns große Ungemach bereitet, es wäre wünschenswert gewesen, ihn zu verfolgen und zu töten.“
Der Kaiser habe leicht reden, brummte Wallenstein, als ich ihm diesen Brief vorlas. Ich war mittlerweile zu seinem Vertrauten geworden. Der Kaiser habe ja für die Armee auch kein Goldstück dazugegeben. Er, Wallenstein, müsse noch sehen, wie er seine Leute ernähre.
Der Fürst hatte mich den Befehl schreiben lassen, es sei seinen Truppen die Plünderung streng verboten, wer dabei entdeckt würde, habe mit seiner Erschießung zu rechnen. Stattdessen forderte er nach seinem Ermessen Steuern ein von den Ländern, durch die er zog. Die Beute der Plünderungen wäre seinen Soldaten zugute gekommen, die Steuern flossen in seine Kasse.
6.
„Der Mansfeld ist östlich der Elbe nach Süden aufgebrochen. Er hat eine neue Armee aufgestellt, sich mit dem Herzog von Weimar verbündet und zieht nun zur Oder, von dort nach Schlesien und nach Mähren und Ungarn, wo er sich mit Gabriel Bethlen vereinigen will, um den Kaiser anzugreifen.“ Das war die Nachricht, die im Juli dieses Jahres meinen Herrn schlaflose Nächte kostete.
Er müsse sofort ebenfalls nach Süden aufbrechen, um den Kaiser und sein Wien zu schützen, sagte er in der Beratung der Generale.
Das könne er nicht, hielten die anderen dagegen, er sei bei Tilly im Wort, den dänischen König bis in sein Land zu verfolgen und ihn dort zu schlagen.
„Was hilft es, wenn wir den dänischen König besiegen und Mansfeld, Weimar und Bethlen erobern Wien?“ Wallenstein war ein ruhiger, vornehmer Herr, aber die Sorge und die Ungewissheit, was richtig sei, machten ihn zornig und aggressiv.
„Und wir werden doch nach Süden marschieren“, vertraute er mir an, der ich ihn schweigend unterstützte. Ich verstand seine Sorge: Wenn die Protestanten nach Süden zogen, bedrohten sie nicht nur Wien und den Kaiser, sondern auch und vor allem das Herzogtum Friedland. Daran wollte Wallenstein sie hindern und sie verfolgen.
Mitte August überschritten wir die Elbe unterhalb des Mündungsgebietes der Elster, Wallenstein hatte Marschbefehl gegeben, und zwar nach Süden, trotz der wütenden Protestschreiben Tillys, Maximilians von Bayern und des Kaisers.
Mansfeld und Weimar waren uns drei Wochen voraus. Wir kamen zehn Tage nach Überschreiten der Elbe an die Oder, auf deren anderer Seite Mansfeld passiert war.
„Der Krieg finanziert den Krieg“, war immer wieder die Maxime des Generalissimus auf die bangen Fragen seiner Generale, wie er denn seine gut zwanzigtausend Mann auf dem Marsch nach Süden, bis nach Mähren und Ungarn ernähren wolle. Und sie bekamen sehr schnell eine Lehrstunde, wie diese Finanzierung lief.
„Ich habe vom Kaiser die Erlaubnis erbeten, fünfzigtausend Mann auszuheben“, erklärte mir Wallenstein, „damit ich zwanzigtausend haben konnte. Mit weniger Truppen wäre ich nicht in der Lage, sie zu finanzieren. Aus eigenen Mitteln hätte ich das für zwei Monate gekonnt, mit der Hilfe des Bankiers de Witte ein Jahr, danach wäre die Armee aufgelöst worden. Aber der Herr hatte Recht, zwanzigtausend Mann sind eine Macht, die in der Lage ist, Kontributionen einzutreiben. Der Krieg finanziert eben den Krieg, wie der Herr gesagt hat.“
Wo immer wir auf unserem Marsch auf ein Dorf oder eine Stadt trafen, sandte Wallenstein eine Abordnung voraus, die als Steuer entweder die gesamte Jahresernte forderte oder den entsprechenden Betrag in Geld, damit er seine Truppen ernähren und ausrüsten konnte. In den meisten Fällen öffneten die ängstlichen Bürger ihre Scheunen und Schatzkammern und gaben, was er verlangte. In einigen Städten allerdings regte sich Widerstand.
„Wir werden ihm weder unsere Ernte noch unsere Schätze ausliefern“; ließen sie antworten.
Читать дальше