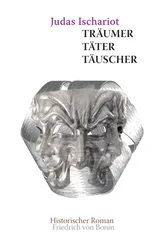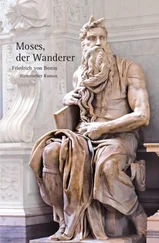Ein Lächeln huschte über das sonst immer ernste Gesicht des Generals.
„Der Herr meint, wir tragen Krieg in die feindlichen Länder, die den Krieg dann bezahlen müssen?“
„Genauso.“
Für diesmal entließ er mich, aber nach einer Woche unterbrach er sein Diktat, sah mich scharf an und sagte:
„Woher kommt der Herr?“
Ich stellte mich unwissend.
„Wieso?“
„Der Herr hat mir davon gesprochen, dass der Krieg den Krieg finanziere. Die Idee ist neu und nicht alltäglich, hat der Herr sich das selbst ausgedacht?“
Ich wich der eigentlichen Frage aus.
„Haben Fürstliche Gnaden den Erfolg bei dem de Witte gehabt?“
„Ich habe mit de Witte gesprochen. Mein Kredit bei ihm ist nun unbegrenzt, weil er von seinen Banken freie Hand bekommen hat. Die Idee des Herrn hat den Geldleuten gut gefallen. Hat der Herr gut gemacht.“
Ich verbeugte mich schweigend. Das Wort „der Krieg finanziert den Krieg“ wurde fortan bei Wallenstein und seinen Generalen zum stehenden Spruch.
Am Ende dieses Sommers war die Werbung beendet, der General hatte vierzehn Regimenter unter seiner Fahne versammelt, dazu fünf aus Böhmen und weitere zehn, die dem General vom Kaiser übergeben worden waren, insgesamt etwas über zwanzigtausend Mann, zu Fuß und zu Pferd.
3.
Den ganzen nächsten Sommer über bis zur Abreise meines Herrn aus Prag hatte ich alle Hände voll zu tun und kaum Zeit, mich um meine Umgebung zu kümmern. Einzig zu dem Kammerdiener des Generals, Jean, einem älteren und würdigen Mann, hatte ich Kontakt. Wir saßen manchmal abends, wenn der Fürst uns nicht brauchte, in seinem kargen Zimmerchen zusammen, das er in dem Palais Wallenstein bewohnte. Er rief mich dann und fragte, ob ich ihm nicht ein bisschen Gesellschaft leisten wolle. Immer nahm er bei diesen Gelegenheiten eine Flasche des Weines aus dem Regal, der von den Gütern unseres Herrn stammte, und wir tranken den schweren weißen Tokaier, immer mäßig.
Jean war aus einer bürgerlichen Prager Familie, die in die Religionswirren geraten und aus der Stadt verbannt worden war. Einzig er, der dritte Sohn, war in Prag geblieben und hatte sich schon in jungen Jahren dem Herzog von Friedland angedient, als der diesen Titel noch gar nicht hatte. Jean hatte den Aufstieg seines Herrn miterlebt, der mit der reichen Heirat begonnen und nun mit seiner Ernennung zum kaiserlichen Oberbefehlshaber seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte.
„Aber einen besseren Herrn kann ich mir nicht vorstellen“; sagte er ruhig und ich betrachtete ihn. Er sah mit seinen weißen Haaren und dem sorgfältig gestutzten Vollbart aus wie der Inbegriff eines Dieners, ein Eindruck, der durch die grauweiß gestreifte Weste und die schwarze Hose noch betont wurde. Viel erzählte er mir von dem Leben in Prag vor dem großen Krieg, der mit dem Sturz kaiserlicher Diplomaten aus der Prager Burg begonnen hatte.
„Aber Krieg war schon vorher“, sagte er mit seinem ruhigen tiefen Bass, „schon bevor wir die unverschämten kaiserlichen Abgeordneten aus dem Fenster geworfen haben, schikanierten uns die Kaiserlichen, wo sie konnten.“
„Uns?“, fragte ich beiläufig.
„Ja, damals gehörte ich zu ihnen, wie alle anständigen Böhmen, schon von meiner Familie her, aber inzwischen bin ich nicht mehr interessiert. Ich habe mich beim General beworben und ihm meine Vergangenheit geschildert. Sie war ihm gleichgültig ebenso wie meine Religion, ich brauchte auch nicht zu konvertieren. Ich glaube, dem General sind Gottesfragen vollkommen egal, er glaubt an nichts als an seinen Erfolg.
Aber so habe ich bei ihm eine Arbeit, die ich gerne tue und bei der mich keiner nach meinem Glauben fragt. Das reicht mir.“
Oft saßen wir zusammen und immer wieder erzählte er mir von seinem Leben. Mir war er als Gesprächspartner lieb, weil er gerne redete und mich nicht nach meiner Vergangenheit fragte.
4.
„Der Herr wird mit mir reisen müssen, wenn er weiter für mich arbeiten will“, eröffnete mir der General im Herbst, „ich reise morgen früh ab und es wäre mir lieb, wenn der Herr mich als mein Schreiber begleiten würde. Auch im Felde wird es viel zu schreiben geben. Der Herr ist doch ungebunden?“
Wieder fasst er mich scharf ins Auge, als wolle er in mein Herz sehen. Ahnte er etwas von mir und meiner Existenz? Wieder wich ich aus.
„Aber werden Eure Fürstliche Gnaden denn die Reise aushalten können?“, fragte ich besorgt.
Eine düstere Wolke zog über sein Gesicht. Seit Anfang der letzten Woche hatte seine Krankheit ihn zu plagen begonnen. Jean hatte mir erzählt, dass sie ihn lähme, er sei dann schlecht gelaunt, könne sich kaum bewegen und schließe sich die meiste Zeit ein. Tatsächlich hatte ich in der letzten Woche wenig zu tun gehabt. Wallenstein war in seinen Gemächern geblieben und hatte niemanden um sich haben wollen als nur Jean und Seni, seinen Diener und den italienischen Leibarzt und Astrologen.
Heute Morgen aber hatte er mich sehr früh rufen lassen und mir eröffnet, dass er zur Armee abreisen und mich mitnehmen wolle.
„Es wird gehen müssen. Der Herr sieht ja, dass ich wieder aufstehen konnte, und die Sterne mögen mir helfen, jetzt werde ich ein, zwei Jahre Ruhe haben von dieser verfluchten Krankheit.“
Tatsächlich, so hatte Jean erzählt, suchte ihn die Lähmung in diesen Abständen heim.
Am nächsten Morgen zogen hunderte Kutschen aus dem Palais Wallenstein und aus der Stadt heraus nach Norden, wo die Regimenter lagerten und der Ankunft ihres Oberbefehlshabers harrten. Ich war mit meinem kleinen Gepäck in der dritten Kutsche untergekommen. Er hatte mich in seiner Nähe, wenn auch nicht in seinem Wagen haben wollen, damit, wie er sagte, er mich jederzeit finden und rufen könne. Wir zogen in Eilmärschen, begleitet von zwei Regimentern Reiterei, die uns an der Stadtgrenze erwarteten und erreichten nach zwei Tagen das riesige Gelände, auf dem Wallensteins Heer lagerte.
Ein ausgedehntes Lager war das, wir brauchten drei Stunden, bis wir die für uns reservierten Unterkünfte erreichten und hatten noch Glück, dass unsere Reiter uns den Weg bahnten. Durch den Tross kämpften wir uns, wo Essstände ihren Gestank nach altem Fett und gebratenem Fleisch verbreiteten, sahen an diesen Ständen reihenweise die Soldaten warten, bis sie ihre Ration kaufen konnten. Unrat lag zu Haufen um diese Stände herum, alle warfen weg, was sie nicht essen konnten oder wollten. Hunde stritten sich unter großem Gejaule um die Reste, Ratten wuselten zwischen ihnen umher, um das zu ergattern, was die Hunde ihnen überließen. Direkt daneben passierten wir die Bordelle, Zelte, vor denen Frauen saßen, Dürre, Fette, Alte, Junge, und immer wieder sahen wir, wie ein Soldat mit einer im Zelt verschwand. Jean, der neben mir im Wagen saß, wandte sich angeekelt ab.
„Ja, Jean“, lachte ich und tat erfahren, „auch das ist der Krieg, er ist nicht besonders appetitlich, schon bevor er angefangen hat, wie?“ Ich lachte, als ich sah, wie er seine Augen schloss und sich in die Wagenecke lehnte. Nach den Huren wurde es soldatischer. Hier saßen zehn Reiter mit ihrem Wachtmeister um ein Feuer herum, sie sangen, ich konnte es hören, zotige Texte oder auch Kriegslieder. Immer weiter rollten wir, manchmal durch einen Pulk Soldaten aufgehalten, die neugierig in die Wagen stierten, um zu sehen, wer da durchs Lager fuhr, sich aber zerstreuten, wenn sie hörten, es sei der Generalissimus selbst, der da anreiste. Jetzt kamen wir an einer Pferdekoppel vorbei, dort herrschte eine unsägliche Unordnung, ich fragte mich, wie ein Reiter hier wohl sein Pferd wiederfinden wollte. Offenbar herrschte aber doch eine gewisse Ordnung, nur den Reitern verständlich, denn plötzlich sah ich, wie zwölf Männer auf den Korral zu gingen und sich zielsicher Tiere herausfingen, sie sattelten und hinausritten. „Bestimmt Wachen, deren Dienst beginnt“, sagte ich zu Jean, der die Augen wieder geöffnet hatte und neugierig durch die Scheiben sah.
Читать дальше