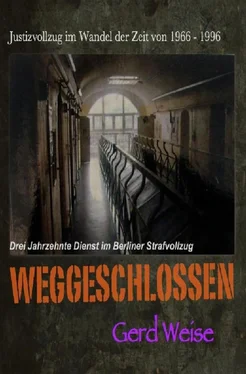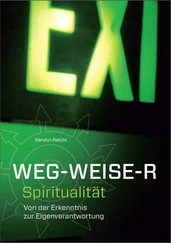Nachdem die Gefangenen meiner Station, die von der Freistunde kamen, wieder unter Verschluss waren, wollte ich zum Namensregister über der Zentrale gehen, welches von einem privilegierten Gefangenen geführt wurde, um die Zellennummer von Dräke zu erfahren. Ich kam nicht dazu, weil mir dieser bereits entgegen kam. Ich brachte ihn zu seiner Station 1 zurück, wo er schon vermisst wurde. Vor seiner Zelle sagte ich ihm unmissverständlich, dass er mich nicht „anquatschen" solle. Er sei hier Gefangener und ich Bediensteter. Unsere Kontakte könnten nur dienstlicher Natur sein. Dass wir uns von draußen kennen würden, sei unwichtig. Dräke wurde einsichtig und verhielt sich devot. Er bettelte mich vergeblich um Zigaretten oder Tabak an. Ich war damals Nichtraucher und nicht bereit, extra für ihn Rauchwaren zu kaufen. Wie ich ihn kannte, hätte dann die Bettelei kein Ende genommen. Ich empfahl ihm, sich besuchen zu lassen, wobei er sich einen Automateneinkauf für 5 DM im Sprechzentrum schenken lassen könnte. Dann schloss ich ihn ein. Dräke, der bereits fünf Vorstrafen aufzuweisen hatte, wegen Körperverletzung, Fahrens ohne Führerschein mit Alkohol im Blut und Verletzung der Unterhaltspflicht, hielt sich künftig zurück. Er wurde zwei Wochen später in den offenen Vollzug der JVA Düppel verlegt. Zwei Jahre später erfuhr ich, dass er im Alter von 31 Jahren verstorben war. Über die Todesursache habe ich nichts erfahren. Er hinterließ eine vierjährige Tochter, die bei der Mutter lebte und für die er nicht eine Mark Unterhalt gezahlt hatte.
Ich hatte mich verhältnismäßig schnell eingearbeitet und fühlte mich nicht vor Probleme gestellt. Bis auf das sehr frühe Aufstehen um 4.30 Uhr war meine neue Beschäftigung gut zu ertragen. Regelmäßige Freizeit konnte ich jedoch vergessen. Es gab zwar eine Dienstplangestaltung für jeweils einen Monat im Voraus, jedoch musste man immer wieder mit Änderungen rechnen, insbesondere wenn Kollegen erkrankten. Als neuer Kollege stand man ohnehin in der zweiten Reihe. Zwei Wochen Dienst ohne einen freien Tag war durchaus die Regel.
Ich machte mir damals doch so meine Gedanken, ob es denn richtig war, einen ganz neuen Kollegen, wie ich es war, schon nach einer Woche Einweisung eigenverantwortlich als Stationsbeamten einzusetzen. Ich hatte zwar eine gute Polizeiausbildung erfahren, doch der Polizeidienst ließ sich mit dem Aufsichtsdienst in einer Justizvollzugsanstalt nicht wirklich vergleichen. Hier wurde nach der Dienst- und Vollzugsordnung (DVollzO) verfahren, die ich zwar erhalten, aber noch nicht so ausführlich zur Kenntnis genommen hatte, dass ich in der Lage gewesen wäre, die vielen Vorschriften umfassend zu begreifen und ggf. umzusetzen. Erst Jahre später wurde diese Handhabung geändert und eine viel gründlichere und umfassendere Ausbildung für den allgemeinen Justizvollzugsdienst eingeführt.
Nach zwei Wochen ununterbrochenem Frühdienst, eigenverantwortlich auf der Station 4, bekam ich zwei Tage frei. Danach sollte ich mit anderen Kollegen zum Schießen nach Spandau fahren, damit ich dann auch zum Turmdienst eingeteilt werden konnte. Dies war eigentlich sehr früh, es war jedoch den Vorgesetzten bekannt, dass ich als ehemaliger Bereitschaftspolizist bereits gründlich im Schießen ausgebildet worden war. Ich freute mich darauf, weil ich gerne mit Schusswaffen umging und erhebliche Erfahrung hatte. Bei der Polizei hatte ich mit dem Karabiner 36, mit der Neunmillimeterpistole „Astra", mit dem leichten und dem schweren Maschinengewehr sowie mit der Maschinenpistole jeweils mehrmals im Jahr geschossen und stets die Bedingungen erfüllt. Auch beim „Labor Service“ wurden allgemein zweimal im Jahr mit einem halbautomatischen Sturmgewehr Schießübungen abgehalten.
In Spandau schossen wir mit dem „Natogewehr G 3“ zweimal jeweils zehn Schuss auf 100 und 200 Meter Entfernung. Mindestens sechs Schuss je Übung mussten im Ziel sein, was mir mühelos gelang. Am nächsten Tag fand das Pistolenschießen in einem Schießkeller der Polizei statt. Es wurde mit der Pistole „P 1“ aus 25 Metern aufgelegt und aus zehn Metern freihändig geschossen, jeweils fünf Schuss. Auch diese Schießübungen absolvierte ich erfolgreich.
Nach dem Schießen wurde ich zum Nachtdienst mit anschließendem Spätdienst eingeteilt. Der Nachtdienst war allgemein eine ruhige Angelegenheit, man musste am Tage nur genügend schlafen, um im Dienst, insbesondere auf dem Turm, wach zu bleiben. Der Dienst begann um 22.15 Uhr und endete um 6.15 Uhr, sieben Nächte hintereinander. Allgemein lösten wir schon zur vollen Stunde, um 22 und 6 Uhr ab. Wir hatten damals im Verwahrhaus II eine Belegung von über 1000 Gefangenen.
Der Nachtdienst bestand aus einem Schichtführer, zumeist einem Hauptwachmeister, und vier Bediensteten, die sich im Turmdienst abwechselten. Einer war immer auf dem Turm 5, sodass nur vier Kollegen ständig im Hause waren, bei der Turmablösung sogar nur drei. Wenn der Turm abgelöst wurde, ließ der oben befindliche Bedienstete außen einen Schlüssel an einer Schnur herunter, der Ablösende schloss auf und kam die steile Eisentreppe herauf. Der Abgelöste ging hinunter, schloss den Turm von außen wieder ab und hängte den Schlüssel an die Schnur. Dann ging er zurück ins Haus. In einem Halter stand das Gewehr mit einem Magazin, das zehn Schuss enthielt. Es war halbautomatisch, es lud also nach dem Schuss selbständig nach. Nachts dauerte der Turmdienst jeweils eine Stunde, am Tage zwei Stunden. Der Turm hatte ringsum große Schiebefenster, ein Feldtelefon und eine nicht sehr wirksame Heizung. An den kalten Tagen, wie jetzt im Januar, war es hier recht ungemütlich. Ich lief häufig auf der zweimal zwei Meter großen Fläche hin und her, um nicht zu frieren und um wach zu bleiben. Das Gewehr auf dem Turm war nicht die einzige Bewaffnung. Nach dem Einschluss um 18 Uhr wurden an den Spätdienst Pistolen ausgegeben, die zuvor vom Schichtführer von der Pforte geholt worden waren, wo sie in einem Panzerschrank lagerten. Die Pistolen wurden bei der Ablösung um 22.15 Uhr vorschriftsmäßig entspannt und gesichert, mit herausgenommenem Magazin, an den Nachtdienst übergeben.
Als ich um 3 Uhr vom Turm kam, sah ich, dass auf der Station 6 die Fahne geworfen worden war. Ich ging an die Zellentür, schaltete das Licht an und fragte den Gefangenen durch den Spion schauend, was er wolle. Er klagte über starke Bauchschmerzen und bat um ein Medikament. Ich sagte das dem Schichtführer, der den Sanitäter, der gerade im Zuchthaus war, benachrichtigte. Dieser kam dann auch und ging mit mir und einem zweiten Kollegen zur Zelle des betreffenden Gefangenen. Der Kollege hatte zuvor seinen Pistolengurt abgeschnallt und schloss die Zellentür auf. Ich stand zur Absicherung auf dem gegenüberliegenden Gang mit der Hand auf der Pistolentasche. Diese Methode wurde allgemein immer so angewandt, damit keine unliebsamen Überraschungen auftreten konnten. Der Sanitäter gab dem Gefangenen ein Zäpfchen. Es gab sehr viel ärztliche Medikamentenverordnungen für Gefangene, die von den Krankenpflegern zusammen mit einem Sanitätskalfaktor anhand einer Verordnungsliste nachmittags vor dem Einschluss verteilt wurden. Bei Medikamenten zur Beruhigung, zum Beispiel Valium, welches nur wenige Gefangene bekamen, wurde es dem Gefangenen regelrecht in den Mund geworfen und überprüft, ob er es wirklich geschluckt hatte. Es bestand nämlich die Gefahr, dass er das Valium sammelte, entweder um es in größerer Menge auf einmal einzunehmen oder an andere Gefangene gegen Tabak zu verkaufen, denn Tabak konnte man damals im Vollzug durchaus als Währung bezeichnen.
Weitere Meldungen durch Gefangene waren in dieser Nacht nicht zu verzeichnen. Um 6 Uhr machten wir in allen Zellen das Licht an, indem wir von Zelle zu Zelle gingen, den Lichtaußenschalter anknipsten und gleichzeitig beim Durchschauen feststellten, ob alle noch vorhanden waren. Nicht alle Bediensteten blickten in die Zelle, manche traten nämlich nur mit dem Stiefel gegen die Tür, um die Insassen aufzuwecken. Diese Methode war bei den Gefangenen nicht sehr beliebt und natürlich auch nicht der betreffende Bedienstete.
Читать дальше