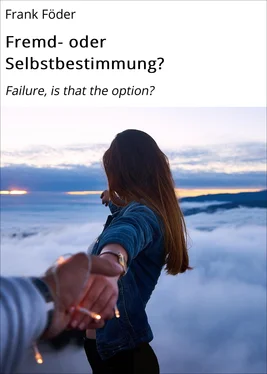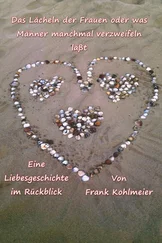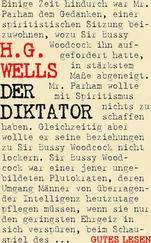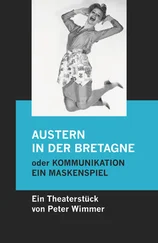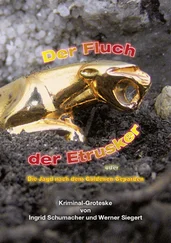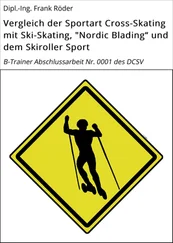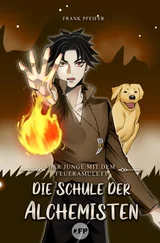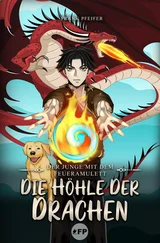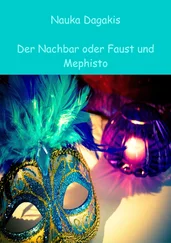1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Viele Staaten entbehren sowohl das eine als auch das andere. Noch sind bei vielen Völkern, die am Hungertuch nagen, Sanftmut und Duldsamkeit in erstaunlichem Ausmaß anzutreffen. Ihre Angehörigen nutzen vorerst die Flucht. Mehr und mehr aber wächst auch bei ihnen die Gewaltbereitschaft. Behelfsweise begnügen sich besonders Aufgebrachte vorerst mit Terroraktionen.
Die Regierungen der entwickelten Staaten haben die Wirtschaft und Finanzen ihrer Länder in unterschiedlichem Ausmaß in Unordnung gebracht. Dadurch sind einige Völker in echte Not geraten, während andere noch verhältnismäßig gut dastehen. Von diesen wird Hilfeleistung erwartet. Das jedoch stößt an Grenzen. Denn bei den Bessergestellten macht sich zunehmend Sorge um den eigenen Besitzstand breit. Es ist nicht Neid, eher Ausweglosigkeit auf der einen Seite und Angst vor dem Verlust des eigenen Fundus auf der anderen, was die Völker neuerdings gegeneinander aufbringt. Zu fürchten sind Verzweiflungshandlungen der Notleidenden.
Die Demokratie der Neuzeit, in die Zukunft transferiert, bringt Streitgründe nicht aus der Welt. Ernsthaft daher ist nicht zu erwarten, daß eintritt, worauf sich heute alle Anstrengung richtet, der demokratische Friede.
Die Angst vor Krieg verleitet heute viele Menschen zu dem Bemühen, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Sie treten politisch für globale Abrüstung ein.
Das Ansinnen der Friedensaktivisten ist der wehrlose Staat, der Adler ohne Krallen. Als ließe sich der Demokratie die Taube ins Wappen setzen.
Vielen anderen Pazifisten geht es lediglich darum, die Staaten dazu zu veranlassen, auf die schlimmsten ihrer Waffen zu verzichten. Die Atombomben sähen sie gern verschrottet. Vermeintlich schreibt die Vernunft vor, sich mit der Teilentwaffnung zu begnügen. Das Ganze, die vollständige Abrüstung, wird als Utopie erachtet – wohl nicht zu unrecht.
Einige Staaten gehen darauf sogar ein. Sie geben vor, ihren Bestand an Nuklearsprengköpfen zu verringern. Kein Staat jedoch, solange es noch andere gibt, kann auf die potenten Projektile vollständig verzichten, ohne Gefahr zu laufen, seine Abschreckungskraft einzubüßen. Der sich bescheidende Staat braucht einen verläßlichen Bündnispartner, der die hochwirksamen Raketen weiterhin parat hält. Andernfalls verlöre er nicht nur an politischem Gewicht, sondern riskierte auch seinen Bestand.
Die Friedensforschungsinstitute vermelden, daß noch nie so viel Geld für Rüstungsgüter ausgegeben worden ist, wie im Jahr 2011. In den Jahren darauf sind zwar etwas weniger Waffen gekauft worden, aber immer noch mehr als in den Jahren zuvor – und zwar hauptsächlich von Demokratien. Die USA haben 2016 eine BillionDollar allein für die Modernisierung ihrer Nuklearwaffen ausgegeben.
Ohnehin stellt sich die Frage, macht Reduzierung Sinn? Sollte man den Staaten ein paar Kämpfer und Kanonen lassen? Sollte man der Entsagung frönen: Ein bißchen Krieg darf sein, ein wenig Friede muß genügen?
Möglicherweise könnte die Nachwelt kleine Scharmützel aushalten. Die entscheidende Frage aber ist, ob die großen Demokratien angesichts der bleibenden Differenzen sich dauerhaft mit dem Unterhalten von ein paar Paraderegimentern bescheiden werden.
Und ob, wenn es hart auf hart kommt, die so leicht zu habenden und ebenso leicht zu versteckenden biologischen und chemischen Waffen in den Gängen und Garagen bleiben, ist eine der bängsten aller Fragen.
Ausgangspunktdieser Erörterung war, ob der Eigensinn des einzelnen Krieg und Zerstörung heraufbeschwört.
Ohne Zweifel gibt es Menschen, die dazu neigen, ihre Interessen mit Gewalt durchzudrücken. Wahrscheinlich sind in jedweder Gesellschaftsform Zeitgenossen zu vermuten, die ungehemmt ihrem Eigensinn frönen. Der Einzelne aber kann keinen Schaden anrichten, der das Ausmaß einer Weltkatastrophe hat (sofern er nicht gerade Chef einer Weltmacht ist). Er kann nicht die gesamte Menschheit in den Abgrund reißen.
Die Gefahr, der diese Zivilisation jetzt ausgesetzt ist, geht eindeutig nicht vom Wesen des normalen Menschen aus. Verschaffte die Demokratie dem von ihr nicht indoktrinierten Bürger wirklich das Sagen, wäre der Friede sicher nicht bedroht.
Jeder Staat, so auch jede Demokratie, muß auf einem Globus, dessen Vorräte schwinden, in außerordentlicher Weise um das Wohl seiner Bürger besorgt sein. Maßhalten und Zurückhaltung kann sich kein Staat leisten. Die moderne Demokratie steigert die Empfindsamkeit und Ansprucherhebung sogar gegenüber den Prätentionen vorangegangener Staatsformen erheblich. Gerade sie schafft aus ihrer Eigenart heraus Sachverhalte, die sich nur gewaltsam lösen lassen.
Die Erdbevölkerung, zu umfangreich für ihren ausgelaugten Planeten, muß dafür sorgen, daß Streit unterbleibt. Friede ist nötig, damit die Tötungsmaschinerie, über die sie verfügt, verschrottet werden kann. Mit den Staaten ist dies nicht zu machen. Dabei ist die Demokratie selbstsüchtiger als alle Herrschaftsordnungen vor ihr.
Der Krieg ist ein Phänomen, das den Staaten unabwendbar innewohnt. Er tritt mit ihnen in die Geschichte, und er wird sie, so viel ist sicher, nur mit ihnen verlassen.
Die inneren Zerwürfnisse, Bürgerkriege, wer/was führt sie herbei?
Den äußeren Frieden zu gewährleisten, ist der Einrichtung Staat nicht gegeben. Wie, so fragt sich, sieht es mit dem inneren Frieden aus? Zur Zeit erwächst die größte Not und die meiste Zerstörung aus Konflikten innerhalb der Staaten. Trägt daran die Gewaltneigung des einzelnen Schuld? Muß es darum gehen, ihn zu belehren, ihn zu erziehen?
Über die Entstehung der Staaten bietet der NewYorker Anthropologe Charles Spencer folgende Erklärung an: „ Wenn ein Häuptling mehr Land unterworfen hatte, als er an einem Tag durchschreiten konnte, zwang ihn dies, eine Verwaltung und damit staatliche Strukturen zu schaffen“.
Am Anfang unverkennbar steht Unterwerfung, nicht von Land, sondern von Leuten. Menschen haben sich untertan gemacht. Sie haben einem Herausgehobenen Gewalt über sich gegeben.
Nun sollte man annehmen, daß die Individuen, die das haben mit sich machen lassen, immerhin die Aufgabe ihrer Freiheit, sich einen Vorteil davon versprochen haben.
Wäre dies der Fall gewesen, hätte es der Wunsch, Mord und Totschlag nicht erleben zu müssen, nicht sein dürfen. Denn Krieg stand ihnen nun fortlaufend ins Haus. Nicht nur der mit Nachbarn. Zusätzlich entstand nunmehr im Inneren der Kampf um die Macht. Der forderte oft nicht weniger Blut und Tränen. Tod und Zerstörung gehörten von nun an zum Alltag. Das hat die neue Einrichtung ihren Untertanen rasch verdeutlicht.
Dennoch waren die neuen Staatsbürger anscheinend überwiegend zufrieden mit ihrem Dasein. Sie fanden sich mit dem fortlaufenden Kampfgeschehen ab. Dazu könnte eine Begebenheit beigetragen haben, die zu gleicher Zeit Bedeutung gewann: die Verknüpfung des sozialen Umfelds mit religiösen Vorstellungen. Die ersten Könige haben es augenfällig verstanden, ihr Herrschtum mit der obwaltenden Glaubensüberzeugung zu verquicken. Sie wußten sich als Bewahrer und Beschützer der tonangebenden Heilslehre darzulegen. Nicht selten gelang es ihnen sogar, sich als Inkarnation einer Gottheit ins Bild zu setzen.
Die neue Obrigkeit erfüllte ihr Konstrukt mit Geist. Sie verschmolz die Apparatur, die ihr Macht verlieh, mit einer religiösen Instanz. Sie formte ihr Gebilde zum Gehäuse der Gottheit. Die Krone ließ sie darlegen, als sei sie vom höchsten Gott verliehen („von Gottes Gnaden“, wie es später hieß). Der Bürger sollte in seinem Staatsoberhaupt die irdische Verkörperung des Willens seiner Gottheit sehen.
Diese Staatsidee hat vielerorts bis in die Neuzeit getragen. Sie erfuhr kürzlich eine beklemmende Übersteigerung im „Islamischen Staat“ (IS).
Читать дальше