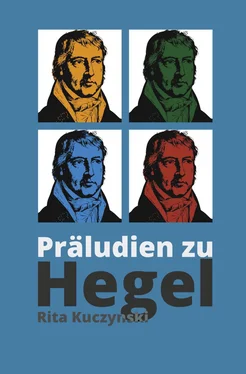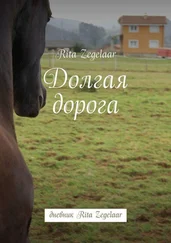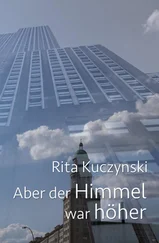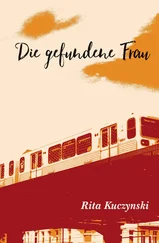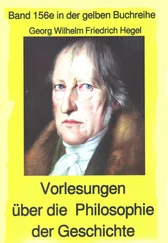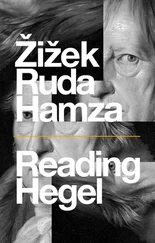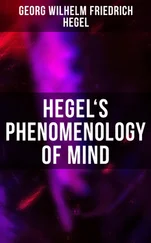Da jedoch in Deutschland – und erst recht im Tübinger Stift – zur entscheidenden Stunde Entscheidendes nicht zu machen war, jedenfalls nichts Sichtbares, nichts Praktisches für diese ganz neue Welt, die da geboren wurde, mühsam, verfolgte man die Ereignisse wenigstens in den Zeitungen, den deutschen und den französischen, und feierte mit jeder neuen Nachricht, die da kam von dieser Revolution, die Zukunft. Man formte Träume, Träume aus Licht – und den französischen Nachrichten. Natürlich waren es die Studenten, die nicht wußten, wohin mit ihrer Begeisterung, und so rannten sie zunächst einmal durch die Stadt. Sie suchten in den Straßen, in den Gasthäusern der Tübinger Umgebung nach Ideen, Gründen, Begründungen und Tatsachen für die neue Zeit, die da anzubrechen versprach – eine Zeit ohne Kompromisse und Unzulänglichkeiten – so hofften jedenfalls die Studenten und mit ihnen die meisten bürgerlichen Intellektuellen in Deutschland. Das »revolutionäre Treiben« der Stiftler aber sprach sich in der kleinen Stadt bald herum, so daß sich der Herzog veranlaßt sah, im Kloster zu erscheinen, um in landesväterlicher Liebe den Studenten zu sagen, daß er besorgt sei, da sich die Stiftler trotz aller väterlichen Fürsorge undankbar zeigten und »ihre Laufbahn nicht in der vorgeschriebenen Ordnung und Anständigkeit und mit dem gebührenden Fleiße fortsetzen«, zumal das künftige Wohl des Vaterlandes – seines Landes – und der Kirche – seiner Kirche – dadurch in eine Gefahr komme, die er abzuwenden gedenke. 1
Was aber ist vergeßlicher als Dankbarkeit, sollte man den Herzog fragen, insbesondere wenn man sie von Jugendlichen fordert. Ein Vorzug, den die Jugend besitzt, ist ja gerade der, daß ihr Lebensentwurf noch nicht endgültig festgeschrieben ist, daß ihre Möglichkeiten zu leben auch darin bestehen, gegen die vorgeschriebene Ordnung und Anständigkeit zu leben, eben weil diese Ordnung nicht die ihrige ist und es nicht unabänderlich werden muß. Doch was tun, wenn vorerst nichts Wesentliches, nichts Eingreifendes zu machen ist. Vielleicht – den Geist wachhalten. Das Gedächtnis trainieren. Vielleicht die Theorien, die diese Revolution vorbereiteten, noch einmal studieren, sich neu einlesen in die wichtigsten Sätze. Hören auf die Worte und Sätze, über die man vordem hinweggelesen hat. Überlegen, warum sie jetzt anders klingen. Danach vielleicht das Wesentliche und Unwesentliche an den Dingen neu bemessen und die Rangordnung des Wichtigen nochmals überprüfen. Vielleicht neben Sophokles und Platon, neben Rousseau, Schiller und Kants »Praktischer Vernunft« doch die »Reine Vernunft« lesen, schließlich diskutieren andere Stipendiaten das Buch von Kant schon einige Zeit. Vielleicht ist doch etwas an ihm, was Hegel jetzt besser verstehen kann.
Oder Locke und Hume lesen, sich ansehen, was Hume über den Zweifel zu sagen hat. Oder sollte er sich verlieben in die recht attraktive Tochter eines Theologieprofessors, die Auguste heißt. Er machte beides, sich verlieben und Kants »Kritik der reinen Vernunft« studieren, was eine recht vernünftige Relation werden konnte – zumal Fräulein Hegelmeier im Hause einer Weinstube wohnte, so daß Hegel seine gerade erst angenommene Gewohnheit, sich in Zweifelsfällen auch mit Wein und Bier zu besprechen, nicht unbedingt aufgeben mußte. Lange hält man nämlich die Liebe zur ganzen Menschheit nicht aus, wenn man nicht zugleich wahrnehmbar zu lieben vermag, fernab von aller Verstiegenheit und Abstraktion. Zu lange hält man es eben nicht durch, für die ganze Menschheit zu leben, zu leiden, zu hoffen, wenn nicht hin und wieder eine konkrete Person ins eigene Leben tritt, auf die man hoffen kann, eine, mit der man leben und leiden kann, fernab von allen platonischen Entzugserscheinungen. Und so hielt es Hegel dann auch: War das Motto des Sommers 1790 noch der Wein, so beschloß er, das Motto dieses Sommers wird das der Liebe sein. 2
Aber das reicht ja alles nicht, reicht nicht aus, reichte im Falle von Hegel tatsächlich nur für einen Sommer, bis er Enttäuschung registrieren und in Reflexion auf die Hegelmeier sich schon wieder fragen mußte: »Wo fließt mir rein des Lebens Strom?« 3
Was bloß machen, was nur tun?
Er beschloß, intensiver zu studieren. Ganz ohne Fleiß, ganz ohne Arbeit war ja das theologische Seminar nicht zu bewältigen. Und nach Wochen der Gewöhnung macht es ja dann auch Freude, der Lösung einer theoretischen Fragestellung näherzukommen.
Da sitzt man dann ganz ohne Zwang und merkt, daß im Zimmer am Schreibpult alles viel sicherer ist als auf der Straße, als auf dem Marktplatz oder gar in den Seminarräumen des Stifts. Daß man im Zimmer viel weniger diesen Erziehungsmaßnahmen ausgesetzt ist, die vom Einzelnen nicht selten als Anmaßung, wenn nicht gar als Misshandlungen gedeutet werden. 4Ärgerlich ist nur, daß man abends, allein mit sich, »alle Magisters- und Doktors-Titel, samt hochgelahrt und hochgeboren« zum Teufel wünscht. 5
Was also tun? Auf keinen Fall aufgeben, auf keinen Fall resignieren, sondern nach Wegen suchen, weitersuchen, zumal Frankreich der alten Welt gerade zeigt, daß auch anderes, Neueres möglich ist. Also weitersuchen. Weitergehen und mit Klugheit handeln. Das Maß nicht überschreiten, wodurch den Stiftlern jegliche Möglichkeit des Wirkens genommen würde. Weiterlernen. Sich anpassen. Sich durch Anpassen nicht anpassen. Sich nicht ganz entzweien mit der deutschen Wirklichkeit, um ihre völlige Entzweiung vorzubereiten. Den Anmaßungen dieser Wirklichkeit ausweichen. Im Ausweichen diese Wirklichkeit angreifen. Den Anmaßungen, der Knechtung zuvorkommen, indem man gegen Scheinknechtungen nicht protestiert. Die erste Anmaßung aushalten, nicht protestieren, um der zweiten desto sicherer entgehen zu können. Den Angriffen der Stiftsleitung zuvorkommen, indem man sie durch Pseudoangriffe zwingt, die Reihenfolge ihrer Erziehungsmaßnahmen zu ändern. Geduld üben, indem man sich ungeduldig, ja hastig gibt und damit die Nerven der Professoren für Unwichtiges überreizt, so daß letztlich sie zugeben müssen, ohne Geduld reagiert zu haben. Sie bei Bedarf ablenken, umlenken, sie auf Dinge aufmerksam machen, die nicht wesentlich sind. Auf jeden Fall die Balance halten, sich nicht jede Möglichkeit der tätigen Wirkung nehmen lassen. Also Aufwand und Nutzen gut berechnen. Klug sein, nicht sprechen – so wahr es auch sei – wenn man nicht sicher ist, daß ein Zweck dadurch erreicht wird. 6
Sich mit der alten Wirklichkeit nicht ganz entzweien. Auch dann, wenn diese Wirklichkeit hauptsächlich verachtenswert ist? Auch dann. Denn wem nutzt es, auf Barrikaden zu gehen, hinter denen nichts zu verteidigen ist. Was sollten Revolutionäre revolutionieren in einem Land, in dem keine revolutionäre Situation bestand, in dem das Bürgertum, soweit überhaupt vorhanden, in Kleinstaaten zersplittert, ohne den für die Bürger so notwendigen einheitlichen Markt existierte? Wie sollten sie ihren Willen, ihr Interesse artikulieren, ständig bedrängt und beengt durch die örtliche Fürstenherrschaft, von der sie doch abhängig waren. In Deutschland bestanden die Bürger als einheitliche Klasse noch gar nicht. In Kleinstaaten blieben ihre Möglichkeiten zur Entfaltung gering.
Aber die Studenten erwarteten etwas, und zwar mit wesentlich größerer Ungeduld als die Bürger in Deutschland. Sie hofften, daß die gewaltigen Veränderungen in Frankreich nicht ohne Auswirkungen auf Deutschland bleiben würden, daß alles nur eine Frage der Zeit sein werde. In ihrer Hoffnung wurden sie bestärkt durch den Verlauf des ersten Koalitionskrieges, vor allem durch den ersten Sieg der Franzosen bei Valmy über die Preußen. Denn soviel verstanden die Stipendiaten des Herzogs schon von Politik, daß sie wußten: Gewännen die Österreicher und Preußen diesen Krieg, würden schlimme Zeiten bevorstehen. »Der Mißbrauch fürstlicher Gewalt wird schröcklich werden … bete(t) für die Franzosen, die Verfechter der menschlichen Rechte.« 7Und nun hatten die Franzosen gegenüber den Preußen zunächst gesiegt, auch wenn sie Preußen noch nicht besiegt hatten – und das sicherlich nicht so sehr durch Gebete als vielmehr durch kluge militärische Strategie.
Читать дальше