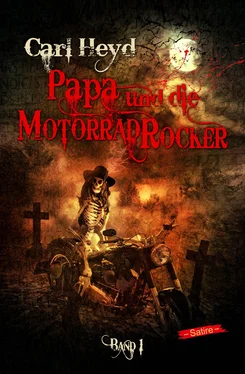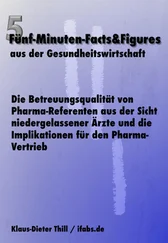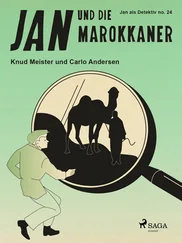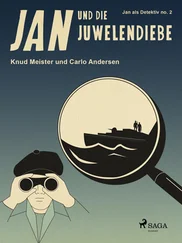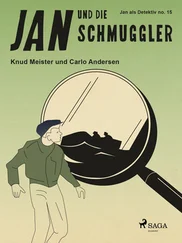Auch mein weiteres Verhalten wäre so im wahren Leben niemals aufgetreten: Ich blieb wie festgenagelt stehen und wartete auf die Hundemeute, die sich bereits bis auf wenige Meter genähert hatte. Warum rannte ich nicht weg? Mein passives Traumverhalten machte mich sauer. An der Spitze der Hundemeute befand sich ein kleiner Dackel, der schien der Chef im Ring zu sein. Seine Schnauze war blutverschmiert.
„Kannst du Pfeife es noch nicht mal mit ein paar wild gewordenen Straßenkötern aufnehmen?“, hörte ich hinter mir eine bekannte Stimme. Sie gehörte zu meinem Vater, aber ich traute mich nicht, mich umzudrehen.
„Das sind keine gewöhnlichen Straßenköter, sondern reißende Bestien“, verteidigte ich mich.
Meinen Vater schien dies Argument nur wenig zu beeindrucken: „Klar, du findest ja auch für alles eine Ausrede. Bei der Prüfung zum Freischwimmer hattest du zu viel Wasser geschluckt, beim Abi war es die verflixte Prüfungsangst, und die paar Schoßhündchen zeigen dir gleich, was eine Harke ist, weil es sich nicht um gewöhnliche Hunde, sondern um reißende Bestien handelt. Du bist ein Verlierer, stell dich doch einfach dieser unumstößlichen Tatsache!“
Dieser Arsch versaute mir den ganzen Albtraum! Im realen Leben hatte ich ihn seit der Beerdigung meiner Mutter nicht mehr gesehen (es gab auch keine Telefonate, Postkarten, E-Mails, SMS oder Telefaxe), aber anstatt mir die Möglichkeit zu geben, ihn komplett zu verdrängen, drang er in regelmäßigen Abständen in meine Traumwelt ein und demotivierte mich dort mit seinen zynischen Kommentaren. Vielleicht hätte ich ja ohne seine schlauen Sprüche noch irgendwie die Kurve bekommen, hätte eine Waffe aus der Tasche gezogen und die Hunde, einen nach dem anderen, mit Grandezza abgeknallt. Oder ich wäre mit fast übermenschlicher Geschwindigkeit davongelaufen, so schnell, das selbst die Hunde keine Chance gehabt hätten, an mir dranzubleiben. Doch auch in Träumen haben wir kein Hätte-wäre-Land, und so verwunderte mich das Finale nicht besonders: Einem der Hunde gelang es, mich zu Boden zu werfen, und nahezu zeitgleich stürzte sich die Meute auf mich. Überall wurden rasiermesserscharfe Zähne in meinen Körper gerammt, die Schmerzen waren unerträglich. Ich erwachte klitschnass – was allerdings auch von der immensen Hitze, die an diesem Juli-Tag herrschte, herrühren konnte.
Manfred kam pünktlich, um mich abzuholen. „Da bin ich, Chef – zu allen Schandtaten bereit“, begrüßte er mich freudig.
Er hatte sich ähnlich aufgestylt wie ich: Bluejeans, halbhohe Lederstiefel und ein weißes T-Shirt, und eine abgewetzte Lederjacke hielt er noch in den Händen. Wir sahen nicht einmal ansatzweise aus wie Motorradrocker, aber das war egal.
So machten wir uns auf zu Mannis VW Passat, der vorausschauend unter einer großen Eiche geparkt war. Im Inneren war es angenehm kühl, und die Klimaanlage sollte diesen Zustand auch während der gesamten Fahrt aufrechterhalten. Ich instruierte meinen Assistenten, worum es bei dem Auftrag im Groben ging.
„Ich habe das zwar so noch nicht mit Moreno abgesprochen, aber mein Plan geht in die Richtung, dass wir dem Filius den Spaß an den neuen Freunden verderben. Wenn wir das Bild, das er von den Pasing-Devils hat, über den Haufen werfen, wird er sich enttäuscht von ihnen abwenden. So ähnlich wie damals bei der Achtzehnjährigen, die sich dieser komischen Sekte in Frankreich angeschlossen hatte. Du erinnerst dich noch, oder?“
Manfred bejahte und merkte an: „Wenn man vielleicht rausfinden würde, dass einer von den Rockerchefs ein Homo ist, würde das doch vielleicht schon reichen, oder?“
Ich guckte auf die Uhr. Manfred war jetzt nach circa dreizehn Minuten auf sein Lieblingsthema Homosexualität zu sprechen gekommen – ein eher durchschnittlicher Wert, den ich dennoch in der Notizen-App meines Smartphones eintrug.
Ich war schon auf die nächste Monatsauswertung, die für den Juli, gespannt, die sollte dann auch endlich wieder ein repräsentatives Bild ergeben. Der Juni hatte ja aufgrund einer zweiwöchigen Urlaubsabwesenheit von Manfred (Thüringer Wald, viel gewandert) nur sehr wenige Zahlen mit geringer empirischer Aussagekraft geliefert.
„Von hinten kommt das Skelett angedonnert, Chef!“
Ich schaute in den fleckigen Rückspiegel. Wir standen an einer roten Ampel, die Geschwindigkeit des heranbrausenden Skeletts nahm jedoch nicht ab, eher noch zu. Die rote Ampel geflissentlich ignorierend, überholte uns das Skelett links und durchquerte mit mehr Glück als Verstand den kreuzenden Verkehr. Das war knapp!
„Was hatte das Skelett denn da auf den Rücken geschnallt?“, fragte ich. Vielleicht hatte Manfred das ja vom Fahrersitz aus besser erkennen können.
„Das sah aus wie eine Schrotflinte oder so was in der Richtung …“
Mich überkam ein leichter Schauer. Was hatte das Skelett bloß vor? Woher kam es, was wollte es mit der Waffe und warum, zum Teufel noch mal, lief bzw. fuhr es mir ständig über den Weg?
„Laut Navi sind es jetzt noch etwa zwei Kilometer, dann haben wir unser Ziel erreicht, Chef.“
Manni sprach trotz seiner sächsischen Herkunft ein astreines Hochdeutsch. Nur bei Wutanfällen – und die gab es bei ihm allerdings häufiger, meistens waren dann „Homos“ involviert – verfiel er in seinen Ursprungsdialekt. Das Navigationssystem vermeldete, dass wir unseren Zielort erreicht hatten. Der Club hatte sich ein altes Tankstellengebäude zurechtgemacht – das hatte schon was. Auf einem davor stehenden Schwenkgrill brutzelten einige Fleischwaren, die verführerische Düfte absonderten. Das Schönste am Sommer ist halt doch die Grillerei, da gibt es nichts!
Manni katapultierte seine hagere, drahtige Gestalt aus dem Auto und zog skeptisch die Augenbrauen hoch.
„Schon ein paar Homos entdeckt?“, erkundigte ich mich fürsorglich.
„Der da vorne, der neben dem grünen Motorrad steht, der sieht mir nicht ganz koscher aus, das könnte eine Schwuchtel sein“, erwiderte mein Assistent todernst in einem konspirativen Tonfall.
Viel war noch nicht los. Ich erblickte circa sechs bis sieben Biker, einer davon näherte sich uns mit raschen Schritten.
„Nicht so schüchtern, die Herren, immer hereinspaziert!“, rief uns ein hochgewachsener Rocker mit beachtlicher Bierplauze freundlich entgegen. „Ich bin Heinz Siekmann, aber ihr könnt mich Heinzi nennen. Ich bin der Präsident von diesen wilden Kerlen.“
So wild kamen die mir zum Teil zwar nicht gerade vor, aber nun gut. Heinzi führte uns ins Innere des Clubhauses, wo uns eine imposante Theke und mehrere gemütlich wirkende Sitzecken empfingen. Natürlich war alles – das hatte ich nicht anders erwartet – auf Amiland gemacht: Die Wand hinter der Theke war mit einem überdimensional großen Bild der New Yorker Skyline bedeckt, es gab einen knallroten Kühlschrank, der nicht mit Coca-Cola-Schriftzügen geizte, und das Motorrad, das in der Mitte des etwa zehn mal sieben Meter großen Raumes stand, besaß einen als Star-Spangled Banner geairbrushten Tank. Heinzi fiel sofort auf, dass meine Blicke auf das Motorrad fielen.
„Das ist ein geiles Teil, oder? Wir hatten das auch mal mit einem Skelett in Cowboystiefeln geschmückt, aber das ist seit einigen Tagen verschwunden, das muss irgendein Scherzkeks geklaut haben …“
Er zog seine etwas zu weit sitzende Hose hoch und grinste uns an: „Aber nicht das ihr jetzt auf falsche Gedanken kommt: Unser Skelett saß hier immer nur friedlich und apathisch rum, das konnte nicht Motorrad fahren wie das Ding da auf YouTube.“
Manni und ich versorgten uns an der Theke mit kalten Getränken und gingen dann wieder nach draußen. Heinzi hatte sich dort zwischenzeitlich anderen Neuankömmlingen zugewandt, die er ebenso herzlich wie uns begrüßte. Moreno junior konnte ich noch nicht entdecken. Sein Vater hatte mir noch einige Bilder gemailt, die einen etwas grobschlächtig aussehenden Bodybuildertypen mit fettigen Haaren zeigten.
Читать дальше