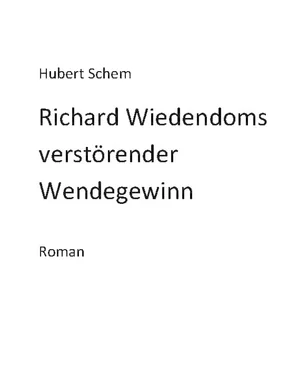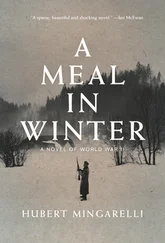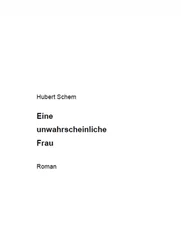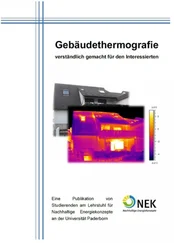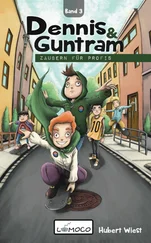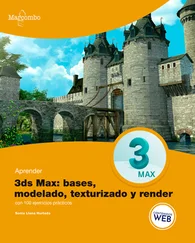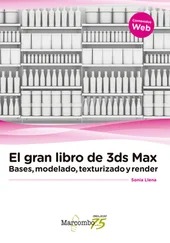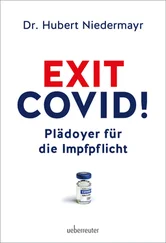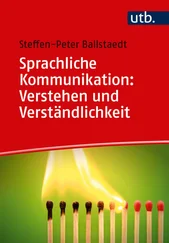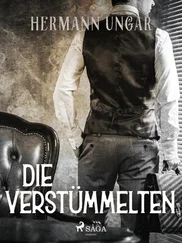Der Übergang des Eigentums vom Deutschen Reich oder irgendeiner Unterorganisation des Reichs auf „das Volk“ entsprach dem Normalverlauf nach dem Krieg in der sowjetisch besetzten Zone. Das weitere Schicksal des Grundstücks war nicht im einzelnen feststellbar. Irgendwann muss es dem Volkseigenen Betrieb Schiffswerft Anker zur Nutzung zugeordnet worden sein.
Das Grundstück wurde mit anderen volkseigenen Grundstücken, die bereits zum Bestand der Werft gehörten, verschmolzen. Damit war seine Existenz als eigenständiges Grundstück zu Ende. Wahrscheinlich diente es nach damaliger Sprachregelung in hervorragender Weise dem Aufbau eines neuen Staates. Eines Staates mit Riesenambitionen, wie es bei den Landsleuten von Hegel, Marx und Engels nicht verwunderlich ist. Das realsozialistische Gegenmodell zur Bundesrepublik Deutschland, dem angeblichen Musterschüler des monopol-kapitalistischen Imperialismus. Riesenambitionen – immer wieder verkündet und dem Volk eingebläut. Nach einundvierzigjähriger Existenz sang- und klanglos wieder aus der Geschichte abgetreten. Kein Schuss von Angreifern oder Verteidigern. Unblutig und undramatisch – jedenfalls nach den landläufigen Vorstellungen von Dramatik in der Geschichte. Schleichender und schließlich galoppierender Staatsbankrott. Abstimmung der Bürger mit den Füssen, die Mittel und Wege finden, das Land zu verlassen. Mutige Demonstranten in rasch wachsender Menge auf den Straßen. Passivität der Großen Sozialistischen Brudernation. Verwirrung. Missverständnisse über die Beschlusslage. Ungewollte Öffnung der Grenze. Eine kurze Phase eigenständiger demokratischer Experimente. Wiederherstellung der alten Länder in der DDR. Währungsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Zaubermittel Deutsche Mark. Und schließlich, wie von der großen Mehrheit der demokratisch gewählten Volkskammer beschlossen: Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland. Ende der DDR. Da die Rechtsordnung der Bundesrepublik kein „Eigentum des Volkes“ im Sinne der ehemaligen DDR kennt, ist dieser Begriff seit dem 3. Oktober 1990 Teil der Rechtsgeschichte. Und nun ...?
Der konkrete Einzelfall des zu einer bedeutenden volkseigenen Werft in Rostock gehörenden Flurstücks ließ mich das Ausmaß der Herausforderung für Juristen, Ökonomen und andere Merker und Macher ahnen, die darin besteht, nicht nur die einundvierzig Jahre eines sozialistischen Experiments vermögensrechtlich so weit wie möglich wieder rückgängig zu machen, sondern auch die materielle Wiedergutmachung des Nazi-Unrechts, vor der sich die DDR-Regierung wie vorher schon die sowjetische Militäradministration immer gedrückt hatte, nachzuholen. Als ich mir dies alles vorstellte und mir klarmachte, dass es in der Rechts- und Wirtschaftsgeschichte weltweit keinen vergleichbaren Vorgang gab und je gegeben hatte, spürte ich, wie es in mir vibrierte. Das ist Praxis. Das ist Leben. Das ist etwas ganz anderes als eine Abhandlung zu schreiben, die sich mit einer vagen Vorstellung von der Wirkungsmacht des Wortes verbindet. Und was für ein Einzelfall in diesem historischen Rahmen! Mehr als sechzig Jahre lag im konkreten Fall das Ereignis zurück, dessen rechtliche Einordnung vielleicht darüber entscheiden würde, ob mein Freund Richard Wiedendom sich in absehbarer Zeit zu den Millionären zählen konnte oder ob er seinen Ruhestand mit sehr bescheidenen Mitteln bestreiten musste. So etwas stand in keinem Lehrbuch.
Richard hatte mir erzählt, dass es ihm im Sommer 1990 nur nach hartnäckigen Verhandlungen mit einem pflichtbewussten Pförtner gelungen war, auf das Werftgelände gelassen zu werden. Mit einer Mischung aus prickelnder Neugierde, Erinnerungsfetzen und wachsendem Unbehagen hatte er versucht, das frühere Wiedendom-Grundstück auf dem weitläufigen Gelände zu finden. An einer Verzweigung der Hauptwerkstraße war ihm dann plötzlich klar geworden, dass er nichts mehr von den Merkmalen des Grundstücks, die er noch in Erinnerung hatte, finden würde. Keine Kies- und Sandberge, keine Gleisanlage mit beladenen und leeren Loren, kein Entladekran am betriebseigenen Kai, nichts mehr von der großen Baracke mit einem Büroteil, einem Aufenthaltsraum für die Belegschaft und mit einer kleinen Wohnung. Wie aus einem Traum in die nüchterne Wirklichkeit erwacht, war er umgekehrt, hatte seinen Passierschein wortlos beim Pförtner abgegeben und war zu seinem außerhalb abgestellten Wagen geeilt.
iIm Frühjahr 1997 konnten Richard und ich problemlos mit dem Wagen auf das Werftgelände fahren. Die Pförtnerloge war unbesetzt. Niemand hielt uns auf. Nichts von dem vage erwarteten Konzert kreischender, dröhnender, zischender, knallender Maschinen, sondern eine unbehagliche Stille. Dämmrige Werkshallen. Und nur hier und da einzelne Arbeiter auf dem Gelände.
Wir wurden im Verwaltungsgebäude erwartet. Die mächtigen Anlagen des benachbarten Reparaturdocks verwiesen den ansehnlichen Klinkerbau auf einen bescheidenen Rang. Ein einfacher Büroraum war zum Besprechungszimmer umfunktioniert worden. Hier zwang kein ausladender Konferenztisch die Teilnehmer, sich in eine Frontlinie einzuordnen. Nach zurückhaltend-freundlicher Begrüßung glaubte ich sekundenlang bei den Werftvertretern eine Mischung aus Anspannung, Unsicherheit, Bereitschaft zur Interessenvertretung und Resignation zu erkennen. Der Geschäftsführer der Anker Schiffswerft GmbH, die im Mai 1990 aus dem Volkseigenen Betrieb hervorgegangen war, wurde von zwei Abteilungsleitern und einem jungen Rechtsanwalt unterstützt. Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen war durch drei Juristen vertreten. Von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) – neuer Name der ehemaligen Treuhandanstalt - war zu meinem Bedauern niemand erschienen. Obwohl der Geschäftsführer diese Tatsache als unwesentlich darzustellen versuchte, war mir sofort klar, dass die auf Initiative des Landesamtes anberaumte Besprechung unter diesen Umständen nicht zu einem schnellen Ergebnis führen konnte. Auch wenn wir mit den Werftvertretern zu einer abschließenden Einigung kamen, konnten wir nicht sicher sein, ob das Verfahren damit beendet wäre. Die BvS als einzige Gesellschafterin der GmbH hatte sich generell vorbehalten, derartige Einigungen zu genehmigen.
Der Referatsleiter des Landesamtes führte konzentriert und um strikte Neutralität bemüht in den Verhandlungsgegenstand ein. Tatsachen, die den Rückgabeanspruch begründen, andere Tatsachen, die ihm entgegenstehen könnten. Unklarheiten, Zweifelsfragen. Ich bemühte mich, die wichtigsten Daten zu notieren und gleichzeitig die strategischen Konsequenzen für mich als Verfahrensbevollmächtigten Richards zu bedenken.
Abschließend bat der Referatsleiter den Geschäftsführer der Werft, die wesentlichen Stationen der Entwicklung der Werft seit der Wende darzustellen, eine realistische Prognose für die kommenden Jahre abzugeben und insbesondere darzulegen, inwiefern das zurückverlangte Grundstück betriebsnotwendig war, noch sei und bei wirtschaftlich vernünftiger Betrachtungsweise voraussichtlich auch bleiben werde. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist eine Rückgabe ausgeschlossen, wenn zwar alle Tatsachen erwiesen sind, die den Anspruch auf Rückgabe begründen, wenn jedoch das Grundstück für einen Gewerbebetrieb zum Zeitpunkt der Wende lebensnotwendig war und es seitdem geblieben ist. Auf diese Weise wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Arbeitsplätze durch die Rückgabe von Grundstücken an frühere Eigentümer oder deren Erben vernichtet wurden.
Der Geschäftsführer sprach präzise und emotionslos. Totaler Verlust aller Auftraggeber mit dem Zusammenbruch der Staatswirtschaft in den Ländern des Ostblocks. Schnellste Orientierung am freien Markt. Notwendigkeit, sich in die gegebenen Strukturen des Westens einzufügen. Verzicht auf den Bau von neuen Schiffen. Statt dessen Spezialisierung auf Schiffsreparaturen und -wartung. Zwei Ansätze zur Privatisierung gescheitert, weil die Investoren den Mund zu voll genommen hatten. Jetzt brandneue Kontakte zum Kapitaleigner einer renommierten westdeutschen Werft. Im Moment mäßige Auslastung, aber durchaus Chancen für die Erhaltung von etwa fünfhundert Arbeitsplätzen von einstmals über zweitausend. Mehrere hundert Mitarbeiter in einer Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft „geparkt“. Es wäre wirtschaftlich fatal, diese qualifizierten und spezialisierten Mitarbeiter auf Nimmerwiedersehen zu entlassen. Insofern absolute Betriebsnotwendigkeit der Halle, die von dieser Gesellschaft genutzt wird. Nutzung einer weiteren Halle derzeit für betriebsinterne Reparaturarbeiten, zugegebenermaßen nicht sehr intensiv. Aber schweres Hemmnis bei den Privatisierungsverhandlungen, wenn ein derartig wertvoller Teil aus dem Gelände herausgeschnitten werden müsste. Im übrigen Nutzung für die jeweiligen Produktionszwecke der Werft seit der Wende.
Читать дальше