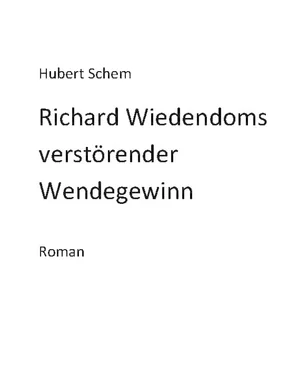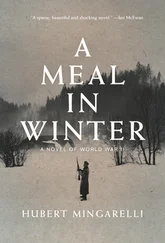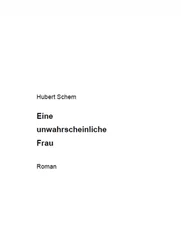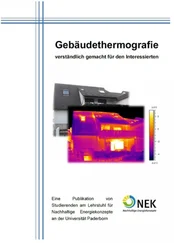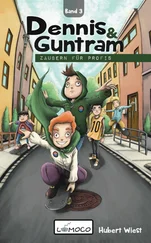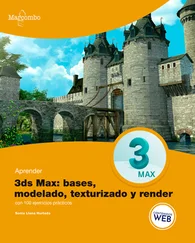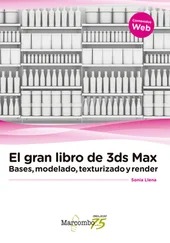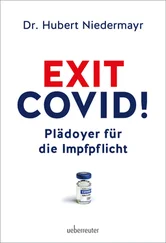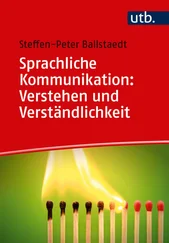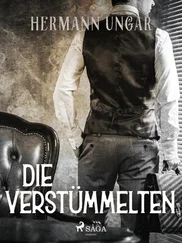„Lass das nicht meine Schülerinnen und Schüler hören. Ich versuche gerade mühsam, ihnen beizubringen, wie wichtig es ist, Tatsachen und Phantasien exakt auseinander zu halten.“
„Versprochen! Und im übrigen besteht jetzt keine ernsthafte Gefahr mehr.“
„Ja, leider!“
„Höre ich gerade ‚leider’?“
„So war meine Rede. - Und soll ich dir noch etwas sagen?“
Ihre Stimme verriet ihm, dass ein höchst angenehmer Themenwechsel anstand. „Etwas Wahres oder ...?“
„Was hältst du von einer multimethodischen Fortsetzung in meinem Bett?“
Er brauchte nur eine Sekunde für seine Entscheidung. Dann zog sein breites Lächeln über sein Gesicht: „Überredet nicht, nicht im geringsten überzeugt; aus dunklen Gründen aber total überwältigt. Wohlan denn!“
3
Richards vertrauensvoller Auftrag ging zu Lasten eines Projekts, das mir schon viele Jahre unscharf vorgeschwebt, das ich aus wechselnden Gründen aber nie in Angriff genommen und schließlich auf die Zeit nach meiner Emeritierung verschoben hatte. Ich wollte mit einer zündenden populärwissenschaftlichen Abhandlung einer breiten Öffentlichkeit vor Augen führen, welche schädlichen Auswirkungen sprachliche Schlamperei auf das Bewusstsein der denkenden und handelnden Bürger und damit auf wirtschaftliche und politische Entscheidungen haben kann. Als Beispiel dafür wollte ich einen Begriff unter die Lupe nehmen, der in den verschiedensten Fach- und Rechtsgebieten sowie im Alltagsleben von Millionen eine höchst bedeutsame Rolle spielt: das Unternehmen.
Als Student im ersten Semester hatte ich gelernt, die zwei großen Begriffe Rechtssubjekt (oder auch Rechtsinhaber) und Rechtsobjekt (oder auch Rechtsgegenstand) strikt voneinander zu unterscheiden: Wer Rechtssubjekt sein kann, kann niemals Rechtsobjekt sein, und umgekehrt. Ein juristischer Laie, aufgefordert, Gründe für die eindeutige Abgrenzung zu nennen, würde vermutlich spontan die Schwergewichte Sklaverei, Leibeigenschaft und Frauenkauf anführen. Menschen als Objekte im Rechtsverkehr – das ist heute nicht mehr ernsthaft diskutabel. Das wäre eine krasse Verletzung der Würde des Menschen, die im Grundgesetz als unantastbar garantiert wird. Die inzwischen übliche Schreib- und Sprechweise der Sportjournalisten, wenn sie vom sogenannten Spielermarkt berichten oder von einzelnen Fußballprofis, die den Verein wechseln wollen oder sollen, kennt zwar längst keine Anführungszeichen oder ironisierenden Adjektive mehr – Kauf und Verkauf, Anschaffungspreis und Amortisation werden wie bei einem Sachgegenstand verwendet -, aber ich wage nicht zu entscheiden, ob diese Sprachrohheit lediglich eine zur Gewohnheit gewordene Provokation sein soll oder ob den Schreibern das Ungeheuerliche ihrer Schreibweise nicht im geringsten bewusst ist.
Trotz solcher Entgleisungen scheint es mir immer noch einfach für jeden Laien wie auch für jeden Juristen, die Unterscheidung immer und überall zu beachten, wenn es darum geht, Menschen nicht als Sachen zu behandeln. Aber gilt das auch für juristische Personen als Rechtssubjekt? Und ist es ein eben so starkes Tabu, einem Rechtsobjekt niemals Rechte zuzuweisen? Schon in meinem fünften Semester fing ich an, mich mit solchen Fragen herumzuschlagen. Weil ich entdeckte, dass im sogenannten Unternehmensrecht, namentlich im Aktiengesetz, selbst der Gesetzgeber die Unterscheidung nicht rigide durchgehalten hat: Mal erscheint das Unternehmen als Rechtsobjekt, mal wie ein Rechtssubjekt, mal als schillerndes Mittelding. Wie trotz der Beteiligung zahlreicher Juristen in den Ministerien ein derartiger sprachlicher Wechselbalg entstehen konnte, ist mir unbegreiflich. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig sind nur die Folgen. Und deren negatives Ausmaß ist evident: Der Begriff Unternehmen ist inzwischen so vieldeutig, dass er sich dem Zugriff scharfsinniger Juristen und Laien entzieht und fast jeder an die Wurzeln gehenden Kritik geschmeidig ausweicht. Nicht zuletzt dieser Begriffsverwirrung ist es zuzuschreiben, dass die Verantwortlichen für katastrophale Fehlentwicklungen oder kriminelle Machenschaften innerhalb eines Unternehmens nicht namhaft gemacht werden. Der Unternehmer als Mensch mit Fleisch und Blut oder als juristisches Gebilde, hinter dem letztlich auch immer Menschen mit Fleisch und Blut stehen, ist fast aus der deutschen Sprache verschwunden. Er wurde verschmolzen mit dem komplexen Rechtsgegenstand, der ursprünglich als Unternehmen bezeichnet wurde. Seitdem ist der Begriff nicht mehr fassbar. Ein Mythos wurde gezeugt und geboren. Ein schillerndes oder auch schwammiges Gebilde. Nein, kein Gebilde, sondern ein Konstrukt – ein reines Geistesprodukt ohne materiellen oder ideellen Gehalt. Aber ein Konstrukt, das sehr gezielt im politischen Alltag herumgeistert und schwerwiegende politische Entscheidungen bestimmt. Einerseits sind Unternehmen angeblich schöpferisch, gehen Risiken ein, schaffen Arbeitsplätze, sind äußerst sensibel, können schrecklich leiden, insbesondere weil sie Steuern zahlen sollen, brauchen Subventionen, um ihren sozialen Auftrag erfüllen zu können – haben also alle Eigenschaften eines Subjekts. Trotz ihrer ausgeprägten Sensibilität können Unternehmen andererseits nicht nur gegründet und liquidiert, sondern auch verkauft, verpachtet, mit anderen Unternehmen verschmolzen und zergliedert werden – sind also Objekte des Rechtsverkehrs. Dass dieser Wahn zu einem guten Teil auch mitschuldig ist für das unterentwickelte Niveau der Auseinandersetzungen auf wirtschaftlichem Gebiet, scheint mir sehr naheliegend.
Ich hatte mir vorgenommen, die Begriffsverwirrung und ihre verheerenden Folgen deutlich zu machen und ein flammendes Plädoyer dafür zu halten, den missratenen Begriff Unternehmen aus dem deutschen Wortschatz zu tilgen. Dabei ging es mir keinesfalls um schlichte Beckmesserei. Vielmehr hatte ich mir vorgestellt, wie ich anhand dieser Fehlentwicklung demonstrieren würde, dass es eine Wechselwirkung zwischen klarem Denken, eindeutigem Sprechen, gradlinigem Handeln und unabdingbarer Verantwortung gibt.
Nachdem ich die Herausforderung durch Richard angenommen hatte, rückte dieses Projekt in den Hintergrund.
Der Sog der Praxis hatte mich erfasst. - Womöglich eine letzte Bestätigung dafür, dass die Weichen für meine Berufslaufbahn vor vierzig Jahren falsch gestellt wurden. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Richard ein begnadeter Rechtswissenschaftler und -lehrer geworden wäre, während ich selbst nach meiner eigenen Einschätzung nie über das Mittelmaß hinausgewachsen bin. Dazu muss ich anfügen, dass das Mittelmaß von Leistungen für mich keine schlechte Bewertung ist. Die schlichte Logik sagt mir, dass es sich aus besseren und gleichviel schlechteren Leistungen ergibt. Wenn alle besser werden, wird sich auch das Mittelmaß verändern. Mir mangelte es immer an dem absolut störungsfreien Antrieb zum Erreichen des Außergewöhnlichen. Unbedingter Glaube, vorbehaltslose Liebe und unerschütterliche Hoffnung sprudelten mir nicht dauerhaft als Quellen der Zielstrebigkeit. Dagegen spricht vieles dafür, dass ich die Last besser geschultert hätte, die Richard von seinem Vater aufgebürdet wurde. Leider stand uns damals ein solches Wahlrecht nicht zu. So blieb uns beiden nichts übrig, als sich mit den Gegebenheiten, die wir nicht verändern konnten oder wollten, nach besten Kräften zu arrangieren. Mein Hirn schaffte es allmählich, mir durch feinziselierte Abstraktionen Vergnügen zu bereiten, während Richard – leider allerdings ohne finanziellen Nutzen für sein eigenes Unternehmen - beachtliche technische Neuerungen auf dem Gebiete des Bauwesens initiierte oder förderte, obwohl sein Herz immer noch der Juristerei gehörte.
Sofort nach Richards eindrücklicher Schilderung begann mein altes Juristenhirn auf jene Weise zu arbeiten, die das Blut eines deutschen Rechtsprofessors schneller und intensiver in Wallung bringt als alle bekannten Stimulanzien – ein für Nichtjuristen befremdliches, wenn nicht sogar lächerliches Phänomen. Ich sah eine zunächst namenlose Teilfläche unserer Mutter Erde durch einen Rechtsakt als eigenständiges Grundstück entstehen. Erdstück wurde Grundstück. Dieser Schöpfungsakt war vollendet, als das in der Natur vermessene, durch Grenzsteine markierte, im Kataster durch fachmännische Bezeichnungen von allen anderen Teilen der Erdfläche unterschiedene Erdflächenstück im Grundbuch von Rostock als separater Gegenstand des Rechtsverkehrs eingetragen wurde. Ich verkniff es mir, Mutmaßungen über die Gründe des Eigentümers, von dem Richards Vater das Grundstück 1938 erwarb, für den Verkauf anzustellen. Aber es fiel mir nicht schwer, mir die wirtschaftliche Bedeutung des Grundstücks im Zweiten Weltkrieg für die Baustoffhandlung Philipp Wiedendom GmbH auszumalen. In einem großen schwarzen Loch lagen jedoch die Gründe dafür verborgen, dass der Volksgerichtshof im Herbst 1944 Philipp Wiedendom zum Tode verurteilte und sein gesamtes Vermögen einzog.
Читать дальше