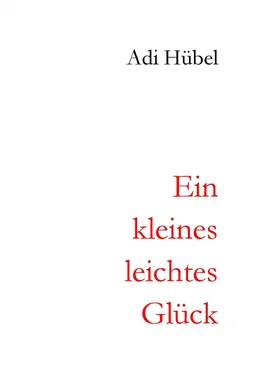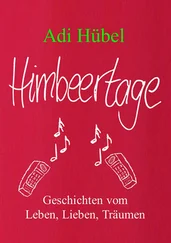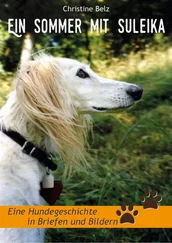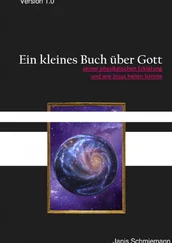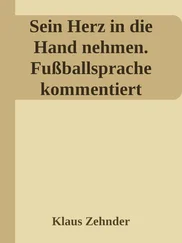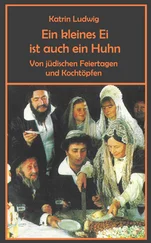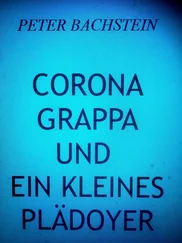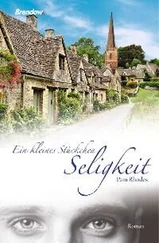Die Tanten, und die Kinder mit ihnen, halfen den Bauern und damals vor allen den Bäuerinnen der näher gelegenen Höfe beim Heuen, bei der Ernte, beim Viehhüten und beim Melken und Misten. Was Onkel Hans über seinen Beruf und sein verhaltenes Wesen, von den neuen Schiern ganz abgesehen, hinaus interessant machte, war seine Herkunft, die sich vor allem in seiner Sprache, in seinem herben und kargen Dialekt äußerte. Dabei war auch der Dialekt der Großeltern und Oberallgäuer, das Städtchen lag noch im Württembergischen, der Weiler schon im Bayerischen, nicht gerade vertraut und doch fand Kathi natürlicherweise vieles vom Klang und der Melodik, von starker, kurzer Wort- und Satzform der Mutter wieder. Der Onkel dagegen hätte auch aus dem fernsten Morgenlande kommen können, es war Kathi alles gleichviel oder gleich fern damals. Aus Murnau hatte ihn die Tante mitgebracht oder war er von alleine gekommen. Murnau, ein Ort, so unbekannt und fern und doch so freudvoll besetzt, wie später selten ein Ort, Murnau, ein Zauberwort.
Katharinas andere Onkel waren unbekannt und abwesend und erst in späteren Jahren wurde einer von ihnen, in ihrer Vorstellung schon lange als Heiliger oder zumindest großartiger Mann nistend, enttäuschende Realität. Seine Frau, diese angeheiratete Tante, klein, mollig, geschwätzig, aus Worms stammend, fand sich mit ihrer einzigen Tochter Marieluise bei den Großeltern ein. Sie vermochte es, durch endloses Erwähnen des Namens ihres verschollenen Mannes, diesen den anderen unauslöschlich einzuprägen. Wo gab es schon noch einen Menschen, der Eustach hieß. Eustach war unsichtbar allgegenwärtig. Sichtbar allgegenwärtig war Marieluise und es erfüllte Kathi mit Staunen und Erbitterung, wenn sie, die sie zu Hause hungerte, mit ansehen musste, wie Marieluise, unter den lächelnden Blicken der Tante, ein ach so rares weiches Ei auf dem Tellerrand verschmierte, wie sie unter Hinweis auf den fernen Papa die besten Stücke in den widerwillig geöffneten Rachen gestopft bekam und wie sie zum Abschluss der Mahlzeit ihre Hände im kostbarsten aller Leckereien, in dunklem, süßem Kakao badete. Von den Schwägerinnen gerügt, verwies Tante Eugenie auf den fernen Gatten und die Trauer um ihn. Diese und eine strenge Hand, dem einzig gebliebenen Pfand der Liebe gegenüber, lasse sich nicht vereinbaren.
Doch Eustach, der Onkel, blieb nicht, wo immer er gewesen war, er kehrte zurück und brachte Kathis Glauben an Autoritäten ins Wanken, denn Onkel Eustach schielte heftig und unablässig. Des Weiteren hatte er, wohl durch die Einwirkungen des Krieges, ein Bein verloren, besaß jedoch, als Kathi ihn kennenlernte, schon eine, allerdings nie sichtbare Prothese. Diese Tatsache blieb zwar interessant, doch zweitrangig. Ausschlag gebend für Kathis Verhältnis zu ihm war der nicht beherrschbare Blick. So unsicher sich seine Augäpfel in den Höhlen bewegten, so unsicher war sie von Anfang an in ihrem Verhalten einem solch unkontrolliert schielenden Erwachsenen gegenüber. Wäre er wenigstens ein Kind gewesen, hätte sie sich darüber lustig machen oder über eine spätere Besserung nachsinnen können. Für einen erwachsenen Mann gehörte sich so etwas einfach nicht und Kathi schämte sich für ihn. So gut es ging, hielt sie sich von ihm fern.
Der älteste der Geschwister ihrer Mutter, Gebhard, hatte auf einen Hof in der Nähe geheiratet und blieb Kathi fast unbekannt. Engelbert, der jüngste, schien sein Dasein der Hartnäckigkeit der Großeltern zu verdanken. Als nach vier Töchtern dicht aufeinander folgend, noch ein Sohn geboren wurde, dieser aber schwach und nicht lebensfähig bei der Geburt starb, wurde er, da zu den Engeln gegangen, nachträglich Engelbert getauft. Einen Engelbert verloren, wollten die Eltern eine zweiten, konnten jedoch auch diesen dem Himmel nicht abtrotzen. Doch da aller guten Dinge drei sind, ließen sie nicht nach in ihrem Mühen und schafften es schließlich, den dritten und letzten Sohn namens Engelbert zu zeugen, zu gebären, zu taufen und am Ende auch großzuziehen.
6. Sommerleuchten
Die Kinder genossen es, so vielfältige familiäre Beziehungen zu haben. Für sie war es wichtig, Zuneigung und Abgrenzung in dieser großen Gruppe einzuüben, waren sie doch, das Haus relativ einsam gelegen, aufeinander angewiesen. Früh schon durften und mussten sie auch kleine Aufgaben im Haus übernehmen. Dabei wurde das Besorgen von Lebensmitteln in einem nahe gelegenen Weiler für Kathi zu einer Lieblingsbeschäftigung. Alleine, zu zweit oder zu dritt zogen die Kinder, einen Korb und den Einkaufszettel schleppend, durch die Wiesen zum etwa halbstündig entfernten Laden. Hier betraten sie das Paradies der Waren. Dürftig ausgestattet in jener Kriegs- und Nachkriegszeit, gab es hier doch Dinge, die ihnen den „Mund wässrig“ machten.
Hatten sie ihre schmalen Einkäufe erledigt, machten sie sich nicht sogleich auf den Weg. Möglichst unbemerkt, schlüpften sie zusammen mit den Weilerkindern in den Lagerschuppen, um sich aus Schachteln und Körben und Kisten die herrlichsten Landschaften und Höhlen zu bauen. Irgendwann machten sie sich dann erschrocken und überstürzt auf den Heimweg, hoffend, die Zeit sei stehen geblieben und Großmutter und Tanten würden ihre wiederholt eingelegten Schleckpausen, in denen sie vorsichtig mit den nassen Zeigefingern in kleinsten Mengen vom eingekauften Zucker naschten, nicht bemerken. Doch die Zeiten waren karg und die Tanten übersahen wenig. Haushalten und sparen war lebensnotwendig und an solchen Abenden büßten sie ihre süßen Orgien mit dem Verzehr saurer Träuble ohne alles.
Neben den kleinen Pflichten, zu denen auch das Futterholen und das Füttern und Misten der Stallhasen gehörte, das Hühnereintreiben, das Feuerholzstapeln an der Hauswand, das Unkrautziehen und das abendliche Gießen des Gartens, vertrieben sich die Kinder die Zeit mit den unterschiedlichsten Spielen. Eines bestand darin, sich wieder und wieder über der obersten Zaunstange auszuhängen, kopfunter und haltlos hin- und herzupendeln und sich am Ende mit einem geübten Schwung in die Hocke zu katapultieren, ohne mit dem Hinterteil den Boden zu berühren. Dieses Gefühl des Schwingens und Fliegens fanden sie auch auf der Schaukel, die Onkel Hans ihnen an der Teppichstange befestigt hatte: zwei Seile mit einem kleinen Holzbrett mit Einkerbungen an den Seiten. Nichts konnte schöner sein als, angestoßen von den älteren, immer höher und höher zu schwingen, in ein Gefühl der lustvollen Schwerelosigkeit und der Angst gleichzeitig hineinzugleiten, mit jedem Schwung ein Stückchen näher dem Himmel und der Sonne.
Ganz erdverbunden war dagegen ein anderes Spiel, sicher nicht von allen als gleich angenehm empfunden. Die Kinder gingen, wie damals auf dem Lande üblich, aber auch der damaligen Not gehorchend, ab Anfang März barfuß. Je wärmer es wurde, desto angenehmer war es, nur mit den blanken Füßen, ohne die meist zu kleinen und engen Schuhe über Gräben zu hüpfen und nach dem Regen in Pfützen und Wagenradfurchen zu waten. Am interessantesten jedoch waren die Kuhfladen. Die Kühe des Nachbarn, eines richtigen, großen Bauern, wurden zweimal am Tag von der Weide am Hausberg, dem Biel, den Weg entlang des Hauses der Großeltern zum Melken eingetrieben. Es fehlte den Bäschen und Vettern also nicht an Material für ihre Mutproben. Die etwas älteren Fladen besaßen an der Oberfläche schon eine dicke graubraune Haut und es war sogar möglich, beim Betreten trockenen Fußes davonzukommen. Für Kathi bedurfte es hier keiner Überwindung. Sie liebte den eben ins Gras oder auf den Weg geklatterten Brei. Saftig und warm und grün quoll er beim Hineintreten üppig zwischen den Zehen hervor.
Die hinter dem Garten ansteigende Weide benutzten die Kinder im Sommer als Rutschbahn. Im Schuppen hatten sie eines Tages, von Reisig halb verdeckt, ein altes Metallschild gefunden. Es hatte wohl einstmals, noch zu Vorkriegszeiten, zu Reklamezwecken an irgendeiner Stall- oder Scheunenwand gehangen und den Bauern und Bäuerinnen der Umgegend die Spielbank in Lindau als einen Ort der Entspannung und des Glückes angepriesen. Nun war das Emaille der Vorderseite an einigen Stellen abgesprungen, die Schrift unvollständig, doch für ihre Zwecke gerade recht. Auf dem vom Tau feuchten Gras rutschten die Kinder alleine oder zu zweit, steuerlos unter großem Geschrei bergabwärts. Schmutzig zu werden, war für sie meist kein Problem, stand doch außer dem kalten Wasser des Brunnens den ganzen Sommer über ein mit Wasser gefülltes Wännchen zur Erwärmung in der Sonne, in dem sie Abend für Abend abgebürstet wurden.
Читать дальше