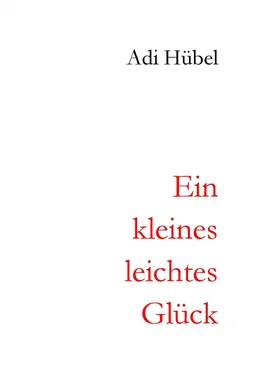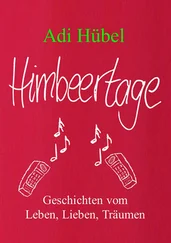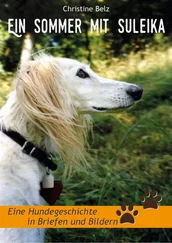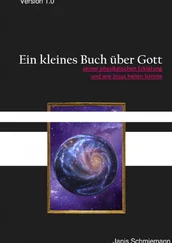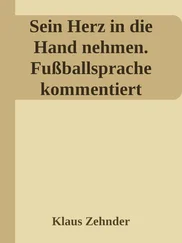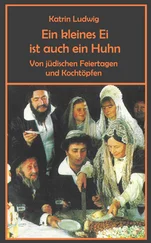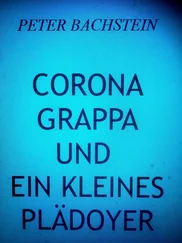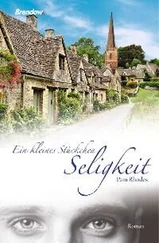4. Ein Königreich
Die Leiter vom Dachboden abwärts, gelangte man vom ersten Stock dann über die Stiege hinunter, durch eine Schwingtüre in den Eingangsraum, der direkt unter der oberen Küche lag. Ab dem ersten warmen Sommertage stand die Eingangstüre tagsüber immer offen, wurde auch in der Nacht nicht verschlossen.
Der Aufenthalt im Haus, nur bis zum ersten Stockwerk aus Stein erbaut, war im Sommer hier unten erträglich. Der zementierte Fußboden kühlte die nackten Füße und machte die Kinder bei längerem Spielen im Dämmer frösteln. Die Räumlichkeiten waren gleich angeordnet wie oben: eine Stube, ein Schlafzimmer, eine Kammer, in der ab einem für Katharina nicht mehr erinnerbarem Zeitpunkt ein Onkel Hans, ein sogenannter Wagner von Beruf, sich eine Werkstätte eingerichtet hatte.
Eines ist sicher, es geschah das Wunder, dass Kathi mit sechs Jahren zum ersten Mal auf eigenen Schiern stand, die der Onkel für sie angefertigt hatte. Überwältigend und unfassbar damals der Gedanke, etwas zu besitzen, das vor ihr noch niemand besessen hatte, etwas Neues, Ganzes, ohne einen Flicken, etwas nur für sie alleine.
Durch die schwere Eingangstüre hinaus in den Garten. Vom Eingang weg führte ein Mittelweg zwischen den Beeten hindurch zu einer kleinen Grasfläche, zu einer Bank unter Sträuchern. Der schmale Weg war, um die Beete zu schützen, entlang des Hauses und des Mittelganges durch einen einfachen Zaun aus Pflöcken und Brettern begrenzt, auf dem die Kinder sitzen und sich schaukeln konnten.
Zurückblickend gewahrte man, dass der obere Teil des Hauses und der Anbau, in welchem der Abort lag, aus Holz errichtet und mit längs geschnittenen Brettern geschützt war, in den Jahren verwittert zu tiefem Grau. Ein kräftiger Spalierbaum, im Herbst mit riesigen, goldgelben Birnen behangen, der Stolz des Großvaters, breitete sich über die Südfront des Hauses. Rundum leuchtete braunrot bis zur halben Höhe aufgeschichtetes Holz, links der Eingangstüre stand der Brunnen.
Tag und Nacht floss hier Wasser, verursachte das immer gleiche dünne Rauschen. Trog und Wasserröhre aus einem dicken Baumstamm gehöhlt, verrotteten langsam und stetig im Laufe der Jahre. Am Brunnen konnten die Kinder spielen, den Abfluss verstopfen, Überschwemmungen verursachen, an heißen Sommertagen sich in den Trog setzen, sich und andere untertauchen. Selbst im Winter versiegte die Quelle nicht. Auch dann lief das Wasser beständig, wenn auch dünner und zaghafter, in harten Wintern erstarrt zu einer Kaskade von Eiszapfen. Es war die einzige Wasserstelle des Hauses. Die Erwachsenen schöpften mit Eimern das im Inneren des Hauses benötigte Wasser und auch die Kinder schleppten mit kleinen Gefäßen hilfreich Wasser ins Schaff. Riesige Holunderbüsche überschatteten den Brunnen, aus deren weißen Blütendolden die Großmutter in heißem Schmalz herrlich schmeckende Küchlein backte und deren Beeren zu Marmeladen und Saft gekocht, manche Erkältung kurierten.
Dann das kleine Viereck der Tiere: eine winzige Hütte für einige Hühner, ein paar Hasenställe an der Wand. Die an das Rasenstück angrenzende kleine Wiese war umzäunt mit einem Lattenzaun, das kleine Reich eines Arbeiters eng umschließend. Gering an Ausmaßen, war es doch, überquellend von Blüten und Farben, für Katharina ein Königreich.
5. Menschenbilder
So exakt das Bild des Hauses sich zeichnet, so verschwommen erscheinen vorerst die Menschen, die Katharinas Kindheit umgaben, sie umsorgten, die liebten und straften. Nicht verwischt im Aussehen, doch in Handlungen und Zusammenhängen, im Muster des Alltags. Einzelne Bilder entstehen im Erinnern, einzelne Begebenheiten tauchen auf, ohne nachgefragt zu sein.
Der Großvater allen voran. Ein harter Mann, hoch gewachsen und schmal, erinnerbar meist mit der Pfeife im Mund, auf der Bank sitzend vor dem Haus, oder frühmorgens am Herd stehend, grantig, geizig, diese Eigenschaft durch nichts belegbar. Sein Spruch, mussten die Kinder nießen: Helf dir Gott. Und überhaupt die Sprüche in ihrer Vielfalt und Einförmigkeit. Immer wieder Mahnungen: Man sagt nicht Danke, man sagt Vergelt’s Gott. Oder: Man gibt nicht die linke Hand, gib die schöne Hand. Oder: Mach einen Knicks, wenn du grüßt. Der Großvater, Arbeiter in der nahen Kleinstadt, etwa sechs Kilometer entfernt, in einer Fabrik, die „Peitschenstecken", biegsame, aus Leder geflochtene Gerten zur Pferdehaltung herstellte. Damals, später dann, in der Zeit der beginnenden Reisewut, wurden es Campingartikel und Wohnwagen.
Die Großmutter, eine kleine zierliche Frau, wunderschön in der Erinnerung, die gute Fee, die den Schatz bewachte in der Vitrine, der alles gehörte, die Verfügungsgewalt hatte, die zuteilte, erlaubte, verbot, bestrafte. Sie war es auch, die Kathi nach einsamer zweistündiger Weltreise mit der Bahn freudig in die Arme nahm. Ihre Ferienkleidung trug sie im Schulranzen verpackt auf dem Rücken mit sich und hinten auf dem Gepäckträger sitzend, weich gepolstert mit einem Kissen, ging es auf dem Rad stadtauswärts, durch Birken bestandene Wiesen dem kleinen Haus der Großeltern zu. Liebevoll hielt Kathi die Großmutter umklammert, des Öfteren mit Nachdruck von ihr ermahnt, ja die Beine weit abzuspreizen. Entlang des düsteren schwarzen Waldstückes begann die Großmutter dann vorne auf ihrem Rad zu singen und vertrieb mit Mägdelein unter Holderbüschen und Königskindern,die nicht zusammen kommen konnten, alle Waldgeister und schrecklichen Räuber und sorgte somit dafür, dass sie unbeschadet das Dunkel hinter sich lassen, in den Hohlweg einbiegen und nach dem Aufstieg über den Hügel, mit frohem Lachen vor der Gartentür vom Rad springen konnten.
Während der Sommermonate, die Katharina einige Jahre in Kitzensberg in der Nähe von Isny liegend verbrachte, war das Haus meist übervoll mit Tanten und Basen und Vettern. Von den elf geborenen Kindern waren acht am Leben geblieben, fünf Töchter und drei Söhne. Die Tanten waren die wichtigen Instanzen. Sie hatten, außer der Lieblingstante Antonie, alle in die nähere Umgebung geheiratet und suchten nun, von ihren Männern durch Krieg und Gefangenschaft verlassen, Zuspruch und Hilfe im elterlichen Haus. Wie es der kleinen Gemeinschaft möglich war, sich über die Hungerjahre zu retten, blieb Kathi verborgen. Sicher ist nur, hier hatte sie genug zu essen, wenn auch nicht immer das, was ihr das Wasser im Munde fließen machte, und es gehörte zu ihren liebsten Sommergedanken, mit der Großmutter gegen Abend an die Beerenbüsche zu gehen, einen kleinen Eimer voll zu „brocken“, wie sie es nannte, und mit den anderen am blanken Holztisch vor dem Hause sitzend, die säuerlichen, roten Kügelchen in Milch schwimmend zu verzehren.
Nicht immer ging es friedlich zu in dem voll belegten Haus. Fühlte sich eine der Tanten benachteiligt, so machte sie sich Luft und da die starke Großmutter auch starke Töchter herangezogen hatte, zogen sich solche Auseinandersetzungen lautstark in die Länge. Gründe gab es mehr als genug in einer Zeit des Mangels. Da durfte nur eines der Kinder verbotenerweise sich eine noch nicht reife Spalierbirne abgepflückt haben, schon wurde dies als Beweis für die Unfähigkeit zur richtigen Erziehung gesehen, anstatt es der Gier der hungrigen Mägen zuzusprechen.
Katharina hatte schnell ihre Lieblingstante gefunden und diese sie. Später konnte Kathi sich diese Zuneigung gut erklären, hatte Tante Antonie doch nur zwei Jungen und keine Tochter. Toni, wie sie gerufen wurde, lebte mit ihrer Familie im Haus der Großeltern, in den unteren Räumen.
Der Großvater und Onkel Hans mussten, aus nicht bekannten Gründen, nicht in den Krieg ziehen, der den Kindern ansonsten als Väterverschlinger präsent war. Onkel Hans, freundlich, sanft und gerecht, gehörte Kathis Zuneigung. Hier gab es ein männliches Wesen, das immerfort greifbar war und blieb, und sich nicht wie der eigene Vater nach jährlich einmaligen, emotional turbulenten Aufenthalten, in Luft auflöste. Auch er arbeitete auswärts, in einem kleinen Schreinerbetrieb, hatte aber nach Feierabend in seiner eigenen Werkstatt für die Bauersleute der umliegenden Höfe manches zu tun.
Читать дальше