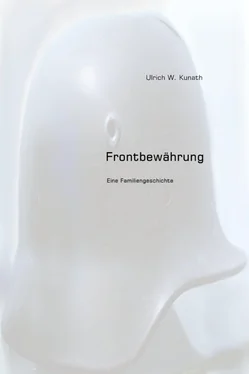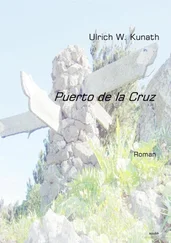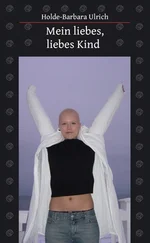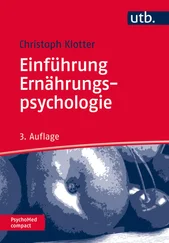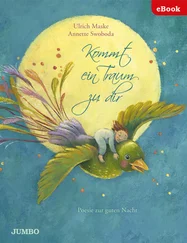Vom Glanz der ehemaligen Königsstadt hat Helmut nichts mehr gesehen und kaum etwas wiedererkannt, als er nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch einmal ins ehemalige Ostpreußen und nach Königsberg gereist ist. Heute russisch Kaliningrad, umgeben von Litauen und Polen und dadurch von Russland getrennt. Auch das Schloss, in dem sich einst ein Kurfürst selbst zum König krönte, zum König in Preußen, als Friedrich I., im Januar 1701, in dessen riesigem Hof Freilichtaufführungen stattfanden, dieses Stamm-schloss der Hohenzollern in Preußen existiert nicht mehr, seine Trümmer sind abgeräumt.
Ob es ihn berührt hat, dass aus seiner Heimatstadt eine russische Stadt geworden ist, ließ er sich nicht anmerken. Dazu verlor er kein Wort. Darauf angesprochen, hätte er es mit einer wegwerfenden Handbewegung abgetan. So war er eben. Über Gefühle redet man nicht!
1925 jedenfalls ist für den Sechzehnjährigen der Schulweg keine tägliche Pflichtübung mehr. Es ist Schluss mit dem Auswendiglernen von Geschichtszahlen, wer wann wo geboren ist oder welche Schlacht wann wo geschlagen wurde. Das hat er sich nie merken können und ihm den Spaß an Geschichte gründlich verdorben. Den Weg soll jetzt ruhig seine jüngere Schwester Elsa nehmen, die in die Königin-Luise-Schule geht, noch bis März 1928. Sie ist ein braves Mädchen. Mit ihr sind die Eltern immer zufrieden. Kein Foto, auf dem sie nicht freundlich und gewinnend lächelt.
Schon beim ersten Mal, 1916 war es, als Vater Franz einen professionellen Fotografen kommen ließ, um von den drei Kindern hinter dem Haus im Garten ein Lichtbild machen zu lassen. Man geht ja mit der Zeit. Der Mann schleppte dann auch einen immerhin fortschrittlichen Apparat heran, vermutlich eine Nettel-Deckrullo-Plattenkamera, arrangierte die drei im Sonnenlicht, so dass sie sich bei verhältnismäßig kurzer Belichtungszeit nicht lange ruhig zu halten brauchten und schob die Glasplattenkassette ein. Da sitzt das fünfjährige Mädchen mit baumelnden Beinchen auf einem Stuhl zwischen den Jungen, die in Matrosenanzügen mit Kniehosen dastehen. Ein eingefangener Moment, aber bezeichnend für das ganze Leben. Der Älteste hält seine Arme auf dem Rücken verschränkt und den Kopf leicht seitlich geneigt, so wie er es später immer tat, im privaten wie im beruflichen Leben, die er wohl nicht trennen konnte, jedenfalls blieb er – allen Umständen zum Trotz – immer der dozierende Studienrat. Gleichmütig und wie in Gedanken schaut er auf dem Foto drein, dabei konnte er als Erwachsener unverhofft jähzornig werden. Helmut, einen Fuß vorgesetzt, die Hände nur momentan untätig, wirkt wie dahin gestellt und auf dem Sprung, möglichst schnell wieder wegzukommen. Die Schwester hat die Hände im Schoß gefaltet, Spucklocken an den Schläfen und bauschige Schleifen oben an den Zöpfen. Sie allein lächelt.
Nicht so an jenem Wintertag, als sie ihrem Bruder Helmut auf den Schlossteich folgte. Der war zugefroren, aber das Eis trug mal gerade so. Sie nannten das Wuchteis, das heißt, wenn sie darüber liefen, hob und senkte sich das Eis noch wie eine große Welle. Es brach nicht, war aber noch elastisch. Helmut wollte dort Schlitt-schuh laufen, sie nur so schurgeln, über die Eisfläche hingleiten. Lange stehen bleiben durfte man ja nicht, dann bog sich das Eis immer weiter und konnte brechen. Die Schwester erst hinter ihm her, und mit einem Mal läuft sie weg, muss da unter die Brücke runterkriechen, hat dort wohl irgendwas gesehen. Aber da ist eine Blänke, eine ganz dünne Eisschicht, und schon liegt sie im Wasser. Und Helmut, ohne sich zu besinnen, er hatte damals schon schwimmen gelernt, er also ohne sich zu besinnen, mit Schlittschuhen an den Füßen, Mantel am Körper, in das Wasser rein, zieht die Marjell heraus. Aber bei ihm geht das nicht so leicht. Sie hat er ja noch raufschubsen können. Wenn er sich aber aufstützt, bricht die Eis-kante immer wieder ab. Das dauert eine ganze Weile, bis er endlich wieder etwas festeres Eis zu fassen bekommt. Und da steht die Schwester auf dem Eis und brüllt und friert.
Ihm fällt nichts Besseres ein, als ihr links und rechts ein paar auf die Ohren zu hauen. ‚Los, komm nach Haus!’ schreit er und eilt zu einer Taxe, damals noch Pferdedroschke, und sagt: ‚Bringen Sie uns bitte nach Hause.‘ Der Taxler merkt gar nicht, wie nass die Beiden sind, die sich da aufs blausamtene Polster setzen und mit Nässe durchtränken. Erst als die Mutter, die ist gerade alleine zu Hause, bezahlt, sagt der Droschkenfahrer: ‚Oh, die Kinder haben ja die ganze Taxe voll Wasser gemacht!' Na, sie bekommen statt einer Tracht Prügel, weil sie ja noch am Leben sind, feine Kachlinskes, gebraten aus dem Teig gekochter Kartoffeln, und werden ins Bett gesteckt.
Von seinem Großonkel Gustav aus Preußisch-Holland, bei dem seine verwaiste Mutter ihre Kindheit verbracht hatte, erhielt Helmut für seine mutige Tat dreitausend Mark Belohnung, eine stolze Summe zur damaligen Zeit. Onkel Gustav konnte sich das leisten, besaß ein Hotel mit Ausspann. Es gab ja noch keine Autos, und so brauchte man auch noch keine Parkplätze. Dafür musste ein Hotel einen Ausspann vorhalten, wo die Pferde eingestellt und gefüttert wurden. Die Wagen blieben auf der Straße stehen.
Bei Onkel Gustav, eigentlich Großonkel Gustav, verbrachten sie häufig ihre Sommerferien und gingen in der Weeske baden. Und als kleiner Steppke, konnte gerade mal gut laufen, aber hatte noch nicht schwimmen gelernt, nahm Helmut schon damals den Mund voll, kam ja aus der Großstadt, und pulsterte sich vor der Dorfjugend auf, er könne schwimmen. Na, die zögerten nicht lange, packten ihn an Arm und Bein und wollten seine Schwimmkünste bestaunen, hatten dann aber ein Einsehen, als er viel Wasser schluckte und japste, und holten ihn wieder heraus, schlugen ihm auf den Rücken und grinsten: ‚Siehste, jez ham wer jesehen, wie du schwimmen kannst.‘
Da hätte er seiner Schwester im Grunde nicht böse sein dürfen, als die ins Wasser fiel.
Jedenfalls ging sein Belobigungsvermögen in der Inflation zum Teufel. Damals, nach dem Ersten Weltkrieg, war der deutsche Staat derart enorm verschuldet, dass einfach mehr Geld gedruckt werden musste. Woraufhin die Preise explodierten, die Löhne und der Lebensstandard abstürzten, die Sparguthaben verpufften. 1922/23 erschienen innerhalb weniger Monate Geldscheine mit Beträgen über eine Million, eine Milliarde und schließlich sogar über eine Billion Mark. Für Münzgeld gab es nichts mehr zu kaufen. Ein Kilo Brot kostete von Woche zu Woche Millionen und am Ende über 500 Milliarden Mark. Im Handumdrehen wurde auch Helmuts Geld wertlos. Fein raus waren nur die Leute, die Sachwerte besaßen und Schulden hatten. Wer arbeitete, ließ sich seinen Lohn täglich auszahlen, hetzte in die Geschäfte, um der nächsten Preissteigerung zuvorzukommen. Pausenlos wurde Geld nachgedruckt. Erstmals lohnte es sich nicht mehr für Räuber, Geldtransporte zu überfallen. Dafür hatte der Staat im Nu einen Großteil seiner Schulden bei den Bürgern, die Kriegsanleihen, getilgt. Die Siegermächte senkten daraufhin, im eigenen Interesse, die jährliche Schuldenrate. Es waren wohl über hundert Milliarden Goldmark, die in zweiundvierzig Jahren gezahlt werden sollten, bis 1965.
Aber dann kam die Währungsreform, und aus einer Billion Infla-tionsmark wurde eine Rentenmark, ein Jahr später die Reichsmark. Der wirtschaftliche Aufschwung brachte ihnen die ‚Goldenen Zwanziger Jahre‘, bis zum Schwarzen Freitag, dem 25. Oktober 1929. Ende, Kursverfall, Verkaufspanik, Abzug des investierten Geldes, Zusammenbruch von Banken und Unternehmen, eingeschränkte Produktion, Arbeiter entlassen. Wieder war der kleine Mann um sein Geld betrogen, niemand wollte mehr sein Geld einer Bank anvertrauen. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 6 Millionen an. Das war im Winter 1932/33. Da waren die drei Geschwister, die fast zwanzig Jahre unter einem Dach verbracht hatten, bereits erwachsen. Der Zusammenhang muss eher als locker statt innig bezeich-net werden. Sie nahmen aneinander so wenig teil wie Geschwister zu allen Zeiten, wie die meisten, die nicht einmal am Grab das Versäumte bedauern. Was weiß der eine vom anderen? Gewiss, in jungen Jahren unternahmen die beiden Brüder noch recht viel gemeinsam. Dann studierte der Ältere, lernte ja leicht, war dabei nicht übermäßig ehrgeizig, nicht ungesellig, gehörte sogar einer schlagenden studentischen Verbindung an, besaß auch einen hintergründigen, manchmal bissigen Humor. Doch mit seinem Stu-dium lockerte sich der Kontakt zum Bruder Helmut für viele Jahre, bis sie sich im Alter wieder ein bisschen näher kamen. Nicht wirklich nah, weil sich Helmut, der pfiffige, gesellige, praktisch veranlagte gegenüber dem wenig zugänglichen, doktrinären, un-flexiblen Bruder, der zwar sehr belesen und ein Sammlertyp war – vorzugsweise Heraldik, also Wappenbilder – überlegen gab.
Читать дальше