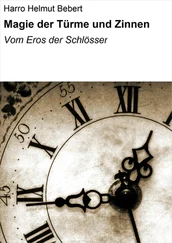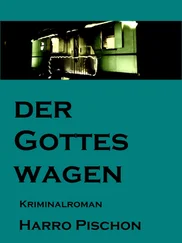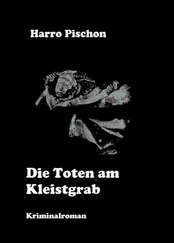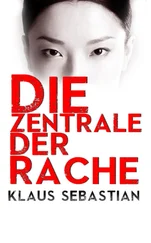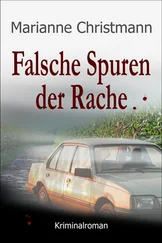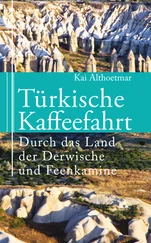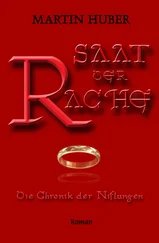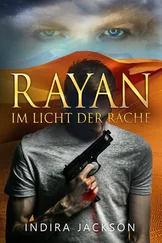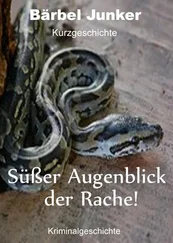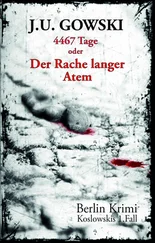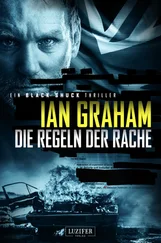Die Frage nach dem Todeszeitpunkt wehrte der Forensiker ab. „Waßt eh, Obduktion abwarten. Der hot im kalten Wasser gelegen. Nach dem Zustand der Leiche tät ich sagen, vielleicht zwei, drei Tage.“
Beierlein zückte sein Notizbuch und schrieb die bekannten Fakten auf, dazu die Statur von Tennstedt, schlank, athletisch, etwa 180 cm groß, gut gekleidet, teurer hellgrauer Anzug, blaue Seidenkrawatte, vermutlich handgefertigte schwarze Schuhe.
Die beiden Beamten wies Beierlein an, in der Nachbarschaft zu fragen, ob den Toten jemand kenne oder gesehen habe. „Ich geh a nu amol rum, merkt euch, wo ihr schon wart, damit wir nicht zweimal die Leute fragen. Ich ruf auf eurer Wache an.“
„In der Saarbrückener, am Friedhof!“, erklärten die beiden. Beierlein winkte ab, das wusste er eh.
Er verzichtete darauf, seinen Vater zu besuchen, es gab zuviel zu tun. Otto Beierlein hatte noch aus Vorkriegszeiten ein Fahrrad mit Hilfsmotor, mit dem er durch sein Viertel knatterte, mal zum Einkaufen, mal auf eine Halbe. Gern verbrachte er den Abend in seinem Gärtchen. Er war allein, die Mutter war 1943 bei einem Luftangriff umgekommen, als sie in der Altstadt ihre Cousine besuchte. Sie lag auf dem Südfriedhof und war ein weiteres Ziel von Otto, der täglich am Grab stand und mit ihr redete.
Beierlein fuhr ins Präsidium und redete mit Schwarz. Der empfahl ihm, den ehemaligen Fürther Flughafen in Atzenhofen aufzusuchen, auch der Werksflugplatz der BBF, der Bachmann, von Blumenthal & Co Flugzeugbau auf der Hardhöhe, könnte vielversprechend sein. Überall saßen jetzt ja die Amerikaner, sodass es am besten sei, hinzufahren und jemand zu finden, der genug Deutsch sprach. „Mitm Motorradl kommst ja überall hin“, lächelte Schwarz sardonisch, „am besten glei morgen in der Früh.“
So kam es, dass Beierlein nach Dienstschluss mit dem Motorrad nach Hause fuhr. Er schlug vor noch auf die Wöhrder Wiese ins Freibad zu fahren. Gerda könnte auf der Wiese sitzen und zuschauen, wie er schwomm. Vor allem wäre sie im Beiwagen völlig sicher. Erstaunlicherweise stimmte sie zu, packte ein paar Sachen und sie fuhren am späten Nachmittag los.
Im Januar 1942 gründen wir die FPO, die Farejnikte Partizaner Organizazia. Geführt wurde sie von Isaak Wittenberg, einem Kommunisten mit Verbindungen nach Moskau. Vor dem Krieg waren wir Zionisten seine – reaktionären – Feinde. Jetzt war ihm jedes Mittel recht, gegen die Faschisten zu kämpfen. Wir – Wittenberg, Josef Glassmann von der Betar und ich – treffen uns im Ghetto. Wir beschließen, alle Gegensätze und Utopien beiseitezulassen und nur zusammen die deutsche Kriegsmaschinerie zu bekämpfen.
„Hitler hat endlich ein Volk aus uns gemacht“, sage ich zum Abschluss.
Nach drei Wochen erreicht uns die erste Waffenlieferung. Ein jüdischer Kommunist arbeitet für die Wasserwerke, er erkundet die Abwasserkanäle und kann eine Holzkiste mit Gewehren ins Ghetto bringen. Danach fertigt er Karten an. Er schickt andere jüdische Soldaten in die Kanalisation, damit sie jeden Kanaldeckel und jedes Abflussrohr vermerken. Manche verirren sich, ertrinken oder verschwinden spurlos. Aber nach allen wird gesucht, denn eine Leiche kann einen Abfluss blockieren.
Eines Nachmittags kommt eine unscheinbare Frau durch das Ghettotor. Sie geht zu unserer Wohnung. „Mutter Oberin“, sage ich, „was machen Sie hier? Es ist gefährlich!“
Sie greift in ihre Hose und holt drei Eierhandgranaten heraus. „Ich habe gehört, ihr wollt kämpfen. Ich will euch helfen.“
So kommen Waffen aus den verschiedensten Quellen, teils einzeln, manchmal eine ganze Kiste. In der Bibliothek im Ghetto entdecken wir eine finnische Schrift zur Guerillataktik. Ruzka übersetzt mit einem Wörterbuch ins Polnische und so wir können billige und wirkungsvolle Bomben bauen.
Ich trainiere mehrmals pro Woche mit den jungen Kämpfern aus dem Untergrund, oft nur mit einer Pistole, die von Hand zu Hand wandert. Sogar die Kugeln kratzen wir aus der Mauer, ob man sie noch einmal verwenden kann.
Im Juli schicke ich Vitka zu einem Sabotageakt – wohl dem ersten im besetzten Europa. Nach einigen Nächten findet sie eine Stelle, um einen Zug von einer Brücke stürzen zu lassen. Sie legte eine Bombe auf eine Holzbrücke. Die Lokomotive fällt in die Schlucht. Die Rebellen werfen selbstgebaute Handgranaten auf die Soldaten im Zug. Eine Partisanin stirbt dabei und wird begraben. Danach lobt Wittenberg Vitka: „Du bist sehr tapfer.“ Später erfahre ich, dass die Deutschen davon ausgingen, polnische Partisanen hätten den Transport in die Luft gejagt. Über zweihundert deutsche Soldaten seien getötet worden. Die SS sei danach in eine polnische Ortschaft in der Nähe marschiert und habe sechzig Bauern erschossen.
1942 beginnen die sogenannten „Kultivierten Tage“. Es gibt wenige Übergriffe der SS auf das Ghetto. Jakob Gens lässt die alte Wilnaer Tradition des jüdischen Theaters wieder aufleben und veranlasst die Gründung einer Theatergruppe. „Von Mauern umgeben und dennoch jung“ steht über dem Eingang. Gens ist immer noch der Kommunalpolitiker, der von den täglichen Realitäten ausgeht. Er hofft und vertraut auf ein Überleben im Ghetto: „Wir können nur viele retten, wenn wir wenige opfern“, ist einer seiner Sprüche. Am Eröffnungsabend verteilen Mitglieder des Untergrunds Flugblätter mit der Überschrift: „Theateraufführungen sollten nicht auf Friedhöfen stattfinden“.
Darunter steht mein Aufruf:
„Im Angesicht des morgigen Tags, der uns wieder den Schrecken von Deportation und Mord bringen wird, ist es an der Zeit, die Illusionen zu begraben. Aus dem Ghetto gibt es kein Entrinnen, es sei denn durch den Tod. Illusionen erschüttern doch nur unsere Einheit im Angesicht des Todes. Vor unseren Augen haben sie unsere Mütter, unsere Väter und Geschwister fortgeführt – nun ist es genug!“
Gens antwortet im „Ghetto-Anzeiger“:
„Wir wollten den Menschen eine Möglichkeit geben, sich für wenige Stunden aus dem Ghetto zu befreien, und das ist uns auch gelungen. Wir leben in finsteren, schweren Zeiten. Unsere Körper sind hier, in diesem Ghetto eingesperrt, aber unsere Gedanken sind frei. Auf Friedhöfen dürfen keine Konzerte stattfinden, hieß es. Das ist wahr, aber unser ganzes Leben ist zum Friedhof geworden. Wir müssen körperlich und seelisch stark bleiben.“
Im Februar 1943 erfahren wir von der Kapitulation der Deutschen in Stalingrad. Abertausende deutscher Soldaten waren gefallen oder in Gefangenschaft. War es jetzt nur eine Frage der Zeit, bis die Rote Armee Wilna erreichte? Gens denkt nicht vom Plan der Vernichtung der Juden her, er denkt an eine mögliche Niederlage der Deutschen, an das Verlassen des Ghettos. Er appelliert, all das zu ertragen und menschlich zu bleiben, der „großen Zukunft des jüdischen Volkes zuliebe“.
Wir hören im Untergrund Radio, vor allem den Untergrundsender SWIT, den die Deutschen verzweifelt suchen, aber nicht finden. Im April 1943 hören wir vom Aufstand im Warschauer Ghetto. Unsere Kämpfer sind begeistert.
Damit enden auch die „kultivierten Tage“. Als erstes macht die SS ein Angebot der „Umsiedlung“ ins Ghetto von Kovno. 360 Juden sind dazu bereit. Wo landen sie? Nicht in Kovno, sondern in Ponar, wo sie sich wehren und mit Maschinengewehren erschossen werden.
Gens ist jetzt offiziell Leiter des Ghettos, was er faktisch schon vorher war. Murer lässt ihn gewähren. Er hat einen diensteifrigen Polizeichef und nun eine Art Bürgermeister. Er hält sich streng an seine Vorschriften.
„Die Basis unserer Existenz ist Arbeit, Disziplin und Ordnung“, erklärt er. „Wir können keine Leute unter uns dulden, die sich vor der Arbeit drücken, aufsässig werden oder gegen Regeln verstoßen.“ Er lässt sechs Juden hinrichten, die andere Juden ermordet hatten. „Sechzehntausend von den fünfundsiebzigtausend Wilnaer Juden haben überlebt“, sagt er vor dem Galgen. „Diese sechzehntausend müssen brav, ehrlich und fleißig sein.“
Читать дальше