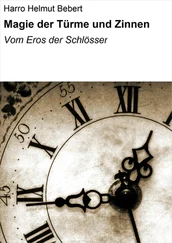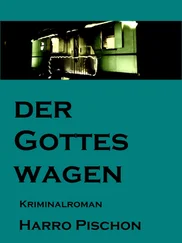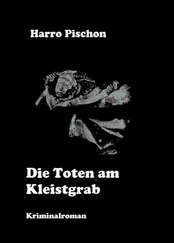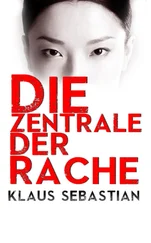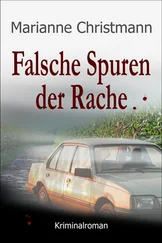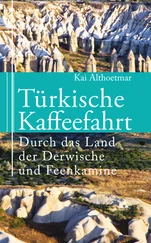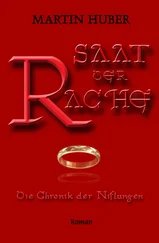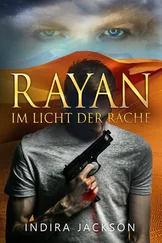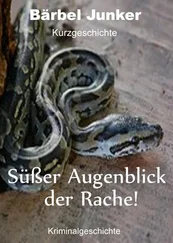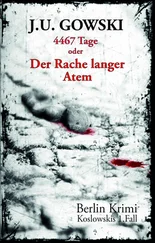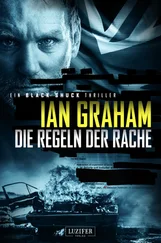Er ging an der Ruine der Jakobskirche vorbei in die Jakobstraße. Die Abkürzung durch die Zirkelschmiedgasse war nicht begehbar, sodass er durch die Färberstraße laufen musste, immer in der Mitte, manchmal einem Jeep ausweichend. Er freute sich auf das Kind, obwohl ihm seine Ehe nicht mehr geheuer war. Gerda war einerseits ängstlich und überbesorgt, was seine Gesundheit und sein Leben anging, andererseits hatte sie ihm oft heftige Vorwürfe gemacht, dass er nicht seine Karriere befördert hatte, dass er sich geweigert hatte, in die Partei einzutreten, dass ihn einige Kollegen denunziert und angeschwärzt hatten. Er war nie über den einfachen Kommissar hinausgekommen, hätte von seiner Erfahrung her ohne weiteres Kriminaldirektor sein können. Einen gottverlassenen Dickschädel hatte sie ihn genannt, der nicht an sie und ihr Leben denke.
Durch die Kolpinggasse lief er zum Frauentor und über eine schmale Fußgängerbrücke über den Stadtgraben, an der Oper vorbei durch den Tafelfeldtunnel unter den Bahngleisen hindurch. Die Tafelfeldstraße musste er ein ganzes Stück nach Süden laufen. Hier waren die Zerstörungen noch groß, die Nähe zum Bahnhof und den Gleisen war verheerend. In seiner Straße, der Humboldtstraße in der Südstadt, standen noch mehrere Häuser, auch das, in dem er mit Gerda wohnte. Er hätte auch vom Plärrer aus übers Opernhaus mit der Straßenbahn bis zur Christuskirche fahren können. Aber heute wollte er nachdenken.
Seit Gerda schwanger war, wandte sie sich noch mehr von ihm ab und konzentrierte sich ganz auf das Wesen, das in ihr wuchs, lief oft zu dem kleinen Park am Kopernikusplatz oder auch zum Aufsessplatz, setzte sich in den Schatten und schaute den Aufräumarbeiten zu. Oft musste sie sich gehässiger Kommentaren erwehren, denn noch sah man nicht viel von ihrer Schwangerschaft.
Als Beierlein die Tür aufschloss, rief Gerda: „Heinz, bist du's?“ Er bejahte und sie kam ihm in den Flur entgegen, die Hände schützend auf den Bauch gelegt. Sie hielt ihm die Wange für einen Begrüßungskuss hin. „Mogst a Brod?“, fragte sie. „Na“, meinte er, „a Bier is mir lieber.“ Gerda schüttelte den Kopf: „Musst du dir holen, mir hom kans mehr.“ Beierlein nahm seinen Rucksack ab, öffnete ihn und zog eine Flasche Bier heraus. „Scho bassiert!“ Er ließ den Bügelverschluss knallen, was ihm einen missbilligenden Blick seiner Gattin einbrachte und trank genüsslich, während sie in die Küche gingen.
Später aßen sie noch eine Scheibe Brot mit Sauerrahm und Schnittlauch, Gerda häkelte an einem Strampler und Heinz saß mit einem Buch am offenen Fenster. Er las in einer 1943 erschienenen Novelle von Stefan Andres „Wir sind Utopia“, einer Geschichte aus dem spanischen Bürgerkrieg. Heinz wusste nichts davon, er kannte nur die Propaganda über die Legion Condor. So las er mit Interesse und Verwunderung von den republikanischen Gräueltaten und von Schuld und Sühne eines ehemaligen Mönches, der bei den Franquisten gelandet war, denen Hitler und Mussolini geholfen hatten.
„Da-tock, da-tock, da-tock, da-tock“, Beierlein hörte verwundert, wie sich Rackel am Vormittag seinem Zimmer näherte. Seine Beinprothese war für den Rhythmus verantwortlich. Auftakt auf der vier und, schoss es ihm durch den Kopf. Er hatte früher Klavier gelernt, sein Vater hatte ein Klavier geerbt und ihn angehalten, spielen zu lernen. Er selbst wollte nie Klavier spielen. Vater war Proletarier, Kranführer bei der MAN. „Meine Hände sind für so etwas nicht gemacht“, sagte er oft. Rackel riss die Tür auf und sagte atemlos: „Beierlein, zum Chef, sofort! Es ist dringend!“ Ein Haustelefon funktionierte noch nicht. So wurden Nachrichten per Boten weitergegeben, schriftlich, wenn nötig.
Als Rackel weitergehumpelt war, machte sich Beierlein auf den Weg zu Giselher Schwarz, dem Kriminaldirektor. Der hatte ihn ein paarmal in den vergangenen tausend Jahren bei der Gestapo herausgehauen, nachdem ihn zum Beispiel ein neidischer Kollege angeschwärzt hatte. Im Gegensatz zu Beierlein war Schwarz Parteimitglied gewesen, um seiner Laufbahn nicht zu schaden. Diesen Schritt hatte Beierlein nie vollzogen. Aber Schwarz konnte im Zuge seiner Entnazifizierung nachweisen, dass er keine Verbrechen begangen oder unterstützt hatte. Beierlein hatte auch für ihn ausgesagt. Seitdem duzten sie sich.
„Heinz, mir hom a Leich“, begrüßte ihn Schwarz. „Am Kanal, Schleuse 71, bei der Saarbrückener Straß. Fahr halt amal hin. Die Schupo ist vor Ort.“ „Und womit?“, fragte Beierlein. „Wennst kan Holzgaswagen willst, musst du mit'm Motorrad fahrn. Privat hast ja ka Auto, wenn i richtig informiert bin.“ „Na, hob i net“, antwortete Beierlein, „und was kommt, is ka Auto, sondern a Kind.“ „Wann isses denn soweit“, fragte Schwarz. „Na, so an Weihnachten“, meinte Beierlein. „Ja, jeder hat seine Prioritäten“, lächelte Schwarz, „und denk gor net dran, mein Olympia haben zu wollen.“ Er war stolzer Besitzer eines Opel Olympia, Baujahr 1938, den er vor der Beschlagnahme gerettet hatte, aus „dienstlichen Gründen“.
Beierlein ließ sich von der Fahrbereitschaft Schlüssel und Helm für ein Motorrad mit Beiwagen geben. Sein Kriminalassistent Caspary war krankgeschrieben, er war zusammengebrochen, nachdem er seiner Frau offenbart hatte, dass er als in Polen abgestellter Polizeibeamter Kriegsverbrechen miterleben und mit zu verantworten hatte. Sie hatte ihn mit seinem Kind verlassen. Er war nun schon mehrere Monate in der Psychiatrie. Beierlein startete das Motorrad und fuhr am Stadtgraben entlang zum Hauptbahnhof, unterquerte die Gleise und fuhr durch die Pillenreuther Straße, querte seine Humboldtstraße, vorbei am Annapark und der Martin-Luther-Schule bis zum Hasenbuck. An diesem Hügel war Beierlein zum ersten Mal Schlitten gefahren. Über die notdürftig reparierte Brücke über den Rangierbahnhof kam er in die Gartenstadt, einem Siedlungsprojekt mit Wohnungen und Gärtchen hinter dem Haus. Hier, in der Pachelbelstraße, wohnte sein Vater. Er war nicht nur zu alt gewesen für einen Militäreinsatz, sondern auch schwerbehindert seit einem Unfall mit seinem Kran, bei dem er ein Bein verloren hatte. Als er am Südfriedhof vorbeibrauste, dachte Beierlein, dass er ihn besuchen sollte, auf dem Heimweg.
Am Ende der Saarbrückener Straße sah er schon die Absperrung der uniformierten Kollegen und stellte sein Motorrad ab. Er lief ein paar Meter bis zum Ludwigskanal. An der Schleuse stand das Schleusenwärterhäuschen, aber Schiffe fuhren schon lange nicht mehr auf dem bedeutungslos gewordenen Kanal. Außerdem hatten irrtümliche Bombentreffer den Kanal in Richtung Bamberg teilweise verschüttet. Aber die Schleuse 71 war intakt. Neben der Schleusenkammer stand ein schnell aufgebautes Zelt, das den Leichnam vor der gnadenlosen Sonne schützen sollte. Vor dem Zelt standen zwei Polizisten und der Gerichtsmediziner. Beierlein stellte sich vor, zeigte seine Marke. „Gibt es schon Erkenntnisse?“, fragte er.
„Nun, der Tote lag in der Schleusenkammer“, begann der Gerichtsmediziner.
„Wer hat die Leiche entdeckt?“
„Ja, a Kind leider, das übern Steg gelaufen ist und ins Wasser gschaut hat“, seufzte ein Polizist. „Es is hamglaufn und hat seine Eldern benachrichtigt.“
„Todesursache?“
„Wahrscheinlich Ertrinken, aber voraus ging ein heftiger Schlag mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Hinterkopf. Der Mann war wohl ohne Bewusstsein, als man ihn ins Wasser warf.“
„Irgendwelche Blutspuren im Schleusenbereich?“
Die Polizeibeamten schüttelten ihre Köpfe. „Mir hom alles abgsucht. Den habens woanders derschlogen.“
„Aber“, machte einer der beiden auf sich aufmerksam, „mir hom an Führerschein gfundn.“ Er reichte Beierlein den in Papier eingewickelten Ausweis, der völlig durchweicht war. Beierlein zog seine Baumwollhandschuhe an und schaute sich das Papier an. Es war ein Luftwaffenflugzeugführerschein, ausgestellt 1940, mit den Beförderungen bis zum Oberleutnant und verschiedenen Flugmustern, Me 109, Me 110 und, Beierlein pfiff durch die Zähne, der Me 262, dem Strahlflugzeug der Luftwaffe. Der Name war Robert Tennstedt. „Auch kein fränkischer Name“, dachte Beierlein und schaute nach dem Geburtsort: Lüneburg. Ein Nordlicht also. Aber eine Adresse war dem Ausweis nicht zu entnehmen. Dann musste er die Fliegerhorste abklappern, zunächst einmal die nahe gelegenen. Er fürchtete, Flugplätze, von denen der Düsenjäger gestartet war, seien weiter weg gewesen. Er hatte keine Ahnung, wen er fragen könnte. Aber er wusste, dass am Marienberg ein Flugplatz existierte, der allerdings weitgehend zerstört war. Sein Vorläufer als Flughafen war in Atzenhof bei Fürth, außerdem gab es noch den Fliegerhorst Roth. Die Amerikaner benutzten keinen der Flugplätze, ihre Maschinen landeten auf der Großen Straße beim ehemaligen Reichsparteitagsgelände.
Читать дальше