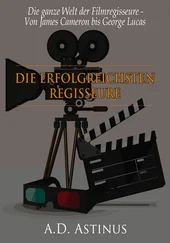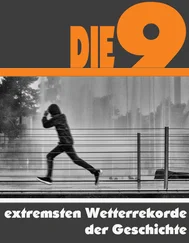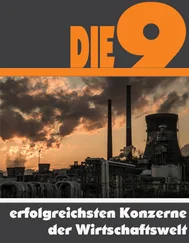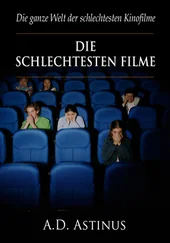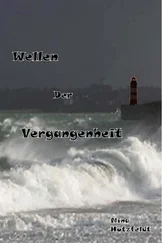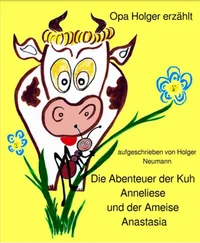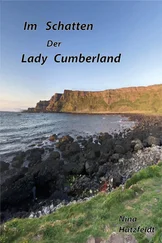Zu beachten ist weiterhin, dass Leistungen zur Teilhabe nur dann erbracht werden können, wenn prognostiziert wird, dass sich dadurch der aktuelle Gesundheitszustand und die Teilhabesituation verbessern lassen. In jedem Fall gilt das Prinzip „Reha vor Rente“. Wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die Rehabilitation bieten kann, doch noch eine Beeinträchtigung verbleibt, ist in Abhängigkeit von deren Ausprägung ggf. eine Rente zu zahlen.
Wichtig also ist zunächst festzuhalten, dass mit Rehabilitation der Prozess gemeint ist, der notwendig ist, um selbstbestimmte Teilhabe herzustellen und zu sichern, dass die damit verbundenen Leistungen zur Teilhabe allen behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen zustehen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention
Eine wichtige Rolle im Kontext der Rehabilitation stellt das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen (UN-BRK) dar.
Die UN-BRK fordert eine Gesellschaft, in der es selbstverständlich ist, dass Menschen mit Behinderung die gleichen unveräußerlichen Rechte wie alle anderen Menschen genießen. Allem voran gehört die gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung in freier Entfaltung dazu.
Noch im ausgehenden 20. Jahrhundert wurden Menschen mit Behinderung als, Behinderte, Schwer- oder Schwerstbehinderte bezeichnet und im Sinne einer umfassenden Fürsorge fremdbestimmt und entmündigt. Nicht selten wurden Menschen mit Behinderungen ungeachtet ihrer tatsächlichen Beeinträchtigungen und vor allem ihrer Fähigkeiten in Heimen und Anstalten separiert. Das Führen eines selbstbestimmten Lebens wurde ihnen viel weniger zugetraut, als es eigentlich bei geeigneter Förderung möglich gewesen wäre.
Mit der Jahrtausendwende wurde diesbezüglich in Deutschland ein klarer Paradigmenwechsel eingeleitet. Mit Inkrafttreten des neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) am 1. Juli 2001 ist der Begriff der selbstbestimmten Teilhabe in die Sozialgesetze eingezogen. Durch die Ratifizierung der UN-BRK am 26. März 2009, die damit in den Rang eines einfachen Bundesgesetztes gehoben wurde, ist ein weiterer großer Schritt in Richtung gleichberechtigter Teilhabe für Menschen mit Behinderung getan worden. Am 16. Dezember 2016 wurde vom Deutschen Bundestag das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verabschiedet, das als Artikelgesetz eine Reihe der durch die UN-BRK aufgestellten Forderungen für die deutsche Sozialgesetzgebung konkretisiert.
Die UN-BRK definiert Behinderung in Artikel 1 Satz 2 wie folgt:
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.
In der Präambel der UN-BRK ist allgemein festgelegt:
„…dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht”. 10
Behinderung ist also keine Eigenschaft, die an einen Menschen gebunden ist, wie sein Alter, seine Hautfarbe oder sein Fingerabdruck. Behinderung ist vielmehr das Ergebnis einer Wechselwirkung von bestimmten Eigenschaften eines Menschen mit seiner Umwelt.
Eine Gesellschaft gestaltet ihre Umwelt in der Regel orientiert an bestimmten Normwerten. Da aber keine Norm alle Besonderheiten einzelner Individuen berücksichtigen kann, wird es immer Personen geben, für die die auf diese Weise gestalten Rahmenbedingungen ungeeignet sind. So werden Menschen, die über eine außergewöhnliche große Körperhöhe verfügen zum Beispiel ständig mit zu niedrigen Türen konfrontiert und können in Bussen, Bahnen und Flugzeugen kaum aufrecht stehen und gehen oder ergonomisch sitzen. Sie treffen also in unserer Umwelt ständig auf sogenannte Barrieren, die ihnen Probleme bereiten. Dies lässt sich auf andere besondere Merkmale und Eigenschaften übertragen. Denken wir nur an die Barrieren, denen hör- oder sehbeeinträchtige wie auch gehbeeinträchtige Menschen ausgesetzt sind. Die Behinderung entsteht dabei erst durch die Wechselwirkung mit der Umwelt. Wären Türen und Betten grundsätzlich 2,20 hoch bzw. lang, würde ein 2,10 Meter „großer“ Mensch wesentlich weniger behindert.
Für die Rehabilitation in Deutschland ist der Behinderungsbegriff maßgebend, wie er im §2 Abs. 1 SGB IX verankert ist. Dieser hat zum 1.1.2018 durch das BTHG eine Neuformulierung erfahren. Bislang galt folgene Definition:
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensjahr typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.
Mit dem BTHG wurde der Begriff der Behinderung dem Verständnis der UN-BRK entsprechend angepasst. Im Fokus steht nun nicht mehr ausschließlich die funktionelle Beeinträchtigung des Menschen und die dadurch verursachten Einschränkungen, sondern es werden die oben genannten Wechselwirkungen mit der Umwelt einbezogen. Menschen mit Behinderungen sind gemäß §2 Abs. 1 SGB IX (neu) demnach
Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.
Inklusion und Integration
Eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe, die sich durch all die genannten Neuerungen in der Gesetzgebung betont und die durch eine Reihe nationaler Aktionspläne gefördert wird, ist die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen in allen Bereichen des Lebens gleichberechtigte Teilhabe genießen.
Wichtig ist daher auch einen Blick auf die Bedeutung der Begriffe Inklusion und Integration, deren Beziehung zueinander und den Umgang damit zu werfen. Nach Einführung des Begriffes Inklusion wurde in hektisch wirkender Betriebsamkeit in vielen Kontexten bis in die Gesetzgebung hinein der Begriff Integration einfach nur durch den Begriff Inklusion ersetzt. Bei einer genauen Betrachtung sollte jedoch die Erkenntnis wachsen, dass beide Begriffe nebeneinander stehen können, ja sogar müssen.
Inklusion bezeichnet weniger einen Prozess sondern vielmehr einen idealtypischen Soll-Zustand. In einer vollständig inklusiven Gesellschaft gibt es keinerlei Barrieren mehr. Alle Menschen können in dieser Idealgesellschaft ungehindert an allem teilhaben. Es darf demnach in einer inklusiven Gesellschaft zum Beispiel keine – wie oben beschrieben – zu niedrigen Türen mehr geben oder auch keine Treppen, die für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität unüberwindbare Hindernisse darstellen. Alles muss auch für seh- und hörbeeinträchtigte Menschen gestaltet und sämtliche Informationen müssen in einfacher Sprache verfügbar sein, damit auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nicht benachteiligt werden. Bei der Vielzahl menschlicher Eigenschaften kann hier nur ein winziger Ausschnitt dessen aufgezählt werden, was alles notwendig wäre, um eine vollinklusive Gesellschaft zu schaffen. Es handelt sich realistisch betrachtet also um einen nicht erreichbaren Idealzustand.
Auch bei allen Anstrengungen Inklusion tatsächlich umfassend zu verwirklichen, wird es immer eine Zahl an Menschen geben, die aufgrund ihrer individuellen Beeinträchtigungen Barrieren erfahren und an ihrer Teilhabe gehindert werden. Hier ist die Gesellschaft gefordert, individuelle Maßnahmen bereit zu halten, mit deren Hilfe auch diesen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe ermöglicht wird. Je weniger inklusiv eine Gesellschaft ist, umso mehr bedarf es individueller Spezialmaßnahmen. Diese Spezialmaßnahmen lassen sich nach wie vor mit dem Begriff „Integration“ oder als „integrative Maßnahmen“ am besten beschreiben. Integration dient Einzelnen dort den Weg in eine inklusiv orientierte Gesellschaft zu finden, wo der Wandel zu einer inklusiven Gesellschaft noch nicht vollzogen ist oder Inklusion an ihre Grenzen stößt. Und diese Grenzen wird es immer geben.
Читать дальше