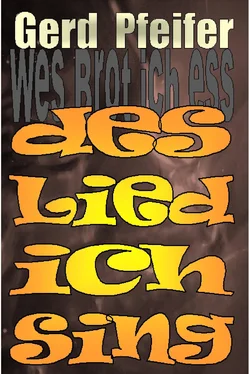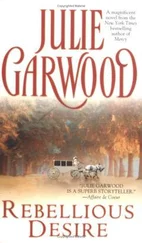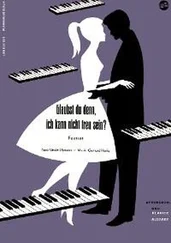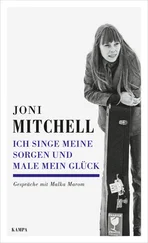Inzwischen hat er eine Sitzposition in der Wanne gefunden, die seinen schmerzenden Rücken entlastet. Noch ein letztes Mal lässt er heißes Wasser nachlaufen. Entspannt schließt er die Augen, verweilt behaglich an der Schwelle zwischen Schlaf und Wirklichkeit, auf seinen Lippen immer noch das gelassene Lächeln.
Es ist erstaunlich, wie genügsam die Wonnen des Alters werden. Noch in seiner Jugend fürchteten die Leute, in einer gefüllten Badewanne einzuschlafen. Er entsinnt sich der Mahnungen seiner Mutter, er könne träumend ertrinken. Es fasziniert ihn, wie schnell scheinbar gesichertes Wissen veraltet. Worüber die heutigen Generationen wohl in fünfzig Jahren belustigt lächeln werden? Vielleicht über das schwafelnde Gerede der gegenwärtig regierenden Politiker? Kein junger Mensch, der heute lebt, kann begreifen, wie halbwegs vernünftige Leute in den dreißiger und vierziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die geifernden Hetztiraden eines Adolf Hitler ernst nehmen konnten. Zugegeben, heute klingt das alles schwülstig, antiquiert und unglaubwürdig. Aber damals trafen begnadete Redner wie Goebbels oder der Führer aller Deutschen den Geist der Zeit. Die Leute waren begeistert. Und der leichtgläubige Pöbel ließ sich gern aufhetzen. Georg erlebte ihn hautnah.
Es geschah, nachdem er von einem Besuch seiner Eltern nach Berlin zurückgekehrt war. Zu seinem zwanzigsten Geburtstag – '... und in einem Jahr bist du volljährig und kannst auf eigenen Füßen stehen ...', hatte seine Mutter geschrieben – erhielt er zusammen mit den üblichen Glückwünschen die Mitteilung, dass sie endlich die richtige Immobilie für ihr Café gefunden habe. Die Gelegenheit sei derart günstig gewesen, dass sie das Gebäude sogar fast ohne Fremdmittel habe kaufen können. 'So hat sich die Wirtschaftskrise für deinen Vater und mich doch noch zu einem Segen entwickelt', schrieb sie.
Er war, sobald er ein paar freie Tage erhielt, nach Altona gefahren, um das Haus zu besichtigen und die Lage zu beurteilen. Er fühlte sich seinen Eltern inzwischen auch in fachlicher Hinsicht überlegen. Tatsächlich war er der Meinung, sie in letzter Minute vielleicht noch vor einem Fehlgriff bewahren zu müssen. Aber seine Befürchtungen erwiesen sich als grundlos:
Es handelte sich um ein schönes Eckhaus, das vor elf Jahren gebaut worden war und einem jüdischen Arzt gehörte, der mit seiner Familie ins Ausland wollte. Insoweit war es ein Notverkauf und entsprechend preisgünstig. Für einen flüchtigen Augenblick versetzte sich Georg in die Lage der Auswanderer und schätzte sich glücklich, dass sein Vater kein Jude war. Tiefere Gedanken machte er sich nicht. Viele Juden gingen außer Landes. Es war nicht ihre Zeit in Deutschland. Später unter einer anderen Regierung würde sich das wieder ändern. Dann wären es vielleicht die Katholiken oder die Kommunisten, der Adel, die Polen die Schurken aus den Schurkenstaaten, die Muslime, die Heuschrecken, die Besserverdienenden oder die Gastwirte, die Leute, die fliehen müssten. Neue Regierungen brauchen neue Opfer. Und niemand weiß, wen es das nächste Mal trifft. So ungewiss ist das Leben für die Leute draußen im Land; und das war nicht nur Georgs Meinung.
Aber das Haus, das seine Eltern gekauft hatten, versprach ein Stück sichere Zukunft. Es war beinahe ideal geeignet für die Realisierung der Pläne seiner Mutter. Das etwas erhöht liegende Erdgeschoss konnte mit einem modernen Glasvorbau in den breiten Garten zur Straße hin erweitert werden. Es würde ein attraktiver Wintergarten entstehen – etwas völlig Neues im Viertel –, der dem baulichen Ensemble eine gewisse herrschaftliche Note verliehe, meinte selbst sein Vater.
Die Ausbaupläne waren bereits genehmigt, der notarielle Kaufvertrag geschlossen und der Kaufpreis in bar – das hatte den Ausschlag gegeben – entrichtet. Einen kleinen Kredit brauchten seine Eltern nur noch für den Umbau. Sie besaßen die Angebote mehrerer Banken, die sich vom hohen Eigenkapitalanteil des Gesamtfinanzplans beeindruckt zeigten.
Auch die Brauerei, mit der sein Vater seit Jahren zusammenarbeitete und die Verpächterin der Bierschwemme in Berlin war, in der Georg arbeitete, zeigte sich interessiert. Sie wollte die gesamten zusätzlichen Um- und Ausbaukosten im Rahmen eines Getränkeliefervertrags finanzieren.
Hier waren sich Georgs Eltern nicht einig. Wilhelm neigte dazu, die Offerte der Brauerei anzunehmen:
"Ich arbeite schon lange mit ihnen zusammen", argumentierte er. "Sie haben mich noch nie im Stich gelassen, weder in guten noch in schlechten Zeiten."
"Du hast ja auch immer pünktlich gezahlt", warf seine Mutter ein. "Für die Brauerei hat es mit uns noch nie schlechte Zeiten gegeben."
"Das ist doch der Punkt", widersprach sein Vater. "Die Leute kennen mich, und wenn – gerade zu Anfang – das Café nicht so laufen sollte, wie du dir das vorstellst - - "
Seine Frau wollte protestieren, aber Wilhelm hob beschwichtigend die Hand und mahnte:
"Du steckst da auch nicht drin - - und wenn es wirklich nicht so anläuft, wie du das ausgerechnet hast, dann kann man mit den Brauereileuten sicher besser reden als mit der Bank, denn die hat doch keine Ahnung von unserem Geschäft. Die finanzieren nur das Haus."
Georg schwieg zu dem Disput. Er hatte nicht die Absicht, sich zu exponieren und später vielleicht Vorwürfe hören zu müssen, weil er dieser oder jener Meinung zuneigte. Aber er stand Verträgen mit Brauereien grundsätzlich skeptisch gegenüber und sympathisierte mit der Ansicht seiner Mutter, die das Bankangebot bevorzugte.
"Stell' dir vor, es gibt noch einmal eine Inflation", stritt sie weiter, "dann tilgen wir den gesamten Bankkredit mit einer Tageseinnahme und haben ein schuldenfreies Haus ohne Brauereibindung und andere Wertminderungen."
Georg wunderte sich. Seine Mutter hatte die Verträge tatsächlich gelesen und die wichtigen Teile offenbar auch verstanden. Zum ersten Mal fand er die Idee, ein Café unter der Leitung seiner Mutter zu betreiben, nicht mehr völlig abwegig.
Und seine Mutter setzte sich durch.
Vor allem ein Argument überzeugte Wilhelm: "Wenn es wirklich Schwierigkeiten geben sollte, können wir den Bankkredit immer noch mit einem Brauereidarlehen ablösen."
Das überzeugte seinen Vater, und insbesondere versetzte es ihn in die Lage, seinen Vertrauten aus der Brauerei die Ablehnung des Angebots ohne Gesichtsverlust zu begründen.
Georg war mit der Entwicklung und dem Ende der Diskussionen zufrieden. Allerdings hatte er damit gerechnet, dass die alten Herrschaften ihn bitten würden, zurückzukommen und wenigstens während der Eröffnungsphase Hilfe zu leisten. Aber offenbar hielten es seine Eltern für selbstverständlich, dass er inzwischen ohne sie auskam, auch wenn er erst in nunmehr einem halben Jahr volljährig sein würde. Ebenso wenig bedurften sie seiner Hilfe. Er war freiwillig nach Altona gekommen, um ihre Pläne zu begutachten. Sie hatten ihn nicht gerufen. Aber ein wenig enttäuscht war er doch.
Seine Mutter, die das Gastzimmer der Eckkneipe seines Vaters kaum noch betrat – als ob es der zukünftigen Inhaberin eines bürgerlichen Cafés unwürdig sei, Trinker und Taugenichtse, aus denen Wilhelms Kundschaft nach ihrer Meinung vorwiegend bestand, freundlich zu bedienen –, fragte ihn beiläufig nach seinem Liebesleben. Er empfand die überraschende Einmischung in sein Privatleben als ungehörig, gab aber nach kurzem Zögern bereitwillig Auskunft über beide, Marie und Ellen. Er verschwieg die Rolle, die er in Maries Dienstleistungsgewerbe übernommen hatte. Vielleicht hätte seine Mutter moralische Bedenken geäußert. Aber sonst redete er ziemlich frei über sein Leben mit Marie.
"Hauptsache, du bindest dich nicht zu früh", sagte seine Mutter nur.
Und dann berichtete er in einem Augenblick familiärer Vertrauensseligkeit auch noch von seinen Ausflügen ins Berliner Kulturleben mit Ellen. Er war der Meinung, es müsse sie freuen, wenn er gleichsam zwei Stufen der gesellschaftlichen Hierarchie auf einmal erklomm. Aber er hatte sich getäuscht. Seine Mutter war eher entsetzt als begeistert:
Читать дальше