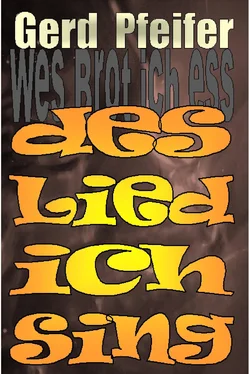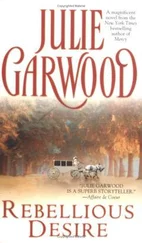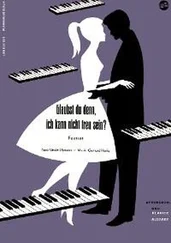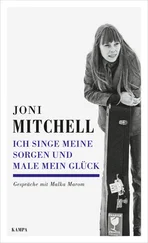"Das muss ein Ende haben", meinte sie finsteren Blicks. "Ihr passt nicht zusammen. So hoch hinaus – das kann kein gutes Ende nehmen. Du musst immer daran denken, woher du kommst."
Er wollte widersprechen, sie auslachen, ihr sagen, dass zum Glück das gesellschaftliche Kastenwesen der modernen Welt bedeutungslos, wenigstens aber durchlässig geworden sei. Aber seine Mutter hörte nicht mehr zu. Sie schüttelte verständnislos ihren Kopf und murmelte empört vor sich hin:
"... Gesangsunterricht - - lächerlich ..."
Sie wusste schon immer: Bildung macht unzufrieden. Und Bücher verderben den Charakter. Sie sprachen nie wieder über seine Frauen.
Georg kehrte nach Berlin zurück. Es war fast wie eine Heimkehr. Sein Elternhaus war ihm fremd geworden. Während der Eisenbahnfahrt dachte er über seine Eltern nach. Er konnte nicht leugnen, dass er sie auf eine gewisse Art beneidete. Sie hatten es geschafft. Ihr Ziel, den sozialen Aufstieg zu Kaffeehausbesitzern hatten sie erreicht. Er wusste nicht, ob sie nun glücklicher waren als zuvor; aber er spürte, dass sie – wäre der Umbau erst einmal fertiggestellt und das Café eingerichtet – ihr Leben als vollendet betrachten würden. Der Kreis hatte sich für sie geschlossen. Sie würden sich berechtigt fühlen, in Würde abzutreten, wenn die Zeit gekommen war. Er musste sich um sie keine Sorgen machen.
Aber Ellen beunruhigte ihn. Auf dem Weg zu dem kleinen Café – gleich sein erster Weg in Berlin hatte ihn in die Buchhandlung geführt – war sie fahrig, und als sie an ihrem gewohnten Tisch saßen und ihren Kaffee tranken, schaute sie an ihm vorbei. Offenbar verbarg sie etwas vor ihm. Ihre Hände wollten nicht zur Ruhe kommen. Sie spielte mit dem Kaffeelöffel, nahm die Zange aus der Zuckerdose, rückte ihre Tasse zurecht und antwortete geistesabwesend auf seine Fragen.
Erst als er sich über den schmalen Tisch lehnte, ihre Hände festhielt – es war die erste gesellschaftlich nicht unbedingt sanktionierte Berührung – und ihren leeren Redefluss mit einem lauten Räuspern unterbrach, blickte sie ihn an. Mitten im Satz hörte sie auf zu sprechen, biss auf ihre Lippen, senkte den Blick und studierte das Muster des nicht mehr ganz sauberen Tischtuchs. Dann wurde sie sich seiner Berührung bewusst, zog beinahe brüsk ihre Hände zurück und sagte tonlos:
"Wir dürfen uns nicht mehr sehen."
Er hatte mit allerlei weiblichen Zierereien gerechnet, die er hätte belächeln können. Auch die Sorgen einer verwöhnten Tochter aus gutem Haus, die sie bei aller Intelligenz und Belesenheit – und allen Klischees eines Zeitalters der Emanzipation zum Trotz – auch war, hätte er mit seinem jungenhaften Optimismus beiseite gewischt. Aber dieser Verzweiflung, dieser stillen Resignation, mit der sie ihrer Freundschaft ein Ende bereiten wollte, hatte er nichts entgegenzusetzen. Verblüfft sah er sie an, sprachlos und überrumpelt.
Schließlich fragte er: "Was ist geschehen?"
Seine Stimme schwankte, und er versuchte, seine plötzliche Heiserkeit durch ein trockenes Hüsteln zu verbergen. Es klang affektiert, und später glaubte er, sie für eine Weile mit offenem Mund angestarrt zu haben. Zuerst schüttelte sie nur den Kopf als schäme sie sich, seine Frage offen zu beantworten; doch als er insistierte, erzählte sie stockend, was sie derart aufgewühlt hatte. Und zum ersten Mal seit er denken konnte trat die Politik tatsächlich in sein Leben.
Die im April verbotenen Wehrorganisationen der Nationalsozialisten waren im Juni wieder zugelassen worden. Die Folgen waren blutige Freudenfeste der braunen Horden, wie sie von einem kleinen Teil der Presse genannt wurden. Die meisten Zeitungen und der größte Teil der Bevölkerung standen längst hinter ihnen. Sein Vater hatte ihm von Schlägereien in Altona erzählt. Er nahm solche Prügeleien, selbst wenn ein wenig Blut floss, nicht besonders wichtig. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, war eine stehende Redewendung in seinem Elternhaus. Wilhelm hielt seine Gaststube mit resoluter Körperkraft, einem Gummiknüppel unter der Theke und einem stählernen Totschläger neben der Kasse sauber. Wenn die Polizei eintraf – falls sich uniformierte Beamte überhaupt die Mühe machten, in das Arbeiterviertel auszurücken –, war in aller Regel schon wieder Ruhe eingekehrt. Wilhelm ließ nicht zu, dass an seinem Tresen handgreiflich über Politik oder Religion diskutiert wurde.
"Das macht gefälligst draußen. Im Regen", sagte er und behielt seine Rechte vorsorglich unter dem kupfernen Spülbecken. Oder:
"Bei mir ist jeder gern gesehen, der seinen Schnaps bezahlt." Und:
"Ob du an den lieben Gott, einen Sack Zement oder daran glaubst, dass zwei Pfund Rindfleisch eine gute Suppe machen, geht mich einen Scheißdreck an. Und deinen Nachbarn auch." Und immer wieder:
"Politik ist ein schmutziges Geschäft."
Insoweit war Georg der Sohn seines Vaters. Religion und Politik standen auf der Liste seiner Tabuthemen. Niemals hätte er Ellen oder ihre Eltern nach ihren politischen oder religiösen Ansichten gefragt. Auch Maries Wunsch, am Sonntagmorgen in die Kirche zu gehen, hatte er nicht kommentiert. Nur mitgehen wollte er nicht.
Aber nun wurde er plötzlich mit dem ganzen politischen Dreck der Gegenwart konfrontiert. Und am widerwärtigsten war, dass Ellen von ihm erwarten durfte, Stellung zu beziehen, Partei zu ergreifen, eine Meinung zu vertreten – Dinge, die ihm zutiefst zuwider waren. Schweigend hörte er zu:
"Sie haben Vaters Apotheke beschmiert", erzählte sie mühsam beherrscht. Ihr tränenloses Gesicht mit den roten Flecken nervöser Anspannung auf Stirn und Wangen beschämten ihn. Lieber hätte er sie weinen sehen – eine weibliche Reaktion, die er kannte. Aber ihre tonlose Stimme, die fahrigen Bewegungen mit der flachen Handfläche über das Tischtuch, die flatternden Augenlider und das Unvermögen, ihn ruhig anzusehen - - all die äußeren Zeichen innerer Zerrissenheit machten ihn verlegen.
Vor allem verstand er den Grund der Aufregung nicht. Ein paar bescheuerte Neider hatten die Apotheke eingesaut. Na, und - -, war er versucht, Ellen zu beruhigen. Selbst seinem Vater hatte eine Handvoll besoffener Schnapsnasen schon einmal das große verhängte Fenster mit Pflastersteinen eingeworfen, weil die Tür am frühen Morgen noch verschlossen war. Wilhelm war in aller Ruhe nach draußen gegangen, hatte den Rädelsführer zusammengefaltet, mühelos in die Gaststube getragen, lang ausgebreitet auf die Theke gelegt, seinem Sohn – Georg war damals höchstens dreizehn Jahre alt – den Gummiknüppel gegeben und befohlen:
"Wenn er sich bewegt, hau' ihn auf die Nuss. Aber kräftig. Ich gehe und hole die Blauen."
Der Mann, der da lag, war ein Stammkunde. Kohlenschlepper. Er wohnte mit Frau und Tochter ein paar Straßen weiter. Georg kannte ihn. Ein stiller Zeitgenosse mit einem eingefallenen Gesicht, in dessen Falten der feine Kohlenstaub festgewachsen war. Nur wenn er zu viel getrunken hatte, wurde er aufsässig. Später, falls er sich überhaupt erinnerte, entschuldigte er sich bei seinen Kontrahenten: "Das nächste Mal hau' mir einen in die Fresse, dass ich liegen bleibe. Dann mache ich wenigstens keinen Unsinn."
Jetzt fing er an, Wilhelm zu beschimpfen. Georg hielt ihm mit seiner schwieligen Gewichtheberhand den Mund zu. Er wehrte sich nicht, sondern blieb ruhig auf dem Tresen liegen, bis Wilhelm mit einem Polizisten zurückkam. Der befahl ihm aufzustehen, und dann unterschrieb er, langsam und mit der Zunge zwischen den Lippen, einen Schuldschein für die Glasscheibe. Im Hinausgehen beschwerte er sich bei Wilhelm:
„Du hättest den Kleinen zu den Blauen schicken sollen. Als ich einen Schnaps haben wollte, hat er mich fast erwürgt."
Wilhelm rief ihn zurück und spendierte ihm ein kleines Bier: "Auf Kosten des Hauses."
Ihre gegenseitige Achtung blieb unverändert.
Читать дальше