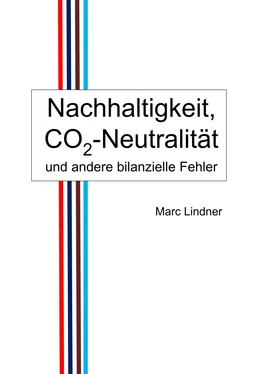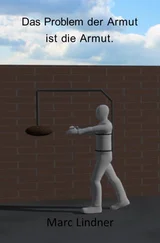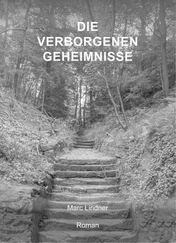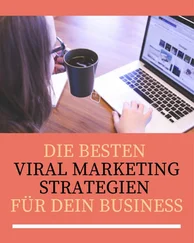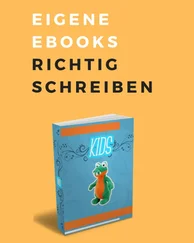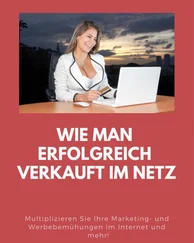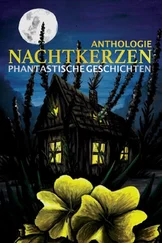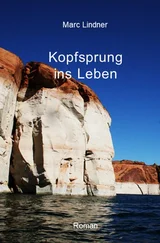Gewinn = Verkaufserlös - Investition
Somit ist sein Interesse groß, die Investitionskosten zu minimieren und in vielen Fällen allgemeine Mindestanforderungen zu erfüllen, mit der Nebenbedingung, dass keine offensichtlichen Mängel auftreten, die den Verkaufserlös senken. Das heißt insbesondere optische Qualitäten sind entscheidend und der Bauherr ist nur dann bereit in Maßnahmen zu investieren, die die Betriebskosten senken, wenn sich die Senkung der Betriebskosten entsprechend kommunizieren und vermarkten lässt.
Gewinn = + Verkaufserlös - Investition
+ Mehrerlös durch Betriebskostensenkung
- Zusatzkosten für betriebskostensenkende Maßnahmen
Für einen Bauherrn, der selbst die Immobilien nutzen wird, sieht die Gewinnfunktion anders aus. Für ihn gilt:
Gewinn = - Investition
- ∑ Betriebskosten
Er würde die Betriebskosten soweit und mit so viel Investitionsaufwand minimieren, wie es für ihn mit seiner Zeitpräferenz ökonomisch optimal erscheint. Nehmen wir an, dieses würde in diesem Fall eine Mehrinvestition von 50 000 € bedeuten.
Das bedeutet, dass wenn der Bauherr, der das Gebäude nur bauen und verkaufen möchte, diese Mehrinvestition tätigen würde, müssten für ihn Mehrerlöse von eben dieser Summe zu erzielen sein inklusive einem Zuschlag, weil er auch auf dieser Summe einen Gewinn erzielen wollen würde. Dies ist aber nicht realistisch, weil ein Käufer der erzählt bekommt, dass er in 15 Jahren 50 000 € an Betriebskosten einsparen kann, wird nicht bereit sein so viel zu bezahlen, weil die kommunizierten Einsparungen mit starken Unsicherheiten behaftet sind. Weil der Bauherr eben dies auch weiß, wird er die Mehrinvestition in die Betriebskostensenkung nicht tätigen, weil für ihn die Mehrerlöse mit starken Unsicherheiten (Risiko) behaftet sind und er, damit er dieses Risiko übernimmt, einen Risikozuschlag erhalten müsste, um das Geschäftsrisiko einzugehen. In einem solchen Fall wäre aber auch der Kauf für den Endnutzer nicht mehr kostendeckend und er würde vom Kauf absehen.
Also stellt das Bauherrenproblem die Tatsache dar, dass ein Bauherr der nicht anschließend Nutzer ist, die Betriebskosten nicht gesamtoptimal senkt, so wie es ein Bauherr zu tun bereit wäre, der anschließend auch der Nutzer ist.
3.13. Logische Verknüpfungen
Ein gern begangener Fehler besteht darin, dass vorhandene Schlussfolgerungen durch leichtfertige Umkehrschlüsse zu falschen Argumentationen führen können.
So gilt für A bedingt B nicht zwangsläufig B bedingt A:
A ⇒ B ≠ B ⇒ A
Dazu ein Beispiel.
Wenn Schnee liegt, ist es kalt.
Aber der Umkehrschluss „wenn es kalt ist, liegt Schnee“ ist falsch.
Nicht immer lassen sich fehlerhafte Umkehrschlüsse so leicht auffinden. Deshalb sollte bei jeder Zielsetzung einer Parameteroptimierung überprüft werden, ob für den optimierten Parameter gilt
1) der Zielwert lässt sich in der gewünschten Weise durch den Parameter beeinflussen (A ⇒ B)
2) eine Beeinflussung dieses Parameters beeinflusst den Zielwert in der gewünschten Weise (B ⇒ A)
Ist die zweite Bedingung nicht erfüllt, darf der Parameter nicht ohne zielwertorientierte Nebenbedingungen optimiert werden. Im Kapitel zum Thema Energiesparen wird die Gefahr einer unbewussten Verwendung des Umkehr(trug)schlusses verdeutlicht.
3.14. Steuerelemente des Staates
Ich habe im Abschnitt über externe Kosten und Nutzen argumentiert, dass es die Aufgabe des Staates ist, das Gemeinwohl seiner Bürger zu maximieren und durch seine Tätigkeit die Interessen abzudecken, die nicht abgedeckt wären, wenn jeder auf sich orientiert egoistisch handeln würde. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass in einer gemeinschaftlich handelnden Gesellschaft mit altruistisch handelnden Individuen der Staat überflüssig wäre – und nur in einer solchen.
Wenn es um individuelle Nutzen geht, die geschützt werden sollen, ohne dass ein anderer seinen Nutzen auf deren Kosten maximieren darf, dann sind Gebote, Verbote oder Grenzwerte das geeignete Mittel um diese grundlegenden Nutzen zu schützen.
So ist Mord verboten, weil der individuelle Nutzen der verbleibenden Lebensjahre des potenziell Ermordeten unantastbar sein soll. Ebenso ist es mit Nutzen, die auf der Gesundheit oder der Menschenwürde basieren.
Steuern und Abgaben dienen der Finanzierung von gemeinnützlichen Investitionen und Deckung der Eigenkosten des Staates. Diese Steuern und Abgaben können aber ebenso gut verwendet werden, um externe Kosten in das Entscheidungskalkül von Individuen und Unternehmen zu integrieren.
Subventionen sollen im Prinzip externe Nutzen internalisieren. Unglücklicherweise werden diese vorrangig eingesetzt um Ineffizienzen zu kaschieren, und somit zu unterstützen. Und sie werden missbraucht, um Probleme nicht lösen zu müssen und dafür zu sorgen, dass die Entscheidungsträger wiedergewählt werden und ihre eigene Macht konservieren.
3.15. Funktionsfähige Märkte
Funktionsfähige Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt und umgekehrt, aber ohne, dass eine Partei, ein Unternehmen willkürlich Preispolitik, wie zum Beispiel bei Monopolstellung oder Bildung von Kartellen, ausüben kann, oder die anderen Marktteilnehmer in besonderem Maße beeinflussen kann.
Der Preis spiegelt dabei die Schnittstelle der Angebot- und Nachfragekurve wieder, wie in Grafik 3-6 zu erkennen ist. Die Nachfragekurve gibt das Verhältnis zwischen Preis und gewünschter Menge wieder. Für einen hohen Preis sind nur wenige Kunden bereit den Artikel oder die Dienstleistung zu kaufen. Je geringer der Preis ist, umso höher steigt die nachgefragte Menge. Wobei der Preis, den ein Kunde bereit ist zu zahlen, jenen Nutzen repräsentiert, den er sich von dem Kauf verspricht.
Dem gegenüber kann der Produzent entscheiden, wie viel er von seinem Produkt verkaufen möchte. Dabei steigert er so lange seinen unternehmerischen Gewinn, wie er Einheiten veräußert, die mehr Einnahmen generieren als deren marginale Kosten sind. Das bedeutet, dass die letzte Einheit, die ein Produzent dauerhaft bereit wäre zu verkaufen, einen Gewinn von 0 erzielen würde. Weniger würde er nicht verkaufen, auch nicht in der Hoffnung, dass der Preis steigt, weil jede Einheit, die er nicht verkauft, verkauft ein Mitbewerber. Er selbst kann weder den Markt noch den Produktpreis beeinflussen.
Möchte er auf Dauer mehr verkaufen, muss er versuchen, seine Kosten zu reduzieren. Somit stellen funktionsfähige Märkte einen starken Anreiz dar, kostengünstig und dadurch effizient zu produzieren. Unternehmen, die Ressourcen verschwenden würden nicht bestehen können.
Deshalb ist es gefährlich, wenn durch Subventionen die Nachfrage und somit der Preis hochgehalten werden. In einem auf solche Weise verzerrten Markt werden Ineffizienzen viel weniger stark bestraft. Als Folge ist auch der Innovationsanreiz merklich geringer.

Grafik 3-5: Bildung des Marktpreises bei vollständiger Konkurrenz
Die hier angenommene steigende Grenzkostenfunktion stellt den Normalfall dar. Allerdings gibt es Märkte, zum Beispiel Gütertransport, die sinkende Grenzkosten aufweisen, zum Beispiel höhere Auslastung der LKW oder Skaleneffekte. In einem solchen Fall neigt der Markt zu einer Monopolbildung, da das Unternehmen die geringsten Kosten aufweist, welches die größte Menge verkauft. Kleine Mitbewerber werden aus dem Markt gedrängt, weil sie nicht zu den gleichen Kosten produzieren können.
Generell kann Folgendes gesagt werden.
In funktionsfähigen Märkten mit vollständiger Konkurrenz ist die Produktion kosteneffizient, weil jedes Unternehmen sich daran ausrichtet, dass die Grenzkosten der letzten produzierten Einheit, dem Grenznutzen der letzten konsumierten Einheit entsprechen.
Читать дальше