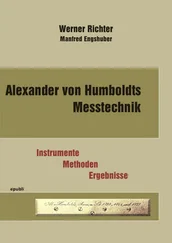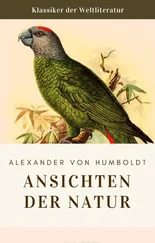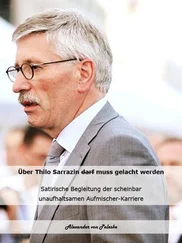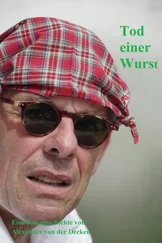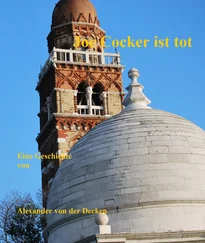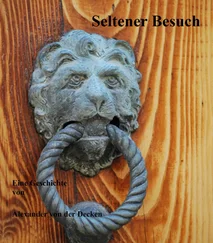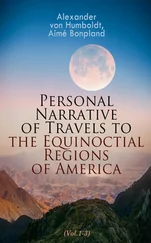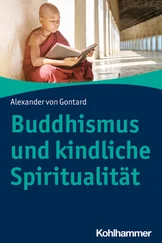Alexander von Plato - Verwischt
Здесь есть возможность читать онлайн «Alexander von Plato - Verwischt» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Verwischt
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Verwischt: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Verwischt»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Verwischt — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Verwischt», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Marie L.: Und – was bedeutet das jetzt für unser Gespräch?
Walter F. ( lachend ): Sie werden eine Hochleistung in Interpretationsfähigkeit entwickeln müssen. Vielleicht sollten Sie den Ausdruck meines Gesichts berücksichtigen. ( Süffisant :) Ach ja, schade, Sie haben ja keine Videokamera mit.
Marie L.: Ok, dann fangen wir also an mit Ihrer Lebensgeschichte.
Walter F.: Gut. Ich bin Jahrgang 1938, meine Mutter, die 1913 geboren wurde, war eine damals sehr bekannte Balletttänzerin, die aber zwei Jahre vor meiner Geburt ihre Stellung verlor, da sie sich nicht von ihrem Mann Jakob scheiden lassen wollte. Dieser Mann, mein Vater, sieben Jahre älter als sie, war Jude – sie nicht. (Zögert) Mein Vater hat 1927 an der Piscator-Bühne am Berliner Nollendorfplatz als ganz junger Schauspieler angefangen. Er hat sogar in dem berühmten Eröffnungsstück – Ernst Tollers „Hoppla, wir leben!“ – mitgemacht. Als Erwin Piscator 1928 das erste Mal Konkurs anmeldete, fand mein Vater ab und zu ein Engagement in anderen Theatern zum Teil außerhalb Berlins, wurde auch wieder bei den Neueröffnungen von Piscator engagiert, aber 1931 machte der dann endgültig Pleite und ging in die Sowjetunion, und mein Vater verlor seinen wirkungsvollsten Gönner, arbeitete als Bühnenarbeiter, und schloss sich der kommunistischen Partei an. Ausgerechnet bei Gustav Gründgens, der 1933 von Hermann Göring zum Leiter des Preußischen Nationaltheaters ernannt worden war, kam er später unter und lernte über ihn auch meine Mutter kennen. Warum es zu dieser Ehe kam – oder besser, warum meine Mutter sich in diesen armen Schlucker verliebte, der täglich verhaftet werden konnte, war mir immer ein Rätsel. Sie hat es mal so zusammengefasst: Er habe eine ungeheure Virilität ausgestrahlt, war mutig, unerbittlich gegen die Nazis und unbestechlich. Aber nach den Rassegesetzen hatte er, hatten sie keine Chancen mehr. Er blieb noch eine Weile bei Gründgens, meine Mutter machte eine kleine private Ballettschule in Dresden auf, die 1945 im Februar zerbombt wurde. Mein Vater war zunächst ihr Hilfsarbeiter und Hausmeister, aber 1938 hatte die Berliner Gestapo offensichtlich herausgefunden, wo er war. Als die Dresdner Polizei das erste Mal bei meiner Mutter nachfragte, wo ihr Mann sei, beschlossen beide, dass er untertauchen und – wenn möglich – in die Sowjetunion abhauen solle. Sie vereinbarten auch eine Scheingeschichte für die Gestapo: Er hätte sie schon vor einem Jahr verlassen, weil er in seiner Unzufriedenheit zum Säufer geworden sei. Sie hätte ihm gesagt: Entweder sie und das Kind oder der Alkohol. Er sei dann – sollte sie erklären – nach Berlin zurück gegangen, als sie ihn „mit einer Flasche billigen Fusels erwischt hätte“. Von heute her scheint mir das eine ziemlich unglaubwürdige Deckgeschichte.
Marie L.: Ja?
Walter F.: Ja. Sie zeigt eine gewisse Unterschätzung der Gestapo. Natürlich kam schnell heraus, dass mein Vater noch bis vor kurzem bei ihr in Dresden gesehen worden war. Meine Mutter wurde ständig verhört, mehrfach für Wochen in Untersuchungshaft gehalten, auch geschlagen und immer wieder früheren Kolleginnen und Kollegen von der Piscator-Bühne gegenübergestellt, die man wegen Hochverrats verhaftet hatte. Aber meine Mutter kannte sie entweder gar nicht oder hatte sie nur mal kurz gesehen. Irgendwann hat die Gestapo wohl angenommen, dass meine Mutter eine unpolitische Frau war und sie wieder nach Hause geschickt. Sie war übrigens ganz und gar nicht unpolitisch, aber sie hat diese Rolle das ganze Zeit des Faschismus über durchgehalten – sowohl meinetwegen als auch aus persönlicher Angst. Sie hat mir später mal erzählt, dass einige derjenigen, denen sie gegenübergestellt worden war, übel zugerichtet gewesen wären, darunter Paul Z. Auch ein anderer, den sie kannte, war noch blutüberströmt, als sie ihn identifizieren sollte, um sie weich zu kochen. Aber beide hatten getan, als ob sie sich noch nie gesehen hätten. Ich war inzwischen bei ihren Eltern in Berlin untergebracht, die damals beide noch lebten. Noch eine ganze Weile blieb ich bei meinen Großeltern, bis die Bombenangriffe auf Berlin überhandnahmen und sie mich wieder nach Dresden zurückschickten, das damals als ungefährdet galt.
Plötzlich fragte er: Kann ich Sie denn wenigstens mit einem Kaffee erfreuen?
Marie L. (lacht): Ja, gerne.
Marie Lente (aus ihren Anmerkungen nach dem Gespräch mit Walter Friedrichsen am 12. Dezember 1988)
(Während Walter Friedrichsen in die Küche ging, schaute ich mich um, vor allem untersuche ich diese riesigen Bücherschränke. Eigentlich war dort die gesamte Literatur vertreten, die ich auch gerne gehabt hätte oder noch lieber damit aufgewachsen wäre. Dieser Feind des westdeutschen Imperialismus hatte das alles hier stehen sowohl aus dem Osten wie aus dem Westen, nicht nur Belletristik, besonders Dramatik, sondern auch Philosophie, Astronomie, Biologie, Ökonomie, viel Marx, aber keineswegs nur, auch die Ökonomen Ota Šik, Joseph Schumpeter oder John Kenneth Galbraith. Dazu auch noch Freuds Gesamtausgabe. Die Mauer scheint nicht durch diese Bücherschränke gegangen zu sein.)
Walter F: Hier haben Sie schon mal die Tassen, Milch und Zucker. Der Kaffee läuft durch und kommt in einer Minute. Schauen Sie sich ruhig um. (Er sagt dies ohne Sarkasmus.)
Marie Lente (mit Jewgenij Schwarz‘ „Der Drache“ in der Hand): Ja, ich würde gerne mal länger in Ihren Bücherschränken stöbern. Bei mir fehlt der Osten völlig, da sind Sie mir voraus.
Walter F.: Vielleicht wollen Sie die schöne Literatur aus dem Osten bald gar nicht mehr haben. Wer weiß? „Der Drache“ wurde übrigens von Paul Dessau vertont.
Marie L.: Aha. (lacht). Sie können mir viel erzählen oder ist das an andere gerichtet? (Ich blicke nun ebenfalls an die Decke und frage frech:) Wie haben Sie denn alle diese Bücher aus dem Westen bekommen?
Walter F. ( unbeeindruckt ): Das erzähle ich Ihnen später mal. Jetzt sollen Sie wenigstens noch meine Geschichte bis 1945 weiter hören, also die Geschichte meiner Eltern, damit Sie hinterher noch was zu tun haben mit dem Abspielen und Transkribieren.
Marie L.: Gerne (ich hole mein Schreibzeug wieder vom Tisch).
Walter F.: Also, meine Mutter konnte dann bis zur Bombardierung Dresdens im Februar 1945 ihre private Ballettschule weiter führen. Die ging sogar gar nicht schlecht, jedenfalls konnten wir von dem Geld ganz gut leben. Es ist erstaunlich, dass mitten im Krieg Kinder auf die Ballettschule gingen oder geschickt wurden. Sie hatte damals viele Freunde, Bekannte oder Kontakte in der Dresdner Künstlerszene. Kannte auch die berühmte Gret Palucca ganz gut, die 1939 als Jüdin ihre Ballettschule schließen musste. Meine Mutter hielt aber weiterhin Verbindungen zu ihr. (Pause, Räuspern) Von meinem Vater zu erzählen, fällt mir schwerer, von ihm hörte meine Mutter mehrere Jahre gar nichts, ab und zu bekam sie von irgendjemand eine Mitteilung, dass er nicht verhaftet worden sei. Aber sie wusste nicht, ob er es in die Sowjetunion geschafft hatte. Erst 1945, kurz nach Kriegsende, wurde sie in Dresden von einer Parteidelegation besucht– damals noch der KPD, also vor der Vereinigung mit der SPD zur SED. Dort lebten wir nun mehr schlecht als recht in unserer Wohnung in einem Haus, das weitgehend zerbombt war. Ich sollte übrigens gerade eingeschult werden, als die Bomben meine potentielle Schule trafen. Dadurch konnte ich erst mit sieben in die Schule gehen. (Kleine Pause)
Tja, die Parteidelegation. Paul Z. war übrigens dabei. Also, kurz und gut, meiner Mutter wurde mitgeteilt, dass mein Vater bis 1944 illegal in Deutschland für die KPD tätig gewesen sei, und zwar in der Inlandsleitung der KPD. Er sei eng mit Anton Saefkow befreundet gewesen, habe „führend“ in der Gruppe Saefkow, Franz Jacob und Bernhard Baestlein gearbeitet und sei auch ein Kurier der Inlandsleitung nach Schweden zu Walter Ulbricht gewesen. Als diese Gruppe im Mai und Juni 1944 aufflog, war mein Vater gerade in Schweden gewesen. Ich habe nie herausgefunden, warum mein Vater wieder nach Deutschland zurückkehrte, obwohl gerade die Prozesse liefen und Saefkow, Baestlein, Jacob und viele andere im September hingerichtet wurden. Aber genau im September 1944 kehrte er zurück wie übrigens auch Paul Z., obwohl allen klar gewesen sein musste, dass viele der Verhafteten unter der Folter andere Namen preisgegeben hatten. (Walter F. seufzte und schaute wieder zur Decke, ohne zu zwinkern.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Verwischt»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Verwischt» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Verwischt» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.