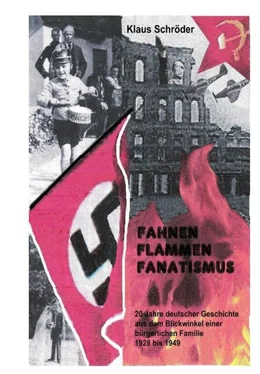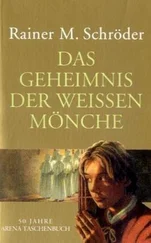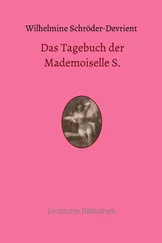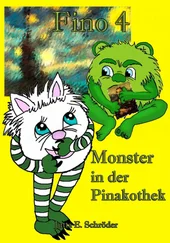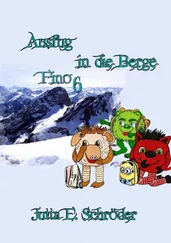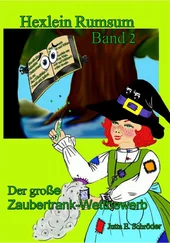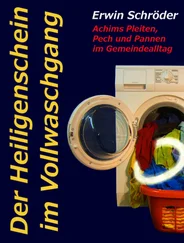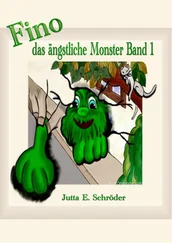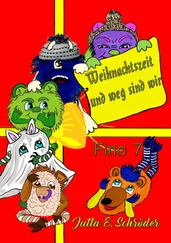Am nächsten Morgen brachte sie die Bahn nach Aumühle, dann ging es weiter zu Fuß durch den Sachsenwald zur Waldsiedlung Dassendorf, wo Fritz ein Wochenendhaus besaß. Das Grundstück war sehr groß, bewaldet und hatte einen Karpfenteich, an dem Paul sofort die Rute auswarf und nach fünf Minuten das Mittagessen herausfischte. Danach sollten Pilze gesammelt werden, aber die Jugend rannte nur herum, durch Gestrüpp und Büsche, und spielte „Hasch“. Sie kamen ohne Pilze, aber mit etlichen Schürfwunden zurück. Zum Glück waren Paul und Selma ernsthafter gewesen und hatten fleißig gesammelt.
Zum Abendbrot gab es beim Schein einer Petroleumlampe köstlich geschmorte Pilze, „Schwammerln“, wie Ernst sie nannte. Dann mussten die Enten, der ganze Stolz von Onkel Fritz, in ihr Häuschen gescheucht werden. War das geschafft, kamen sie vergnügt quakend auf der anderen Seite wieder hinaus und schwammen noch eine Runde.
Am Abend wurde erzählt. Man sprach über die Situation in Deutschland. Die völkisch-bündische Jugend hatte sich der HJ und dem BDM angeschlossen., die Hälfte der fünf Millionen Erwerbslosen war auf die Wohlfahrt angewiesen, während in Kiel ein neuer Panzerkreuzer vom Stapel lief. „Dafür ist Geld da“, kommentierte Selma die Zeitungsmeldung.
Auch in Wien gab es rechtsextreme Tendenzen, aber Ernst wäre nicht er selbst, wenn er nicht wieder einen Witz auf den Lippen gehabt hätte. „Die neureichen Pollaks gehen in die Oper, um ihr erworbenes Vermögen zur Schau zu stellen. An der Garderobe wird die Frau von der Garderobiere gefragt: ‚Wünschen Frau Baronin ein Opernglas?’ ‚Nein danke’, sagt die, ‚wir trinken aus der Flasche’“ Mit Blick auf Grete entschuldigte sich Ernst schnell, Pollak sei kein Schimpfwort, sondern ein Name. „Wollt ihr noch einen? Da trifft Graf Bobby auf dem Opernring einen Dienstmann, der auf seinem Rücken eine große Standuhr schleppt. Bobby geht auf ihn zu und sagt: ‚Lieber Herr, das ist doch zu unpraktisch.’ Er zeigt auf seine Armbanduhr. ‚Kaufen’s so ane, dös is praktischer.’“
Waschen musste man sich draußen an der Quelle. Am Morgen stand in jeder Ecke einer mit Handtuch und Seife. Dann sollten Marie und Ernst zum Krämer laufen. Es fehlte das Salz. Kaum waren sie zurück: „Ihr könntet auch noch ein paar Eier holen, das wäre doch toll zum Frühstück. Also rannten die zwei abermals los.“ Endlich saßen alle am Tisch. Später baute Paul mit Fritz eine Tür aus Birkenholz und die beiden Jungen waren überall, meist jedoch dort, wo sie nicht gebraucht wurden. Sie streiften durch die Siedlung und beobachteten das Sonntagsleben. Dort drei Mann beim Kartenspiel, eine Frau klopfte Decken aus, Kinder spielten im Sand. Fast überall stand ein Auto vor der Tür der gutsituierten Hamburger Geschäftsleute. Was für eine friedliche Zeit.
I-4
Am Montag hieß es Abschied nehmen vom kleinen Paradies. Ernst verscheuchte mit einem flotten Spruch die Abschiedsgrillen. „Auf, auf, sprach der Fuchs zum Hasen, hörst du nicht den Jäger blasen?“ Fritz führte sie an Hünengräbern und uralten Bäumen vorbei zum Bismarck-Mausoleum Friedrichsruh. Dort stiegen sie in den Zug nach Hamburg und im Rest des Tages wurde unter Fritzis Führung die Innenstadt mit der Straßenbahn erkundet. Rathaus, Jungfernsteg, Uhlenhorster Fährhaus, Landungsbrücken. Die „Deutsche Werft“ lag still, kein Kran bewegte sich. Deutschland am Abgrund.
Der Dienstag war der Höhepunkt der Reise. Alle waren zeitig auf den Beinen, erwartungsvoll und aufgeregt. Tante Grete aber war noch früher in der Küche und hatte Unmengen Brote, Fleisch, Schnitzel und Obst für jeden zurechtgemacht. Das Essen auf Helgoland war teuer. Jeder bekam noch warme Kleidung mit auf den Weg, dann betraten die vier Feriengäste das Seebäderschiff, den Turbinen-Schnelldampfer „Cobra“.
Für die Landratten war das, als würden sie eine Weltreise beginnen. Matrosen rannten zwischen den an Deck stehenden Passagieren hin und her, Kommandos erschollen, ein Pfiff, dann wurde der Landungssteg eingezogen. Das Schiff schwankte etwas und manche blickten schon jetzt ängstlich. Der Dampfer fuhr mit stampfenden Maschinen los, Punkt sieben Uhr. Zugleich spielte eine Bordkapelle „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus …“
Taschentücher winkten, am Kai und auf dem Schiff. Tante Grete wurde immer kleiner. Langsam glitt der Dampfer an den Vororten Hamburgs vorbei, die Kapelle spielte flotte Weisen und die Menschen strahlten. Alle waren sie Vergnügungsreisende. Paul und Selma ließen sich drinnen nieder und betrachteten die vorbeiziehende Landschaft durch das Fenster. Marie und Fritz dagegen liefen von vorn nach hinten und wieder zurück, alles bewundernd und sinnend auf die weite Wasserfläche blickend. Das war doch etwas anderes als die kleinen Raddampfer auf der Elbe. Sie stöberten in allen Ecken und drangen bis in den Maschinenraum vor.
Draußen wehte ein steifer Wind. Hüte auf und Kragen hoch. So viel gab es zu sehen. Fischdampfer, Segelboote, Bugwellen mit Schaumkronen. Möwen umschwärmten das Schiff und fingen die zugeworfenen Bissen im Fluge auf. Als ein Regenschauer aufkam, verzogen sich auch die Letzten unter Deck. Dort wurde sogar nach den Klängen der Kapelle getanzt. Auch Marie und Ernst versuchten zu tanzen, aber das Schiff tanzte auch und ließ das Paar aus dem Takt geraten. Was für ein Spaß. Jeder schien sich zu kennen, lächelte dem anderen freundlich zu und machte Scherze. Urlaubsstimmung eben.
In Cuxhaven legte das Schiff an und neue Passagiere kamen an Bord. Die Gelegenheit wurde genutzt, um eine Postkarte mit der Schiffsansicht „Auf hoher See“ an die Telefonzentrale in Dresden zu schreiben. Der Stempel würde Eindruck machen. Dann wurde es stürmischer, der Seegang stärker und das Schiff tauchte stark in die Wellen ein. Matrosen schlenderten gemächlich mit Eimer und Besen hin und her und schrubbten fallen gelassenes über Bord. Je stärker das Schiff schwankte, umso schneller rannten sie. Manche Leute konnten das Auf und Ab und das seitliche Rollen eben nicht ab.
Die Frage, welche Windstärke das wohl sei beschäftigte Marie und Ernst sehr. Gelegenheit, mal mit einem der schneidigen Offiziere ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam gingen sie nach unten. Beim Offiziersspeisesaal stand „Eintritt verboten“, aber Marie übersah das Schild. So’n oller Seebär schaute sie fragend an. “Na min Deern, wat wist ju dor?” Sie fasste sich ein Herz: „Bitte können Sie mir sagen, welche Windstärke wir haben?“ Der Bärtige lachte übers ganze Gesicht. „Windstärke? Gor keen!“ Marie schaute enttäuscht. „Nu, Frollein, sechs sind’s schon, aber bei uns beginnt Wind erst bei Stärke Acht!“, erläuterte er auf Hochdeutsch, damit die Landratte das auch verstand.
Das war natürlich übertrieben und Marie kam sich auf den Arm genommen vor. Gern hätte sie mit vielen Windstärken geprahlt. Die Tür nach draußen ließ sich nur mit zwei Mann öffnen und an Deck musste man sich gegen den Wind stemmen. Stärke sechs, lächerlich. Ihr Seidentuch flatterte davon. Es waren fast nur Männer draußen, aber Marie wollte sich keine Blöße geben. Ab und an kamen noch mehr zur Reling, ziemlich blass, die dann lebhafte Zwiesprache mit dem Meer hielten.
Marie hielt sich tapfer, aber als neben ihr eine Dame ihren Geist aufzugeben schien, wurde auch ihr mulmig und sie rannte nach unten zu Muttern. Nur ein paar Minuten setzen. Dann ging’s wieder. Oben kam sie gerade zurecht, als Ferngläser gezückt wurden, um die Wasserfläche abzusuchen. Dann ein vielstimmiger Ruf: „Helgoland in Sicht“. Ein kleiner dunkler Fleck der sich schnell zu einem mächtigen Felseneiland entwickelte. Alle waren in Hochstimmung. Ein Hamburger erklärte den Greehorns die Bedeutung des Gedichtes:
„Grün ist das Land, rot ist die Kant,
weiß ist der Sand. Das sind die Farben von Helgoland.“
Читать дальше