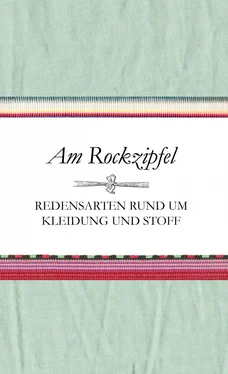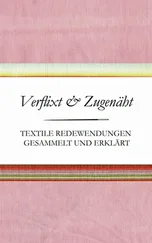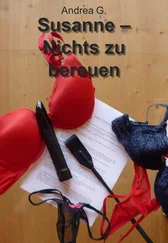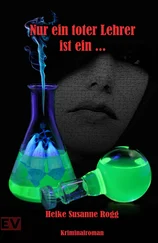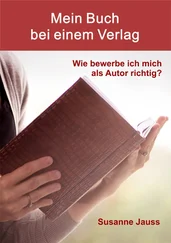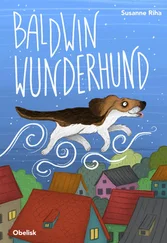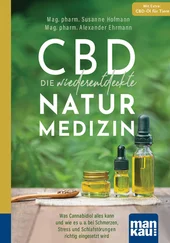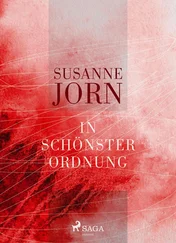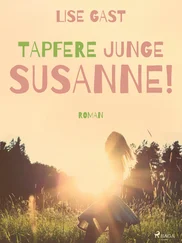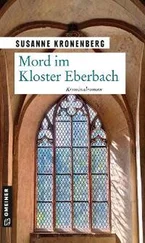Aus dem Ärmel schütteln
Schon 1600 werden träge Priester gescholten, die eine Predigt aus dem Ermeln schütteln . Die Redensart beschreibt bis heute ein scheinbar müheloses Improvisieren und erinnert an Zauberer oder Falschspieler, die versteckte Karten aus dem Ärmel ziehen. Immer noch hat ein As im Ärmel, wer einen letzten Trumpf ausspielen kann.
Manschetten haben
Das Wort Manschette kommt vom französischen manche für Ärmel und bezeichnet den unteren Ärmelabschluss. Manschetten waren bei wohlhabenden Männern bis 1800 sehr auffallend geschmückt, oft fielen mehrere Lagen feine weiße Spitze weit über die Finger. So gezierte Hände waren sehr viel weniger willens und in der Lage, sich einer handfesten Auseinandersetzung zu stellen als Arme, deren Ärmel hochgekrempelt und kampfbereit waren. Die feinen Herren ›hatten Manschetten‹ – sie mussten Grobheiten aus dem Weg gehen und waren nicht so wehrhaft. Später konnte man jemandem Manschetten machen, indem man ihm Angst einjagte, manchmal steigerte sich die Angst auch bis zum Manschettenfieber.
Kopf und Kragen
»Dem dreh ich den Kragen um!« – Egal, ob es dem Hassobjekt nun nur an den Kragen gehtoder es ihm gleich den Kragen kostet, immer ist hier eigentlich der Hals gemeint. Wie bei vielen Redensarten steht das Kleidungsstück für den Körperteil, den es umhüllt. Ganz deutlich beschwört die Wendung es geht um Kopf und Krageneine Gefahr wie bei einer Hinrichtung herauf. Wer sich um Kopf und Kragen redet, bringt sich durch unvorsichtiges Reden bildlich in Lebensgefahr. Der Geizkragenist eigentlich ein Geizhals.
Kragen platzt
»Ich hab so einen Hals!« – zwei Hände deuten an, wie dick der Hals mit seinen Halsschlagadern vor Wut schon angeschwollen ist. Bei »Hör sofort auf, sonst platzt mir der Kragen!« sprengt ein dicker Hals in Kürze die Kleidung. Wenn aber alles gut läuft, dann sitzt das Hemd angenehm wie bei einer Sache, die jemandes Kragenweiteist, die also wie für die Person gemacht ist.
Hinter die Binde kippen
Wer sich ein Glas Alkohol genehmigt, kippt oder gießt sich einen hinter die Binde. Der Ausdruck war schon 1850 geläufig und passt gut zur damaligen Männermode. Eine mehrmals um den Hals geschlungene Binde gehörte im Biedermeier zum perfekten Look des Mannes. Bier, Wein und Schnaps liefen hinter dieser breiten Binde den Hals hinunter.
Beim Kragen packen und beim Wickel nehmen
Wen man am Kragen festhält, der kann einem nicht entwischen. Zusätzlich kann der Kragen hier auch wieder für den Hals stehen, dann geht es dem Kontrahenten sogar an die Gurgel.
Die Redensart ›beim Wickel nehmen‹ erinnert daran, dass Männer bis vor zweihundert Jahren noch Zöpfe trugen. Um diesen Zopf am Hinterkopf wickelten sie sich ein sogenanntes Wickelband. So störte das Haar nicht und ließ die Kleidung im Rücken sauber. An dem schwarz umwickelten spitzen Schwanz konnte man einen Mann auch gut festhalten.
Am Schlafittchen packen
Wen man nicht am Kragen packen kann, den erwischt man möglicherweise noch beim Schlafittchen, also am Rockschoß oder Kleiderzipfel. In dem Wort ist der ›Fittich‹ versteckt, die Schwinge eines Vogels. Mit Schlag-Fittichen sind die großen Schlagflügel gemeint, die manchmal bei einer Gans oder einem Schwan zu sehen sind. Wer den anderen beim Ärmel oder Kleid erwischt, der packt ihn bildlich am Flügel.
Auf den Schlips treten
Nein, hier landet kein Fuß auf einer Krawatte. Das Wort Schlips kommt vom niederdeutschen slip für Zipfel, daher meint die Redensart eigentlich einen Zipfel der Kleidung. Wer dem anderen zum Beispiel auf den Saum tritt, stört und behindert ihn.
»Gewohnheit ist ein Hemd aus Eisen.«
Sprichwort

»Eine Krone ist lediglich ein Hut, in den es hineinregnet.«
Friedrich II
Hüte, Mützen und Hauben
Den Hut ziehen
Heute versteht kaum noch jemand das Sprichwort »Hut in der Hand hilft durchs ganze Land«, weil die Höflichkeitsgeste des Hutziehens fast vergessen ist. Bis in die 1960er Jahre hinein verließen viele Männer das Haus nicht ohne eine Kopfbedeckung. Zum höflichen Gruß auf der Straße gehörte es dann, den Hut kurz zu lüften. Die Geste stammt aus mittelalterlichen Zeiten, als der Hut Herrschaftssymbol und Vorrecht des freien Mannes war. Gegenüber dem Ranghöheren hatte ein Mann seinen Hut abzunehmen. Im Laufe der Jahrhunderte verloren sich die Statusregeln, das gegenseitige Ziehen des Hutes, manchmal auch nur ein Tippen an die Hutkrempe, blieb als reine Höflichkeitsgeste bestehen.
Sprachlich existiert die Ehrerbietung aber noch, sei es im lobenden »Ich zieh den Hut vor dir« oder in der Bemerkung »Respekt, Hut ab!«. In der französischen Version heißt es auch »Chapeau!« für Chapeau bas , Hut ab.
Die Ehrerbietung gegenüber dem Ranghöheren ist heute auch noch im militärischen Gruß erkennbar, bei dem die rechte Hand an die Mütze gelegt wird. Weil die Hüte und Helme der Militäruniformen im 18. Jahrhundert kompliziert abzunehmen waren, wurde es den Soldaten gestattet, die Kopfbedeckung mit dem Handzeichen nur noch symbolisch zu lüften.
Den Hut aufhaben
»Wer hat hier den Hut auf? Wer ist verantwortlich?« sind eigentlich Fragen aus einer Zeit, als die Kopfbedeckung eines Mannes noch seinen sozialen Status anzeigte. Würdenträger wie Bürgermeister, Richter oder Gelehrte trugen berufsbezogene Kappen – sprichwörtlich ist der Doktorhut. Bis heute signalisieren Uniformmützen mit Rangabzeichen eine hoheitliche Funktion.
In der Variante auf seine Kappe nehmensteht man zu seiner Verantwortung. Inzwischen kann sich der Hut bildlich auch auf verschiedene Tätigkeitsbereiche beziehen. »Heute habe ich meinen Arzthut auf, morgen wieder den Dozentenhut.«
Den Hut nehmen
Genau wie das Lüften des Hutes gehörte es zum guten Benehmen eines männlichen Hutträgers, die Kopfbedeckung in Innenräumen abzulegen und erst beim Gehen wieder zu nehmen. ›Den Hut nehmen‹ steht aber für mehr als nur einen kurzen Abschied. Wer bildlich den Hut nimmt, kündigt zum Beispiel seine Arbeitsstelle oder legt ein Amt nieder. Beim Hut draufhauengibt er mit einer deutlichen Abschiedsgeste auf. Bei der Wendung den Hut an den Nagel hängenist der Hut Symbol für das Amt, das jemand bekleidet, der berufliche Hut wird für immer an den Haken gehängt. Diese Redensarten sind Hüllformeln, also verharmlosende Umschreibungen für etwas Gravierenderes.
Da geht mir der Hut hoch
Der Wutpegel steigt, die Haare sträuben sich, die Adern schwellen an – kein Wunder, dass der Hut hochgeht, wenn jemand richtig sauer wird. Die Redensart ist noch relativ jung. Böse wird auch, wem etwas über die Hutschnur geht. Die Hutschnur ist das Band, das oberhalb der Krempe um den Hut liegt und als Sicherung auch unter das Kinn geklemmt werden kann. Ähnlich wie bei ›das steht mir bis zum Hals‹ und ›das steigt mir über den Kopf‹ ist die Hutschnur die Grenze, ab der einem etwas zu viel wird.
Nach einer anderen Erklärung stellt die Hutschnur das Dickenmaß für einen Wasserstrahl dar. Außer einer Fundstelle über eine Wasserleitung in einer mittelalterlichen Urkunde gibt es dafür aber keine Belege.
Auf den Hut bekommen
Der Schlag auf den Kopf hat viele Umschreibungen: Egal ob man etwas auf den Hut bekommt, auf die Mütze, auf den Deckeloder aufs Dach – bei allen Varianten ist eigentlich der Kopf gemeint. Dabei geht es nicht unbedingt direkt um Prügel, vielleicht wird man auch nur zurechtgewiesen oder erleidet einen Rückschlag.
Читать дальше