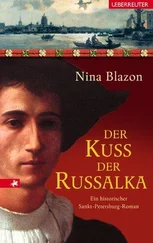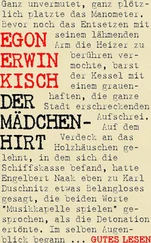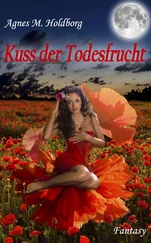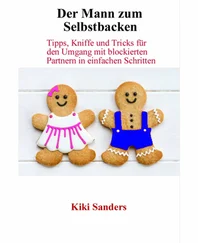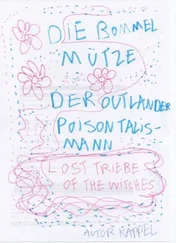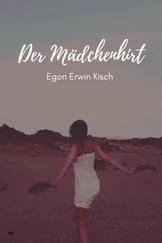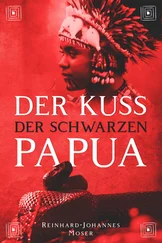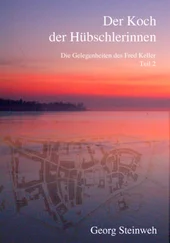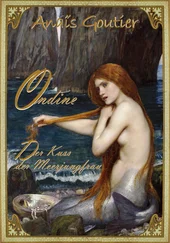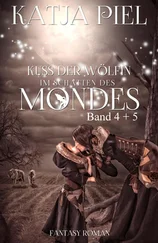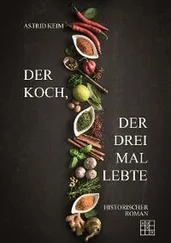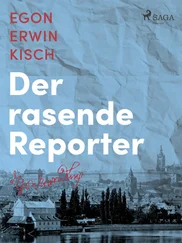Dem alten Ruzicka, der kurz nach dem Prozeß auf der Insel Kampa Wohnung genommen hatte, begegnete man noch immer mit einem romantischen Respekt: Er war Hausbesorger in dem Hause gewesen, in dem man den buckligen »Rigoletto von Toscana«, den Verräter des Geheimbundes, unter dem Weihnachtsbaum erstochen hatte.
Wenn die Flößer und Flößerburschen spät zum Mittagessen nach Hause kamen, mit brennenden Gesichtern und frisch abgerissenen Rockkragen, erzählten sie, sich rühmend, von ihren Kämpfen mit den Couleurstudenten auf dem Graben, wie sie ihre Kameraden aus den Händen der Polizei befreit oder sich selbst losgerissen hatten. Frauen und Kinder sahen sie bewundernd an, und auf den Stiegen und vor den Häusern tauschte man nachher die Erlebnisse der Gatten und Söhne aus.
Man wußte keine Motive für alles das, was vorging, aber jeder wurde mitgerissen. Es war kein neuer Haß, der da unter den Kampa-Leuten entfacht war. Aber erst jetzt bekam er seinen Namen, seine Richtung, seine Bewegungsfreiheit. Bisher hatte sich der Haß dumpf und verschlossen gegen alle Bessergestellten, alle Reichen neidvoll gekehrt, gegen alle jene, von denen man wirtschaftlich abhängig war. Jetzt hieß es: Gegen die Deutschen! Man faßte es so auf, als ob es dasselbe wäre. Was waren denn die Holzhändler, für die man sich plagte, abarbeitete, Gicht und Verletzungen holte? Deutsche! Was waren denn die Smichower und Radlitzer Fabrikanten, für die die Frauen und Mädchen schufteten? Deutsche! Die Deutschen, ja, das sind die Reichen – wir sind die Armen. Die Banken, die Beamten, die Institute, die Adeligen auf der Kleinseite – lauter Deutsche, aber die armen Flößer, die Holzarbeiter, die Fabrikarbeiter, die Kutscher, die Dienstboten, die Bettler – lauter Tschechen. Eben hatte die deutsche Sparkasse einen Ansturm von hunderttausend Einlegern ausgehalten, die plötzlich auf ein Gerücht hin ihr Geld zurückzufordern kamen, während die tschechisch-klerikale Vorschußkasse mit einem Millionendefizit verkracht war, unzählige ihrer Einleger ganz verarmend. Man las in den Zeitungen, daß sich tschechische Studenten aus Not als Arbeiter verdingen mußten, und sah zur gleichen Zeit die deutschen Studenten in Lackkanonen, mit silbernen Sporen und samtenen Hüten in Fiakerreihen durch die Straßen fahren, und selbst aus den gehässigsten Zeitungsberichten über Trunkenheitsexzesse der »Burschaken« hörte das arme Volk nur die Übermutsäußerung von finanziell nicht Besorgten heraus. Man verwechselte im tschechischen Prag die Begriffe »deutsch« und »reich«, der nationale Haß war Klassenhaß.
Immer war unter den Tschechen der Wunsch lebendig gewesen, ihren Kindern in die beneidete Sphäre Einlaß zu verschaffen, aber die Führer fühlten die doppelte Gefahr, die in der Verwirklichung eines solchen Wunsches läge, die Stärkung des feindlichen Elements und die Entnationalisierung im eigenen Lager, und deshalb wurde durch Beschlüsse der Stadtvertretung, durch Plakate, durch Schreckgeschichten der tschechischen Zeitungen, durch persönliche Interventionen, Einschüchterungen, Versprechungen nicht nur jeder Eintritt eines tschechischen Kindes, ja eines Kindes gemischtsprachiger Eltern in deutsche Schulen verhindert, sondern sogar schon die Erwägung einer solchen Absicht als schimpflichste aller Charakterlosigkeiten und nationaler Verrat gebrandmarkt.
Und nun sollte ein Flößerkind in die deutsche Schule gehen! »Die Chrapots haben es nötig«, urteilte man erregt. Aber Frau Chrapot beharrte bei ihrem Entschluß, auch als zwei Beamte des Magistrats in ihre Wohnung kamen, um sie zur Abmeldung des bereits in der deutschen Schule eingeschriebenen Zöglings zu bewegen. Der alte Chrapot, den man gleichfalls anging, wußte nichts, als die Argumente seiner Frau zu murmeln. Am schwersten war es für Frau Chrapot gewesen, den Widerstand des kleinen Jarda zu überwinden, der sich nicht von seinen bisherigen Spielkameraden trennen wollte und den Unterricht in der ihm fremden Sprache fürchtete. Erst als ihm Frau Chrapot auseinandersetzte, daß er gerade, weil er die Unterrichtssprache nicht beherrsche, vom Lehrer nicht aufgerufen werden könne, und als sie ihm ein Taschenmesser mit breiter Schale und zwei Klingen (Jarda brauchte es zum Messerspiel auf den Kampa-Bänken) versprach, war er bereit. Die Kameraden, die ihn mit den zu Hause gehörten Argumenten zu verhöhnen suchten, machte er mit der Behauptung seiner Mutter mundtot: »Die Tschechen sind nur Bettler.« Da stieg Jarda noch mehr im Ansehen.
Aber seine eigenen Abneigungen gegen die deutsche Schule waren durch die Bestechungen seiner Mutter, durch seine Zusage und dadurch, daß er die Vorwürfe seiner Freunde schlankweg zum Verstummen gebracht hatte, nicht gebrochen. Bis in die Karmeliterstraße mußte er zur deutschen Schule laufen, einen so weiten Weg in das wildfremde, fremdsprachige Reich, und die tschechische Schule war ganz nahe – eins, zwei war man auf dem Maltheserplatz. Wie oft war er den Weg mit der Betka Dvořak gelaufen, die nun schon in die dritte Klasse kam, und jetzt hätte er täglich den Weg mit ihr gehen können, und täglich hätte sie ihm neue Wunderdinge erzählt. Denn Betka Dvořak weiß Wunderdinge und kennt Wunderdinge: Sie hat fünf ältere Schwestern. Die eine ist eine Dame, hat eine Bekanntschaft mit einem Fabrikanten, einen Hut mit einer grünen Reiherfeder, ein Uhrarmband und einen Ring mit weißem Saphir und wohnt nicht zu Hause; sie kommt nur manchmal zu Besuch auf die Kampa, und dann bringt sie dem Vater eine Zigarrenspitze oder Zigarren oder Stehkragen oder ein Feuerzeug mit, oder sonst etwas, was sie ihrem Fabrikanten geklaut hat. Sie heißt eigentlich Fanka, aber sie nennt sich Emmy, weil das viel nobler ist. Die zweite Schwester, die Marenka, die hat keinen »Schamster«, weil sie häßlich ist; als sie klein war, hat sie Pocken gehabt, und das sieht man noch im Gesicht, und die Nase ist so hinaufgezogen. Die arbeitet in der Bügelanstalt und kümmert sich nicht um die Männer. Die Schönste ist die dritte, die Anna, die ist fünfzehn Jahre alt und falzt in der Druckerei, wo der Vater Setzer ist. Die hat eine ernste Bekanntschaft mit einem Raseurgehilfen aus der Brückengasse; Fanka hat ihr einen Freund ihres Fabrikanten vermittelt, die Anna hat zuerst nicht gehen wollen, aber dann hat sie dem Rudla – das ist der Friseurgehilfe – gesagt, daß sie abends nicht zum »Rande« kommen kann, weil sie krank sei und sich niederlegen müsse, aber abends ist der Rudla direkt aus dem Geschäft in die Dvořaksche Wohnung gegangen und hat gesehen, daß sie nicht zu Hause sei. Da hat er vor dem Haus die ganze Nacht gelauert – er wollte sie abpassen, bis sie nach Hause kommt. Aber die Anna ist gar nicht nach Hause gekommen, sondern ist früh von ihrem neuen Schamster direkt in die Druckerei gegangen, und erst Mittag hat der Rudla mit ihr sprechen können. Der hat ihr einen großen Krawall gemacht, und sie hat ihm schwören müssen, daß sie abends zu keinem anderen mehr gehen wird, und jetzt will sie wirklich nicht mehr gehen, obwohl sie dreißig Kronen von dem Herrn bekommen hat und er ihr noch einen Ring schenken will, und obwohl die Fanka schon zweimal zu Hause war, eigens um sie zu holen. Die Fanka hat ganz recht, wenn sie sagt, der Rudla könnt doch froh sein, wenn sich die Anna für fremdes Geld schön anziehen kann, wenn sie mit ihm spazieren geht. Aber die Anna ist so dumm und will nicht mehr zu dem Herrn gehen. Die zwei anderen Schwestern, die Katy und die Jarmila, besuchen noch die Schule, aber »die haben sich beide nicht zur Welt«, und die eine, die Jarmila, ist auch sehr häßlich.
Da ist die Betka eine ganz andere! Die geht immer zur Fanka in die Wohnung, wenn sie ihr Wäsche bringt oder die Mutter sie um Geld schickt, und da nimmt sie der Fabrikant immer auf den Schoß, tätschelt sie und sagt: »Die Betka wird einmal ein großes Luder werden.«
Читать дальше