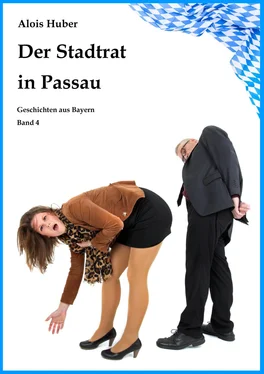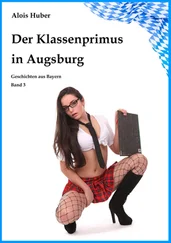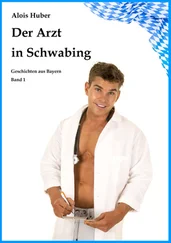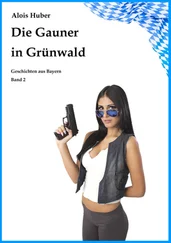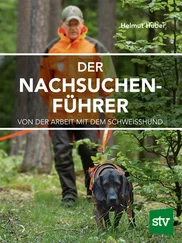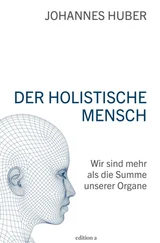„Nein, ich nehme kein Geld! Regeln Sie das lieber mit Gastwirt Hackauflauf drüben in der Waldschenke. Bei dem sollte ich das Paket Bockwürste nämlich abliefern.“
„Schön, ich werde sogleich dorthin fahren. Und Sie, Fräulein Amelie?“
„Ich muss auch zur Waldschenke.“
„Ausgezeichnet! Doch warum stehen wir noch hier? Bitte, steigen Sie ein!“
Nur einen Augenblick zögerte sie. Doch als er die Wagentür aufgerissen hatte, nahm sie ohne Widerrede Platz. Marvin geriet vor Freude darüber fast aus dem Häuschen. Hurtig hob er das beschädigte Fahrrad auf das zusammengerollte Verdeck, befestigte es mit einigen Riemen, die er glücklicherweise zur Hand hatte, und setzte sich dann wieder hinter das Steuer.
„Wohnen Sie etwa in der Waldschenke, Fräulein Amelie?“, fragte er unvermittelt.
„Nein, ich wohne in der Stadt. Ich muss nur hinaus, weil mein Tennisclub heute Abend dort ein internes Vergnügen feiert. Dazu hatte, nebenbei gesagt, Herr Hackauflauf auch die Bockwürste bestellt.“
„Aha! Aber Tennisclub sagen Sie? Richtig, Dennis wollte ja auch hin. Vorgestern erzählte er mir das. Kennen Sie Dennis Schläger?“
„Den jungen Rechtsanwalt? Natürlich! Er ist ein eifriges Mitglied unseres Clubs.“
„Und mein bester Freund. Wir haben zusammen in München studiert“, setzte Marvin Buschinski frohlockend hinzu. „Na, das nenne ich Glück!“
Amelie sah ihn forschend von der Seite an. Zum Kuckuck, überlegte sie, er ist ein Freund von Dennis, und ich kenne ihn nicht?
„Warum nennen Sie das Glück?“, fragte sie in wachsender Neugier.
„Wo Dennis Vergnügen feiert, da kann auch ich mitmachen“, erklärte Marvin zu ihrer Überraschung. „Hoffentlich schwingt Ihr Club heute Abend auch das Tanzbein!“
„Selbstverständlich!“
Er warf sich in die Brust und deutete einen Bückling an.
„Wenn dem so ist, gnädiges Fräulein – darf ich mir dann erlauben, Sie schon um alle Tänze zu bitten, die man dort aufs Parkett zu legen geneigt ist?“
„Oh, Sie sind ja recht bescheiden!“
„In diesem Fall auf keinen Fall!“, dozierte er. „Außerdem habe ich nach der schuldhaften Demolierung ihres Fahrrades doch auch die Verpflichtung, Ihnen zur Rückkehr nach Haus meinen Wagen zur Verfügung zu halten.“
„Wahrhaftig! Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber wollen Sie nicht endlich losfahren?“
„Bei Gott, ja! Mir kribbeln jetzt schon die Tanzbeine! Nur schnell noch eine Frage, Fräulein Amelie: Ich bin etliche Jahre von Passau abwesend gewesen und kenne mich unter den fünfzigtausend Einwohnern nicht mehr recht aus – wo wohnen Sie, bitte?“
„Am Residenzplatz“, antwortete sie wahrheitsgemäß.
„Sieh an! Im Angesicht des heißumstrittenen Denkmals unseres Dichterfürsten Hans Carossa also! Gestatten Sie? Ich bin der Urenkel dieses unsterblichen Passauer Dichters – Marvin Buschinski, seit zweieinhalb Monaten Doktor der Rechte und Juniorchef einer nicht unbekannten Keksfabrik.“
In diesem Augenblick wurde Amelie ganz blass.
„Du liebe Zeit – Marvin Buschinski?“, stammelte sie bestürzt.
„So heiße ich, seit ich vor sechsundzwanzig Jahren getauft wurde“, beteuerte er arglos.
„Nein, welch ein verrückter Zufall! Wissen Sie, wer neben Ihnen sitzt?“
„Ein bezauberndes Menschenkind, dem ich mein Herz zu Füßen legen möchte!“, jubelte Marvin.
„Spaßen Sie nicht, Herr Doktor Buschinski! Dieses Menschenkind ist nämlich – Amelie Kälberer, Tochter jenes garstigen Metzgermeisters am Residenzplatz, der sich wegen besagten Denkmals Ihren Herrn Vater zum Erzfeind gemacht hat!“
„Nee ...!“, fuhr Buschinski Junior da auf. „Tatsächlich? Das ist wahr? Dann – dann sind wir beiden die Kinder feindlicher Väter?“
Und kaum hatte er begriffen, dass hier der Zufall eines seiner wunderlichsten Spiele arrangiert hatte, da überkam ihn eine unwiderstehliche Lust, es aufzunehmen und weiterzutreiben. Ein so schallendes, zwerchfellerschütterndes Lachen platze dabei aus ihm heraus, dass auch Amelie Kälberer tränenden Auges mit einstimmen musste. Minutenlang schüttelten sie sich im Überschwang unbändiger Heiterkeit.
Dann hielt Marvin jäh inne.
„Dies ist ein Spaß des Schicksals, den wir nicht verderben dürfen“, rief er atemlos. „Die väterlichen Streithähne in grimmiger Parlamentsfehde und die Kinder unterdessen einträchtig bei fröhlichen Tanz! Fräulein Kälberer, nicht wankelmütig werden! Wenn die Alten sich hassen, sollen die Jungen sich lieben – machen Sie mit?“
„Das Schicksal will es wohl so!“, hauchte sie hingerissen.
Da gab Buschinski Junior Gas, und in einem besinnungslosen Rausch des Übermutes fuhren sie in der sinkenden Dämmerung des schwülen Sommerabends dem gemeinsamen Vergnügen entgegen…
Die Stadt Passau hatte wie jede Stadt eine vornehme Einkaufsstraße, die Schustergasse genannt wurde und quer durch das Zentrum verlief. Sie verband den Residenzplatz mit dem Karolinenplatz.
Der Karolinenplatz grenzt an die Innstraße, an der konzentrierte Amtsluft herrschte. Sie kam aus den Behörden ringsum, dem Finanzamt, der Agentur für Arbeit und der Universität Passau.
Ganz anders war es hingegen auf dem Residenzplatz. Hier standen ausschließlich ansehnliche Geschäftshäuser mit Schaufensterfronten, Läden aller Art, verschiedene Cafés, einer gemütlichen Cocktailbar und einem lärmerfüllten Wettbüro für Pferderennen. Hier wehte daher der frische Wind des lebendigen Alltags.
Dennoch gab es auch am Residenzplatz ein Haus mit Modergeruch. Es stand in der Mitte der Periphere und trug eine große dunkle Metalltafel mit der Inschrift:
»In diesem Haus lebte, schaffte und starb der deutsche Lyriker und Erzähler Hans Carossa, 1878-1956, Ehrenbürger der Stadt Passau«
Man glaubte nun nicht, dass dieser Hans Carossa ein Heros der Lyrik gewesen wäre. Er hatte einige Gedichtsbände geschrieben. Das war zu wenig, um Eingang in die Lehrbücher der Literaturgeschichte zu finden. Für eine Reihe Passauer Bürger hatte es indes genügt, ihm den Kranz der Unsterblichkeit zu verleihen. Sie erhoben nach seinem Ableben sein Sterbehaus zur Weihestätte, weshalb es fortan nicht mehr gelüftet wurde, und stifteten ihm außerdem noch ein Denkmal, das die Stadt in ihre Obhut nahm. Die Haupttreiber dieser erstaunlichen Ehrungen waren freilich die Angehörigen seiner weitverzweigten Sippe, allen voran sein Schwiegersohn Alois Buschinski, der seliger Vater von Horst Buschinski.
Nun also das Denkmal!
Es stand etwa zwanzig Meter vor der Front des Dichterhauses: ein dreistufiger Sockel aus rohbehauenen Quadern, aus dem eine dorische Säule anderthalb Meter hoch zu einem quadratischen Kapitell emporwuchs, und auf diesem Kapitell thronend die Büste Hans Carossas, langhaarig und bärtig wie der leibhaftige Zeus. Kenner hatten es schon bei seiner Enthüllung als dilettantisches Machwerk gekennzeichnet, das man schnellstens in die Luft sprengen sollte.
Trotzdem stand das steinerne Mal über ein halbes Jahrhundert da, ohne dass ihm ein Mensch etwas zuleide tat. Aber nun, just sechzig Jahre nach dem Ableben des Dichters, wurde ihm doch etwas angetan. Nicht, dass man es besudelte oder beschädigte. Nein, viel Schlimmeres. Man möchte es von seinem angestammten Platz entfernen und startete zu diesem Zweck eine wüste Lästerkampagne, die monatelang die ganze Stadt in Atem hielt und nun in der heutigen Ratssitzung als Punkt 5 der Tagesordnung zur Debatte stand.
Die Sache hatte übrigens eine zeitbedingte, sehr reale Ursache. Wie überall hatte sich in den letzten Jahren auch die Geschäftswelt der Passauer Innenstadt motorisiert. Es mussten täglich Lieferwagen zu den Geschäften, und deren Lenker pflegten den Platz just dort als Fahrweg zu benutzen, wo er das Dichterdenkmal trug.
Читать дальше