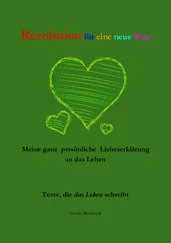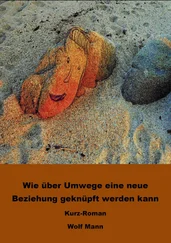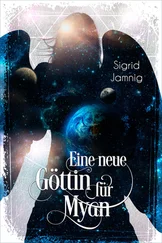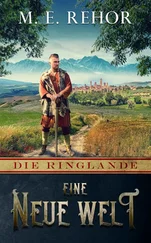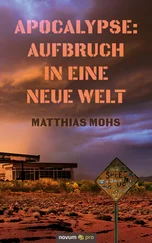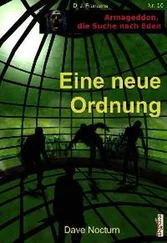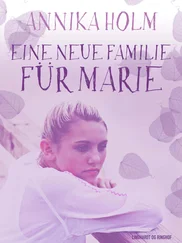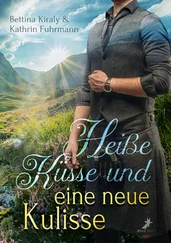«Die hervorstechenden Fehler der Wirtschaftsgesellschaft, in der wir leben, sind ihr Versagen, für Vollbeschäftigung Vorkehrung zu treffen, und ihre willkürliche und unbillige Verteilung des Reichtums und der Einkommen.»{9}
Das Denken von Keynes war nicht nur durch den Ersten Weltkrieg und die anschliessenden Friedensverhandlungen beeinflusst, sondern ebenfalls durch die Weltwirtschaftskrise der dreissiger Jahre. Zur Idee der Gleichgewichtstheoretiker, wonach sich die Märkte langfristig auf ein Gleichgewicht zubewegen, antwortete Keynes in einem Radiointerview im Jahr 1939 ironisch, dass wir auf lange Sicht ohnehin alle tot seien. In seinem Hauptwerk «General Theory» sieht Keynes die Einkommensverteilung und die Beschäftigung als die beiden grossen sozialökonomischen Probleme. In den folgenden Jahrzehnten orientierte sich die Wirtschaftspolitik in den ökonomisch fortgeschrittenen europäischen Volkswirtschaften an der regulativen Idee der Vollbeschäftigung, welche durchaus mit staatlichen Massnahmen im Sinne von Konjunkturpolitik unterstützt werden soll. In Deutschland entwickelte sich unter Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und dem Kultursoziologen Alfred Müller-Armack eine soziale Marktwirtschaft, die von der ökonomischen Lehre der Freiburger Schule (Ordoliberalismus) beeinflusst war. Auf diese neoliberale Strömung werde ich im Verlaufe dieses Plädoyers noch zurückkommen.
Gründung des Neoliberalismus
Der Neoliberalismus hat seinen Ursprung in den 1930er Jahren. Eine Gruppe liberaler Ökonomen aus verschiedenen Ländern wollte am Wirtschaftsliberalismus festhalten. Dies konnte gesellschaftspolitisch jedoch nur dann gelingen, wenn die Fehler des Laissez-faire-Kapitalismus aufgezeigt und ausgemerzt werden. Es musste also ein Weg zwischen Laissez-faire-Liberalismus und Sozialismus gefunden werden. An einem Symposion in Paris im Jahre 1938 wurden mehrere Namen für diese Gegen-Bewegung diskutiert, beispielsweise Links-Liberalismus oder Positiver Liberalismus. Letztlich haben sich die Teilnehmer auf den Namen «Neoliberalismus» geeinigt. Die einzelnen Ökonomen hatten über den einzuschlagenden Weg durchaus verschiedene Ansichten, zusammengehalten wurden sie durch das gemeinsame Feindbild des Kollektivismus, Sozialismus und des Keynesianismus. Die Neoliberalen (das weibliche Geschlecht war nicht vertreten) entwickelten eigene ökonomische Lehren, insbesondere gilt dies für die Vertreter im Umfeld der Freiburger Schule, deren Lehren als Ordoliberalismus zusammengefasst wurden. Andere führende Vertreter, allen voran Friedrich A. von Hayek, hatten jedoch weniger die Ökonomie als Wissenschaft, sondern primär die Zivilwirtschaft, das heisst die Wirtschaftspolitik im Blick.
Die Durchsetzung des Neoliberalismus wurde zu einem auf mehrere Jahrzehnte hin angelegten Projekt erklärt, das wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges zwar unterbrochen, Ende 1943 jedoch wieder aufgenommen wurde. Im April 1947 kam es zu einem zehntägigen Treffen in Mont Pèlerin (das ist ein Dorf auf dem gleichnamigen Höhenzug oberhalb von Vevey), bei dem die bis heute bestehende Mont Pèlerin Society (MPS) gegründet wurde. Die ersten 15 bis 20 Jahre der MPS waren durch vier wichtige Entwicklungen geprägt: Erstens wurde die Zahl der Mitglieder stark erhöht und international ausgeweitet. Zweitens erfolgte eine Phase der Reinigung und Klärung, so dass sich ein neoliberales Mainstream-Denken entwickeln konnte. Drittens erzielten Mitglieder der MPS in der breiten Öffentlichkeit mit ihren Publikationen grosse Erfolge, zudem wurden Einzelne sogar mit dem Nobelpreis geehrt. Und schliesslich viertens wurden die international zahlreich gegründeten Think tanks zu einem wichtigen Mittel, um auf Publizistik, Ausbildung und Wirtschaftspolitik einzuwirken. Zwischen den Mitgliedern der MPS gab es im Laufe der Zeit wegen der wirtschaftspolitischen Orientierung heftige Auseinandersetzungen. Während die Ordoliberalen im Umfeld der Freiburger Schule ein Gleichgewicht zwischen Staat und wirtschaftlicher Freiheit anstrebten, räumten die vorwiegend im angelsächsischen Sprachraum lehrenden Ökonomen dem Markt die Priorität ein.
Mit dem Ausscheiden wichtiger Ordoliberaler gewann der angelsächsisch geprägte Pol letztlich die Oberhand. Da diese Vertreter keine eigentliche Lehre zur Mikroökonomie{b} entwickelten, orientierte sich der angelsächsische Neoliberalismus an der Neoklassik mit ihren mathematischen Modellannahmen. Das hatte zur Konsequenz, dass nach dem Neoliberalismus es dann zum bestmöglichen gesellschaftlichen Zustand kommt, wenn die Wirtschaftsakteure ihren eigenen Nutzen bzw. Gewinn optimieren können. Den Wirtschaftsakteuren soll deshalb möglichst viel Freiheit zugestanden werden, damit die Eigennutzen- und Gewinnoptimierung tatsächlich auch durchgesetzt werden kann. Der Staat hingegen soll sich weitgehend zurückhalten, weil seine Eingriffe die Eigennutzen- und Gewinnoptimierung tendenziell behindern. Die Parolen der weltweit unzähligen neoliberalen Think tanks waren und sind bis heute dem entsprechend: Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung, Steuersenkungen und Freihandel.
Neoliberalismus gewinnt Bedeutung
In den 1970er Jahren kam es, verbunden mit dem starken Anstieg des Erdölpreises, in den Industrieländern zu schweren Rezessionen, besonders in den USA und in Grossbritannien. In beiden Ländern zeigte sich ein schwerer ökonomischer Niedergang, begleitet von lautstark vorgetragenen neuen sozialen Ansprüchen. Bei den Politikern herrschte Verwirrung, Angst und sogar Panik, denn sie konnten nicht verstehen, weshalb die bislang so zuverlässige keynesianische Theorie den ökonomischen Niedergang nicht umzukehren vermochte. Das war die Stunde der Neoliberalen. Mit den Worten der emeritierten, hoch angesehenen Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff:
«Das war die Chance, auf die neoliberale Ökonomen gewartet hatten, und ihre Ideen strömten denn auch sofort in das »wirtschaftspolitische Vakuum«, das den beiden Regierungen so zu schaffen machte.»{10}
Mit dem Ende des Keynesianismus wurden der angelsächsisch geprägte Neoliberalismus und die Neoklassik zur Mainstream-Ökonomie. Das heisst, an den Hochschulen stand ab den 1980er Jahren die neoklassischen ökonomischen Ideen wieder im Zentrum der Lehre, während sich die Wirtschaftspolitik dem Neoliberalismus zuwandte. Nach dem ersten neoliberalen Experiment in Chile unter dem Diktator Pinochet haben sich die beiden Volkswirtschaften Grossbritannien (unter Margaret Thatcher) und USA (unter Ronald Reagan) explizit den Neoliberalismus als wirtschaftspolitische Grundlage genommen.
Neoliberalismus und seine Konsequenzen
Die neoliberale Wirtschaftspolitik hatte für die einzelnen Volkswirtschaften grosse Konsequenzen. Wirtschaftsakteure, insbesondere multinationale Unternehmen, konnten sich mit der zunehmenden Deregulierung und Liberalisierung nach den bestmöglichen Bedingungen hinsichtlich ihrer Gewinnmöglichkeiten ausrichten und vermochten dadurch den nationalen Standortwettbewerb in einer bislang unbekannten Dimension zu befeuern. Das führte zur Konsequenz, dass in der Folge alle ökonomisch entwickelten Volkswirtschaften die Dynamik der Liberalisierung und Deregulierung mitmachen mussten. Die Daten einer Studie des Max-Planck-Instituts zu 21-OECD-Ländern im Zeitraum zwischen 1980 und 2005 widerspiegeln diese Situation. Die Autoren schreiben:
«Die für beide Zeitpunkte angegebenen länderbezogenen Mittelwerte zeigen an, dass es über den Untersuchungszeitraum hinweg insgesamt einen deutlichen Liberalisierungstrend gegeben hat, von dem ausnahmslos alle Länder betroffen waren. Das gilt auch für die USA, wo trotz des hohen Ausgangsniveaus an Marktliberalität im betrachteten Zeitraum weiter Liberalisierungspolitik zur Anwendung kam.»{11}
Sehr deutlich zeigt sich die Liberalisierungsdynamik anhand der Entwicklung der Unternehmenssteuern. Der durchschnittliche Steuersatz für Unternehmen der 28 EU-Mitgliedstaaten ist zwischen 1996 und 2018 von 38 auf 21.3 Prozent gesunken.{12} Eine weitere Konsequenz der neoliberalen Wirtschaftspolitik sind die bis heute andauernden Megafusionen. ETH-Forscher haben im Jahre 2011 in einer Studie über die Verflechtungen der globalen Unternehmen festgestellt, dass 147 Konzerne 40 Prozent des weltweiten Wirtschaftsumsatzes erzielen und dabei sich mit ihren Beteiligungen gegenseitig beinahe vollständig kontrollieren.{13} Wir können mit Sicherheit annehmen, dass diese Konzentration inzwischen noch weiter fortgeschritten ist. Die wichtigste, jedoch wenig bemerkte Veränderung mit dem Aufkommen des Neoliberalismus ist allerdings die Tatsache, dass eine ökonomische Lehre, die nicht auf empirisch gehaltvollen Theorien, sondern auf mathematischen Modellen basiert, die heutige Wirtschaftspolitik prägt. Der frühere ETH-Professor und Leiter der Konjunkturforschungsstelle Bernd Schips hat in seiner Abschiedsrede den Mut gefasst, diese Situation offenzulegen. Er schreibt:
Читать дальше