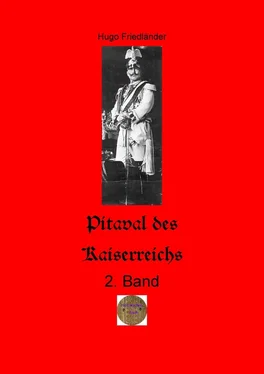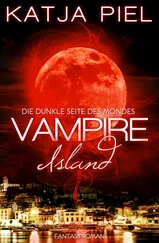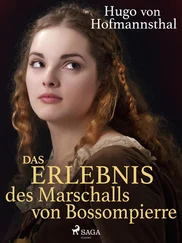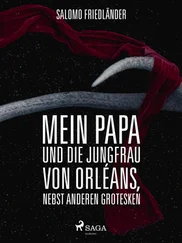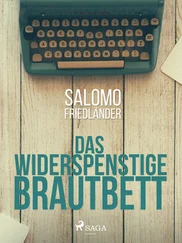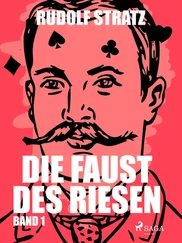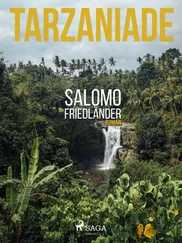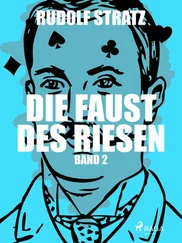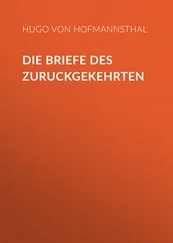Hugo Friedländer - Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band
Здесь есть возможность читать онлайн «Hugo Friedländer - Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Berlin, den 21. Juli 1870.
A. Bebel. W. Liebknecht.«
Diese Erklärung entfesselte einen kaum zu schildernden Sturm der Entrüstung nicht nur in allen bürgerlichen Parteien, sondern auch unter den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeiter-Vereins. Selbst der Ausschuß der sozialdemokratischen Arbeiter-Partei Eisenacher Richtung war mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. »Landesverräter« war die mildeste Bezeichnung für Liebknecht und Bebel. Die Sozialdemokraten Eisenacher Richtung wurden allerorten aufs schmählichste beschimpft. Obwohl in dem damaligen Wohnort von Liebknecht und Bebel, in Leipzig, die Eisenacher Sozialdemokraten verhältnismäßig zahlreich waren, wurden Liebknecht und Bebel in Leipzig auf offener Straße behelligt und eines Nachts, als Liebknecht sich gerade in einer Versammlung befand, in der Liebknechtschen Wohnung die Fenster eingeschlagen. Ein großer Stein, der durchs Fenster geflogen kam, hätte beinahe dem ältesten Sohn Liebknechts, den Frau Natalie Liebknecht gerade an der Mutterbrust hatte, den Kopf zertrümmert. Bebels Wohnung blieb verschont, da dieser in der Petersstraße im Hofe wohnte. Die Erregung wuchs, als nach der Schlacht von Sedan, der Gefangennahme Napoleons und der Proklamierung der Republik in Paris im »Volksstaat«, dem von Liebknecht redigierten Zentralorgan der Eisenacher Sozialdemokraten, an der Spitze jeder Nummer zu lesen war: »Ein billiger Friede mit der französischen Republik! Keine Annexion! Bestrafung Bonapartes und seiner Mitschuldigen.« Am 5. September 1870 erließ der zu Braunschweig domizilierte Ausschuß der sozialdemokratischen Partei Eisenacher Richtung ein Manifest in demselben Sinne. Am 6. September erfolgte die Veröffentlichung, und am 9. September wurde der gesamte Ausschuß, Kaufmann Wilhelm Bracke jr., Oberlehrer Spier, Ingenieur Leonard v. Bornhorst, Gralle und Kühn nebst dem Druckereibesitzer Sievers und einem Braunschweiger Sozialdemokraten, namens Ehlers, auf Befehl des Höchstkommandierenden der Armee in den deutschen Küstenländern auf Grund des proklamierten Kriegszustandes verhaftet und in Ketten geschlossen nach der ostpreußischen Festung Lötzen abgeführt. Sehr bald darauf traf das gleiche Schicksal den Vorsitzenden der Kontrollkommission der »Eisenacher«, den Hamburger Buchhändler August Geib und den Vertreter des zweiten Berliner Landtagswahlbezirks, Abgeordneten Dr. med. Johann Jacoby in Königsberg in Preußen, der in der Königsberger Stadtverordnetenversammlung sich gegen jede Annexion erklärt hatte. Dr. Jacoby war aber keineswegs der einzige bürgerliche Demokrat, der gegen die Annexion protestierte. Obwohl die Norddeutsche Allgemeine Zeitung die Mitteilung brachte: Jeder, der sich öffentlich gegen die Annexion erklärt, macht sich des Landesverrats schuldig, erließen die Mitglieder des bürgerlichen »Demokratischen Vereins« in Berlin, an der Spitze Dr. Guido Weiß und Färbereibesitzer William Spindler, damals Chef der Weltfirma W. Spindler, im Verein mit einer Anzahl Berliner Sozialdemokraten Eisenacher Richtung eine mit Namen unterzeichnete öffentliche Protesterklärung gegen die Weiterführung des Krieges und gegen die Annexion von Elsaß-Lothringen. Die Legislaturperiode des Reichstages war am 31. August 1870 erloschen. Aus Anlaß des Krieges wurde sie aber bis Ende Dezember 1870 verlängert. Wenige Tage vor Weihnachten wurde der Norddeutsche Reichstag geschlossen und die Wahlen für den ersten deutschen Reichstag ausgeschrieben. Liebknecht und Bebel kehrten von Berlin nach Leipzig zurück. Am folgenden Morgen in aller Frühe wurden beide und der Redakteur des »Volksstaat« Adolf Hepner verhaftet. In demselben Augenblick übernahm der verstorbene Journalist Carl Hirsch, damals Redakteur des sozialdemokratischen »Bürger- und Bauernfreund« in Krimmitschau, die Redaktion des »Volksstaat«. Am 28. März 1871 öffneten sich den drei Verhafteten die Pforten des Untersuchungsgefängnisses. Inzwischen fanden am 3. März 1871 die Reichstagswahlen statt. Die Sozialdemokraten beider Richtungen erlitten eine arge Niederlage. In Berlin war von den »Eisenachern« in Gemeinschaft mit den bürgerlichen Demokraten, und zwar in allen sechs Kreisen Dr. Johann Jacoby aufgestellt. In ganz Berlin wurden 6400 Stimmen für Dr. Jacoby abgegeben. Von den Mitgliedern des Allgemeinen deutschen Arbeiter-Vereins war in allen sechs Berliner Wahlkreisen Maurer Grau, ein ganz vorzüglicher Redner, aufgestellt. Er erhielt in ganz Berlin noch nicht 4000 Stimmen. In ganz Deutschland wurden 124655 sozialdemokratische Stimmen abgegeben. Von den sozialdemokratischen Reichstagskandidaten wurde lediglich Bebel in Glauchau-Meerane gewählt. Auch Liebknecht war in seinem alten Wahlkreise Schneeberg-Stollberg durchgefallen. Außer Bebel waren noch zwei bürgerliche Demokraten, der Verleger der »Frankfurter Zeitung«, Leopold Sonnemann, und Rechtsanwalt Schraps (Zwickau) gewählt. Die Mitglieder des Braunschweiger Ausschusses wurden sechs volle Monate in Haft behalten. Im November 1871 hatten sie sich in Braunschweig wegen Hochverrats zu verantworten, sie wurden jedoch nur wegen Vergehen gegen die öffentliche Ordnung verurteilt. Nach Beendigung des Prozesses strengten sie gegen den General Vogel von Falckenstein auf dem Zivilwege die Entschädigungsklage an. Der General wurde auch schließlich zu einer hohen Entschädigungssumme verurteilt, die ihm der Kaiser als Gnadengeschenk verehrte.
Inzwischen wurde gegen Liebknecht, Bebel und Hepner Anklage wegen »vorbereitender Handlungen zum Hochverrat« erhoben. Die Staatsanwaltschaft behauptete: Die verschiedenen Zeitungsartikel, öffentliche Reden, Broschüren und Briefe der Angeklagten aus den letzten zehn Jahren, aber auch Zeitungsartikel, Reden, Broschüren und Briefe anderer Sozialdemokraten, selbst von solchen, die längst verstorben oder auch zu den Gegnern übergetreten waren, seien in ihrer Gesamtheit vorbereitende Handlungen zum Hochverrat. So begann nun am Montag, den 11. September 1872, vor dem Leipziger Bezirksschwurgericht unter ungeheurem Andrange des Publikums der Prozeß. Die sächsische Staatsregierung hatte zwei Mitglieder des Königl. Stenographischen Instituts zu Dresden mit der stenographischen Aufnahme der Verhandlungen beauftragt. Den Gerichtshof bildeten Bezirksgerichtsdirektor von Mücke (Vorsitzender), Bezirksgerichtsräte Mansfeld und von Knappstädt (Beisitzende) und Bezirksgerichtsrat Weiske als Ersatzrichter. Die Staatsanwaltschaft vertrat Staatsanwalt Hoffmann. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Freytag I (Leipzig) für Liebknecht und Hepner und Rechtsanwalt Freytag II (Plauen) für Bebel. Die Geschworenenbank bildeten Rittergutsbesitzer Winning aus Mölbis, Kommunegutspächter Kunze aus Grausnig, Oberförster Borner aus Seidewitz, Kaufmann Edmund Oskar Göhring aus Leipzig, Gutsbesitzer Hoffmann aus Naunhof, Kaufmann G. Jakob Harder aus Leipzig, Rittergutspächter Steiger aus Schweta, Kaufmann Karl Heinrich Benzien aus Leipzig, Kaufmann und Ratsmann August Koch aus Lausigk, Kaufmann Reinhard Steckner aus Pegau und Kaufmann Karl Gustav Platzer aus Leipzig. Nach Feststellung der Personalien Liebknechts wurde sofort ein langes Aktenstück der Gießener Polizei verlesen, das mit den Worten begann: »Liebknecht soll in seiner Jugend ein Trauerspiel geschrieben haben, das aber nicht aufgeführt wurde.« Alsdann wurde die politische Tätigkeit Liebknechts, wonach er an allen möglichen Verschwörungen teilgenommen habe, in ausführlicher Weise geschildert. Das Aktenstück schloß mit den Worten: »In Berlin und in Sachsen wird man von der politischen Tätigkeit Liebknechts mehr Kenntnis haben als hier, da er bereits seit 22 Jahren aus Gießen fort ist.« Darauf nahm das Wort Angeklagter Liebknecht: Das soeben verlesene Opus der Gießener Polizei versetzt mich in die Notwendigkeit, wenigstens in den Grundzügen ein wahres Bild meines Lebens zu entwerfen gegenüber diesem Zerrbild. Das Aktenstück ist ein kurioses Beispiel davon, wie die Tatsachen sich in einem Polizeihirn spiegeln und vollkommen entstellt zurückgeworfen werden. Die absolute Unfähigkeit des Verfassers, die Wahrheit zu erkennen, die Dinge so zu sehen und zu schildern, wie sie sind, geht schon zur Genüge aus der Behauptung hervor die von ihm so freundlich gemachten Aufschlüsse über alle möglichen Verschwörungen im allgemeinen und den Kommunistenverband im besonderen seien nicht dem berüchtigten »Schwarzen Buche« entnommen, das bloß ein Verzeichnis von politischen Verbrechern enthalte. Ich habe das »Schwarze Buch« hier in der Hand. Es ist, wie Sie, meine Herren Richter und Geschworenen sehen, ein respektabler Oktavband, und Sie können sich durch den Augenschein überzeugen, daß das fragliche Verzeichnis allerdings vorhanden ist, aber nur den Anhang des Hauptwerks bildet. Und Sie können sich weiter überzeugen – ich werde das Buch dem Gerichtshofe durch meinen Anwalt überreichen lassen –, daß fast alle Enthüllungen des Gießener Polizeielaborats zum Teil wörtlich diesem »Schwarzen Buch« entlehnt sind. Entweder hat also der Anfertiger des Opus das »Schwarze Buch«, von dem er schreibt, gar nicht gekannt, oder er hat – aus welcher Ursache, bleibe dahingestellt – nur das letzte Stück gesehen und den Rest ignoriert. In jedem von beiden Fällen kommt seine Wahrheitsliebe gleich sehr ins Gedränge. Was ist aber das Zeugnis eines Mannes wert, der nicht einmal in bezug auf eine so einfache, mit Händen zu greifende Tatsache die Wahrheit zu sagen vermag? Da ich einmal vom »Schwarzen Buch« rede, das den Schatten der traurigsten Epoche unserer Geschichte hierher wirft, so sei kurz bemerkt, daß es in verschiedenen Variationen existiert, und daß die in meinem Besitze befindliche amtliche Musterausgabe den Titel führt: »Die Kommunisten-Verschwörungen des neunzehnten Jahrhunderts, im amtlichen Auftrage, zur Benutzung der Polizeibehörden der sämtlichen Deutschen Bundesstaaten, auf Grund der betreffenden gerichtlichen und polizeilichen Akten, dargestellt von Dr. jur. Wermuth, Königlich Hannoverscher Polizeidirektor, und Dr. jur. Stieber, Königlich Preußischer Polizeidirektor, – Berlin 1853. Druck von A.W. Hayn.« Die zwei Verfasser sind wohlbekannt. Herr Wermuth ist mittlerweile gestorben, Herr Stieber dagegen lebt noch und ist sogar sehr lebendig in diesem Augenblick. Auf den Inhalt des »Schwarzen Buches« einzugehen, habe ich keine Veranlassung. Es ist polizistische Geschichtsschreibung – das sagt alles. Ebensowenig kann ich mich mit den Plagiaten des Gießener Polizeidirektors befassen. Was geht mich Babeuf an, der 30 Jahre vor meiner Geburt guillotiniert wurde? Was Mazzini, der, wie männiglich bekannt, ein erbitterter Feind des Sozialismus ist? Was Fieschis Höllenmaschine, die explodierte, als ich noch mit der Schulmappe unter dem Arme in die Sexta ging? Was geht mich der »Bund der Geächteten« und der »Bund der Gerechten« an? Und weshalb verliest man dieses Zeug? Mit diesem Prozeß hat es nicht das geringste zu tun. Aber freilich, es ist ganz darauf berechnet, mich im ungünstigsten Lichte erscheinen zu lassen und mich den Geschworenen als Schinderhannes oder »Carlo Moor« hinzustellen. Es ist grundfalsch, daß ich in dem berüchtigten Kölner Kommunistenprozeß eine hervorragende Rolle gespielt habe. Ich war an diesem Prozeß direkt gar nicht beteiligt; ich war weder Angeklagter noch Zeuge. Freilich kam mein Name in der öffentlichen Prozeßverhandlung häufig vor, aber nur, weil er auf einem infam gefälschten Aktenstück stand, das Herr Stieber, um die Verurteilung der Angeklagten zu erwirken, produziert hatte. Ich rede von dem sogenannten »Protokollbuch«, das die Sitzungsberichte der Londoner Gemeinde enthalten und von mir als Schriftführer mit unterzeichnet sein sollte. Die Fälschung wurde sofort nachgewiesen und öffentlich vom Gerichtshof festgestellt. Trotzdem ist Herr Stieber heute noch im Amt und hoch in Gnaden und Ehren, während ich auf der Bank der Angeklagten sitze – ein Kontrast, eminent charakteristisch für unsere neueste Ära des Ruhmes und der nationalen Wiedergeburt. Und nun ein kurzes curriculum vitae. Einer Beamtenfamilie entstammend, war ich von meinen Angehörigen – den Vater hatte ich früh verloren – für die Beamtenlaufbahn bestimmt. Allein schon auf dem Gymnasium lernte ich die Schriften Saint Simons kennen, die mir eine neue Welt eröffneten. Zu einem »Brotstudium« hatte ich ohnehin keine Neigung. Ich wollte studieren, um mich auszubilden, um meine Pflichten in Staat und Gesellschaft erfüllen zu können. Mit 16 Jahren kam ich auf die Universität, nachdem ich im Abiturientenexamen die erste Note empfangen hatte. Ich bemerke das, nicht um zu prahlen, sondern um das Gießener Polizeimachwerk zu kennzeichnen, das mich zum verkommenen Subjekt stempeln will. Wie schon angedeutet, studierte ich die verschiedensten Materien. Ich tastete hin und her, gleich jedem Studenten, der wirklich lernen will und nicht in der Zwangsjacke eines Brotstudiums steckt. Den Gedanken, in den Staatsdienst zu treten, gab ich endgültig auf, da er sich mit meinen politisch-sozialen Anschauungen nicht vertrug. Aber ich hegte eine Zeitlang den Plan, Privatdozent zu werden, und hoffte, vielleicht auf einer der kleineren, unabhängigen Universitäten eine Professur zu erlangen. Doch in diesem Wahn wiegte ich mich nicht lange. Ich überzeugte mich, daß ich, ohne meine Grundsätze zu opfern, nicht die mindeste Aussicht hatte, die Lehrberechtigung zu bekommen, und faßte deshalb im Jahre 1847 den Entschluß zur Auswanderung nach Amerika. Ungesäumt traf ich die nötigen Vorbereitungen und war schon auf der Reise nach einem Seehafen begriffen, als ich zufällig im Postwagen die Bekanntschaft eines in der Schweiz als Lehrer ansässigen Mannes machte, der meinen Plan mißbilligte und mir, unter Hinweis auf die allem Anschein nach nahe bevorstehende Umgestaltung der europäischen Verhältnisse, mit so beredten Worten die Übersiedelung nach der republikanischen Schweiz riet, daß ich auf der nächsten Poststation umkehrte und, statt nach Hamburg, nach Zürich fuhr. Dort wollte ich mir auf den Wunsch mehrerer Staatsbeamten, an die ich von meinem neugewonnenen Freund empfohlen war und die sich gegenwärtig zum Teil in hervorragenden Stellungen befinden, das Bürgerrecht erwerben und mich der Advokatenkarriere widmen. Liebknecht schilderte alsdann seine Tätigkeit in der Schweiz und in Paris und fuhr darauf fort: Herwegh bereitete seinen bekannten Zug vor; ich schloß mich an und tat mein möglichstes im Interesse des Unternehmens. Es handelte sich um die Erkämpfung der deutschen Republik. Der Moment schien mir günstig. Ich wäre in meinen eigenen Augen ein Feigling oder ein Verräter gewesen, hätte ich anders gehandelt. Sie sehen, meine Herren Richter und Geschworenen, ich verleugne nicht meine Vergangenheit, nicht meine Grundsätze und Überzeugungen. Ich leugne nichts, ich verhehle nichts. Und um zu zeigen, daß ich ein Gegner der Monarchie, der heutigen Gesellschaft bin und wenn die Pflicht es erheischt, auch nicht vor dem Kampf zurückschrecke, dazu bedürfte es fürwahr nicht der albernen Erfindungen dieses Gießener Polizeimachwerks. Ich spreche es hier frei und offen aus: Seit ich fähig bin, zu denken, bin ich Republikaner, und als Republikaner werde ich sterben. Liebknecht schilderte alsdann seine Beteiligung am Badischen Aufstande, seine Gefangennahme, seine neunmonatige Gefangenschaft und seine Übersiedelung nach der Schweiz. Er wurde schließlich auf bundesratlichen Befehl aus der Schweiz transportiert und den französischen Behörden überliefert, die ihn mit einer Zwangspost nach London schickten. In London, so etwa fuhr Liebknecht fort, lebte ich 13 Jahre lang, mit politisch-sozialen Studien beschäftigt, noch mehr mit dem Kampf um das Dasein. Mitte 1862 wurde ich von August Braß, dem roten Republikaner von 1848, der uns in der Fehde mit dem Plonplonisten Karl Vogt drei Jahre zuvor sekundiert hatte, zum Eintritt in die Redaktion der von ihm in Berlin neubegründeten »Norddeutschen Allgemeinen Zeitung« eingeladen. Die Rückkehr nach Deutschland war mir durch die inzwischen publizierte Amnestie ermöglicht. Bekämpfung des Bonapartismus nach außen und des falschen Bourgeoisliberalismus nach innen, im Sinne der Demokratie und des Republikanismus (zu dem Herr Braß, damals noch »Bürger der Republik Genf«, sich mit großer Emphase bekannte), bildeten das Programm, auf Grund dessen ich im August 1862 den angebotenen Posten übernahm. Anfangs ging alles gut. Doch es dauerte nicht lange, so kam – Ende September 1862 – Herr von Bismarck ans Ruder, und ich merkte bald, daß sich eine Änderung in der Haltung des Blattes vollzog. Ich schöpfte Verdacht und äußerte ihn; Braß leugnete hartnäckig, daß er Verpflichtungen gegen das neue Ministerium eingegangen sei und gab mir carte blanche in meinem Departement (der auswärtigen Politik). Doch die Verdachtsmomente häuften sich. Ich erlangte schließlich die Beweise, daß und wie Braß sich an Herrn von Bismarck als literarischer Hausknecht verdingt hatte. Es ist selbstverständlich, daß ich mein Verhältnis zur »Norddeutschen Allgemeinen Zeitung« nun lösen mußte, obgleich ich damit auf meine einzige Erwerbsquelle verzichtete. Um jene Zeit und später wurden wiederholt Versuche gemacht, auch mich zu kaufen. Ich kann nicht positiv sagen, daß Herr von Bismarck mich kaufen wollte, aber ich kann sagen, daß Agenten des Herrn von Bismarck mich kaufen wollten, und zwar unter Bedingungen, die, außer vor mir selbst und meinen Parteigenossen, meine persönliche Würde gewahrt hätten. Herr von, jetzt Fürst Bismarck nimmt nicht bloß das Geld, sondern auch die Menschen, wo er sie findet. Welcher Partei jemand angehört, ist ihm gleichgültig. Apostaten zieht er sogar vor; denn ein Apostat ist der Ehre bar und darum ein willenloses Werkzeug in den Händen des Meisters. Der preußischen Regierung kam damals sehr viel darauf an, die widerspenstige Bourgeoisie zu Paaren zu treiben. Man wollte sie nach dem von dem englischen Torychef Disraeli vor dreißig Jahren gegebenen Rezept, zwischen Junkertum und Proletariat, wie zwischen zwei Mühlsteinen zermalmen, falls sie nicht vorzöge, sich zu fügen. Man stellte mir und meinen Freunden wiederholt die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« für Artikel extrem-sozialistischer, ja kommunistischer Richtung zur Verfügung. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich mich zu diesem schnöden Spiel nicht mißbrauchen ließ und die Bestechungsversuche der Agenten des Herrn von Bismarck mit gebührender Verachtung zurückwies. Hätte ich dies nicht getan, hätte ich die Niederträchtigkeit besessen, meine Prinzipien meinem persönlichen Interesse zu opfern, ich wäre jetzt in glänzender Stellung, anstatt hier auf der Bank der Angeklagten, wohin mich die gebracht haben, die mich vor Jahren vergebens zu kaufen suchten. Sobald der Berliner Polizei meine Weigerung bekannt wurde, die mich bis dahin unbehelligt gelassen hatte, begann eine Reihe von Schikanen. Jedoch man nahm vorläufig von entscheidenden Schritten gegen mich Abstand. Man mochte die Hoffnung, mich schließlich doch mürbe zu machen, nicht aufgegeben haben.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Pitaval des Kaiserreichs, 2. Band» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.