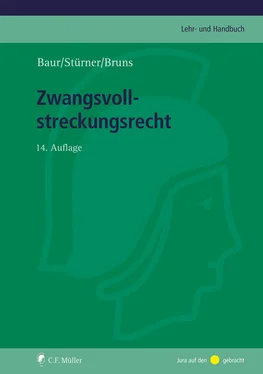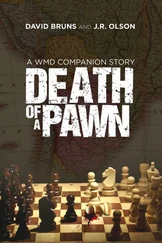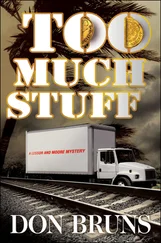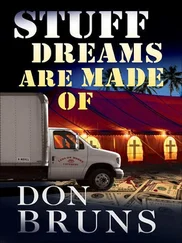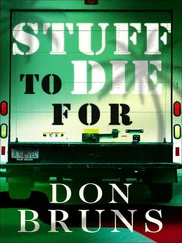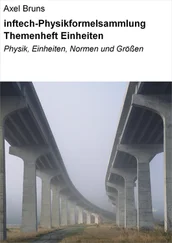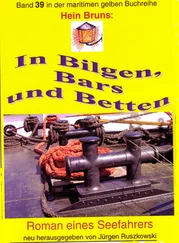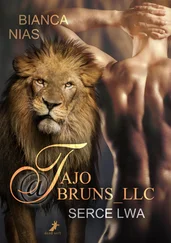1. 1. Erkenntnisverfahren ohne nachfolgende Zwangsvollstreckung 1.5 Dies ist sogar praktisch die Regel: Der Schuldner beugt sich dem Urteil und befolgt es freiwillig. Aber unabhängig davon sind nur solche Urteile vollstreckbar, die dem Schuldner ein Tun oder Unterlassen gebieten (Leistungsurteile). Feststellungsurteile und Gestaltungsurteile haben – von der Kostenentscheidung abgesehen – keinen vollstreckungsfähigen Inhalt; jene nicht, weil sie die Rechtslage nur feststellen, also kein Leistungsgebot enthalten, diese nicht, weil sie mit der Rechtskraft unmittelbar die Rechtsänderung herbeiführen. Nur Leistungsurteile sind sonach vollstreckbar.
Erkenntnisverfahren ohne nachfolgende Zwangsvollstreckung 1. Erkenntnisverfahren ohne nachfolgende Zwangsvollstreckung 1.5 Dies ist sogar praktisch die Regel: Der Schuldner beugt sich dem Urteil und befolgt es freiwillig. Aber unabhängig davon sind nur solche Urteile vollstreckbar, die dem Schuldner ein Tun oder Unterlassen gebieten (Leistungsurteile). Feststellungsurteile und Gestaltungsurteile haben – von der Kostenentscheidung abgesehen – keinen vollstreckungsfähigen Inhalt; jene nicht, weil sie die Rechtslage nur feststellen, also kein Leistungsgebot enthalten, diese nicht, weil sie mit der Rechtskraft unmittelbar die Rechtsänderung herbeiführen. Nur Leistungsurteile sind sonach vollstreckbar.
1.5 1. Erkenntnisverfahren ohne nachfolgende Zwangsvollstreckung 1.5 Dies ist sogar praktisch die Regel: Der Schuldner beugt sich dem Urteil und befolgt es freiwillig. Aber unabhängig davon sind nur solche Urteile vollstreckbar, die dem Schuldner ein Tun oder Unterlassen gebieten (Leistungsurteile). Feststellungsurteile und Gestaltungsurteile haben – von der Kostenentscheidung abgesehen – keinen vollstreckungsfähigen Inhalt; jene nicht, weil sie die Rechtslage nur feststellen, also kein Leistungsgebot enthalten, diese nicht, weil sie mit der Rechtskraft unmittelbar die Rechtsänderung herbeiführen. Nur Leistungsurteile sind sonach vollstreckbar.
2. 2. Vollstreckungsverfahren ohne vorangegangenes Erkenntnisverfahren 1.6 Aus Zweckmäßigkeitsgründen hat das Gesetz neben den Urteilen auch andere „Titel“ als Grundlage der Zwangsvollstreckung anerkannt, so z.B. die vollstreckbaren notariellen Urkunden (der Schuldner unterwirft sich selbst der Zwangsvollstreckung, § 794 Abs. 1 Nr. 5), die gerichtlichen Vergleiche (unter Verzicht auf ein Urteil anerkennt der Schuldner vergleichsweise eine bestimmte Leistungspflicht, § 794 Abs. 1 Nr. 1), die Vollstreckungsbescheide (der Schuldner hat davon abgesehen, sich gegen einen gerichtlichen Mahnbescheid fristgemäß durch Widerspruch zu wehren, § 794 Abs. 1 Nr. 4).
Vollstreckungsverfahren ohne vorangegangenes Erkenntnisverfahren 2. Vollstreckungsverfahren ohne vorangegangenes Erkenntnisverfahren 1.6 Aus Zweckmäßigkeitsgründen hat das Gesetz neben den Urteilen auch andere „Titel“ als Grundlage der Zwangsvollstreckung anerkannt, so z.B. die vollstreckbaren notariellen Urkunden (der Schuldner unterwirft sich selbst der Zwangsvollstreckung, § 794 Abs. 1 Nr. 5), die gerichtlichen Vergleiche (unter Verzicht auf ein Urteil anerkennt der Schuldner vergleichsweise eine bestimmte Leistungspflicht, § 794 Abs. 1 Nr. 1), die Vollstreckungsbescheide (der Schuldner hat davon abgesehen, sich gegen einen gerichtlichen Mahnbescheid fristgemäß durch Widerspruch zu wehren, § 794 Abs. 1 Nr. 4).
1.6 2. Vollstreckungsverfahren ohne vorangegangenes Erkenntnisverfahren 1.6 Aus Zweckmäßigkeitsgründen hat das Gesetz neben den Urteilen auch andere „Titel“ als Grundlage der Zwangsvollstreckung anerkannt, so z.B. die vollstreckbaren notariellen Urkunden (der Schuldner unterwirft sich selbst der Zwangsvollstreckung, § 794 Abs. 1 Nr. 5), die gerichtlichen Vergleiche (unter Verzicht auf ein Urteil anerkennt der Schuldner vergleichsweise eine bestimmte Leistungspflicht, § 794 Abs. 1 Nr. 1), die Vollstreckungsbescheide (der Schuldner hat davon abgesehen, sich gegen einen gerichtlichen Mahnbescheid fristgemäß durch Widerspruch zu wehren, § 794 Abs. 1 Nr. 4).
3. 3. Gleichzeitiges Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren 1.7 Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren können gleichzeitig stattfinden, so wenn der Kläger aus einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteile des Gerichts erster Instanz die Zwangsvollstreckung betreibt, während der Erkenntnisprozess auf das Rechtsmittel des Beklagten hin noch in der Berufungs- oder Revisionsinstanz schwebt. 1.8 Das bisher Gesagte lässt sich durch ein einfaches Beispiel verdeutlichen: G hat dem S nach seiner Behauptung ein Darlehen von € 2500 gegeben. Ist es zur Rückzahlung fällig, so darf G den S mahnen (§§ 286 Abs. 1, 281 Abs. 1 S. 1 BGB). Er darf ihm auch androhen, dass er im Falle nicht prompter Erfüllung künftig keinen Kredit mehr gewähren werde, dass er ihm keine Waren liefern werde usw. Alle diese Mittel zur Rechtsverwirklichung liegen im Rahmen der Rechts- und Sittenordnung. Er darf aber die € 2500 dem S nicht gewaltsam, d.h. gegen dessen Willen, wegnehmen, auch wenn dies leicht möglich wäre. Er muss vielmehr die Hilfe des Gerichts in Anspruch nehmen, also Leistungsklage bei dem zuständigen Amtsgericht erheben. Das Urteil des Amtsgerichts ist dann die Grundlage der Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher, u.U. auch wenn beim Landgericht noch eine Berufung anhängig ist. G kann auch – statt sofort Klage zu erheben – beim Amtsgericht den Erlass eines Mahnbescheids beantragen (§§ 688 ff.); legt S dagegen nicht Widerspruch ein, so ergeht ein Vollstreckungsbescheid, der dann die Grundlage für die Zwangsvollstreckung abgibt. Möglicherweise hat sich S schon beim Empfang des Darlehens in einer notariellen Urkunde der Zwangsvollstreckung unterworfen; dann ist diese Urkunde Vollstreckungstitel.
Gleichzeitiges Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren 3. Gleichzeitiges Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren 1.7 Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren können gleichzeitig stattfinden, so wenn der Kläger aus einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteile des Gerichts erster Instanz die Zwangsvollstreckung betreibt, während der Erkenntnisprozess auf das Rechtsmittel des Beklagten hin noch in der Berufungs- oder Revisionsinstanz schwebt. 1.8 Das bisher Gesagte lässt sich durch ein einfaches Beispiel verdeutlichen: G hat dem S nach seiner Behauptung ein Darlehen von € 2500 gegeben. Ist es zur Rückzahlung fällig, so darf G den S mahnen (§§ 286 Abs. 1, 281 Abs. 1 S. 1 BGB). Er darf ihm auch androhen, dass er im Falle nicht prompter Erfüllung künftig keinen Kredit mehr gewähren werde, dass er ihm keine Waren liefern werde usw. Alle diese Mittel zur Rechtsverwirklichung liegen im Rahmen der Rechts- und Sittenordnung. Er darf aber die € 2500 dem S nicht gewaltsam, d.h. gegen dessen Willen, wegnehmen, auch wenn dies leicht möglich wäre. Er muss vielmehr die Hilfe des Gerichts in Anspruch nehmen, also Leistungsklage bei dem zuständigen Amtsgericht erheben. Das Urteil des Amtsgerichts ist dann die Grundlage der Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher, u.U. auch wenn beim Landgericht noch eine Berufung anhängig ist. G kann auch – statt sofort Klage zu erheben – beim Amtsgericht den Erlass eines Mahnbescheids beantragen (§§ 688 ff.); legt S dagegen nicht Widerspruch ein, so ergeht ein Vollstreckungsbescheid, der dann die Grundlage für die Zwangsvollstreckung abgibt. Möglicherweise hat sich S schon beim Empfang des Darlehens in einer notariellen Urkunde der Zwangsvollstreckung unterworfen; dann ist diese Urkunde Vollstreckungstitel.
1.7, 1.8 3. Gleichzeitiges Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren 1.7 Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren können gleichzeitig stattfinden, so wenn der Kläger aus einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteile des Gerichts erster Instanz die Zwangsvollstreckung betreibt, während der Erkenntnisprozess auf das Rechtsmittel des Beklagten hin noch in der Berufungs- oder Revisionsinstanz schwebt. 1.8 Das bisher Gesagte lässt sich durch ein einfaches Beispiel verdeutlichen: G hat dem S nach seiner Behauptung ein Darlehen von € 2500 gegeben. Ist es zur Rückzahlung fällig, so darf G den S mahnen (§§ 286 Abs. 1, 281 Abs. 1 S. 1 BGB). Er darf ihm auch androhen, dass er im Falle nicht prompter Erfüllung künftig keinen Kredit mehr gewähren werde, dass er ihm keine Waren liefern werde usw. Alle diese Mittel zur Rechtsverwirklichung liegen im Rahmen der Rechts- und Sittenordnung. Er darf aber die € 2500 dem S nicht gewaltsam, d.h. gegen dessen Willen, wegnehmen, auch wenn dies leicht möglich wäre. Er muss vielmehr die Hilfe des Gerichts in Anspruch nehmen, also Leistungsklage bei dem zuständigen Amtsgericht erheben. Das Urteil des Amtsgerichts ist dann die Grundlage der Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher, u.U. auch wenn beim Landgericht noch eine Berufung anhängig ist. G kann auch – statt sofort Klage zu erheben – beim Amtsgericht den Erlass eines Mahnbescheids beantragen (§§ 688 ff.); legt S dagegen nicht Widerspruch ein, so ergeht ein Vollstreckungsbescheid, der dann die Grundlage für die Zwangsvollstreckung abgibt. Möglicherweise hat sich S schon beim Empfang des Darlehens in einer notariellen Urkunde der Zwangsvollstreckung unterworfen; dann ist diese Urkunde Vollstreckungstitel.
Читать дальше