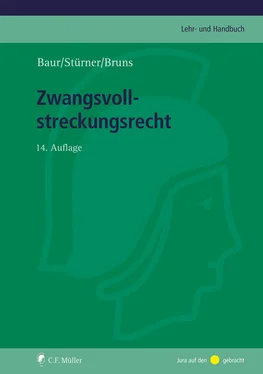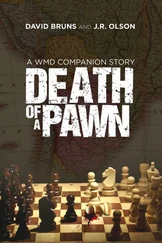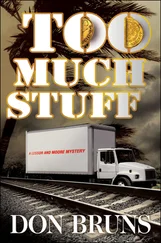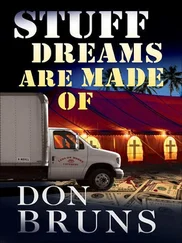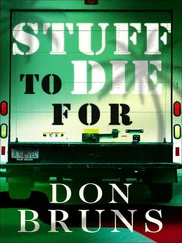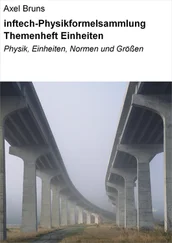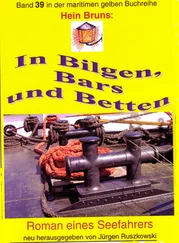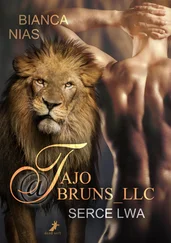IV. IV. Einzelvollstreckung und Gesamtvollstreckung 1.9 Von Einzelvollstreckung spricht man, wenn ein einzelner Gläubiger auf Vermögensstücke des Schuldners zugreift, um einen einzelnen Anspruch zu befriedigen. Er mag dabei mit anderen Gläubigern konkurrieren. Für das Verhältnis der Gläubiger untereinander gilt aber der Grundsatz der Priorität ( Rn. 6.38 ): „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Es gibt ferner materiellrechtliche Rechtspositionen, die gegenüber anderen vollstreckenden Gläubigern Priorität verschaffen (Grundpfandrechte, Pfandrecht, Sicherheiten etc.). Über die Prioritätsregel hinaus kennt aber das Einzelvollstreckungsrecht keine Ausgleichsordnung zwischen den konkurrierenden Gläubigern. Wenn das Vermögen des Schuldners nicht für alle Gläubiger ausreicht, muss ein Insolvenzverfahren[3] eingeleitet werden, um die gleichmäßige und abgestimmte Befriedigung aller Gläubiger zu erreichen. Soweit das Insolvenzverfahren zur zwangsweisen Liquidation führt, spricht man auch von Gesamtvollstreckung. Im Falle der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit stellt das deutsche Recht Einzel- und Gesamtvollstreckung wahlweise nebeneinander. Es steht dann zur Disposition der Parteien, ob viele Einzelvollstreckungsverfahren nebeneinander herlaufen oder ob in einem Insolvenzverfahren das Schuldnervermögen koordiniert liquidiert wird[4]. 1.10 Diese Lösung des deutschen Rechts ist nicht selbstverständlich. Rechtshistorisch hat sich die Einzelvollstreckung aus der Gesamtvollstreckung entwickelt[5]. Viele Rechtsordnungen praktizieren für Kaufleute das Insolvenzverfahren, für Nichtkaufleute ein Zwangsvollstreckungsverfahren, das zwischen konkurrierenden Gläubigern ausgleicht[6].
Einzelvollstreckung und Gesamtvollstreckung IV. Einzelvollstreckung und Gesamtvollstreckung 1.9 Von Einzelvollstreckung spricht man, wenn ein einzelner Gläubiger auf Vermögensstücke des Schuldners zugreift, um einen einzelnen Anspruch zu befriedigen. Er mag dabei mit anderen Gläubigern konkurrieren. Für das Verhältnis der Gläubiger untereinander gilt aber der Grundsatz der Priorität ( Rn. 6.38 ): „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Es gibt ferner materiellrechtliche Rechtspositionen, die gegenüber anderen vollstreckenden Gläubigern Priorität verschaffen (Grundpfandrechte, Pfandrecht, Sicherheiten etc.). Über die Prioritätsregel hinaus kennt aber das Einzelvollstreckungsrecht keine Ausgleichsordnung zwischen den konkurrierenden Gläubigern. Wenn das Vermögen des Schuldners nicht für alle Gläubiger ausreicht, muss ein Insolvenzverfahren[3] eingeleitet werden, um die gleichmäßige und abgestimmte Befriedigung aller Gläubiger zu erreichen. Soweit das Insolvenzverfahren zur zwangsweisen Liquidation führt, spricht man auch von Gesamtvollstreckung. Im Falle der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit stellt das deutsche Recht Einzel- und Gesamtvollstreckung wahlweise nebeneinander. Es steht dann zur Disposition der Parteien, ob viele Einzelvollstreckungsverfahren nebeneinander herlaufen oder ob in einem Insolvenzverfahren das Schuldnervermögen koordiniert liquidiert wird[4]. 1.10 Diese Lösung des deutschen Rechts ist nicht selbstverständlich. Rechtshistorisch hat sich die Einzelvollstreckung aus der Gesamtvollstreckung entwickelt[5]. Viele Rechtsordnungen praktizieren für Kaufleute das Insolvenzverfahren, für Nichtkaufleute ein Zwangsvollstreckungsverfahren, das zwischen konkurrierenden Gläubigern ausgleicht[6].
1.9, 1.10 IV. Einzelvollstreckung und Gesamtvollstreckung 1.9 Von Einzelvollstreckung spricht man, wenn ein einzelner Gläubiger auf Vermögensstücke des Schuldners zugreift, um einen einzelnen Anspruch zu befriedigen. Er mag dabei mit anderen Gläubigern konkurrieren. Für das Verhältnis der Gläubiger untereinander gilt aber der Grundsatz der Priorität ( Rn. 6.38 ): „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Es gibt ferner materiellrechtliche Rechtspositionen, die gegenüber anderen vollstreckenden Gläubigern Priorität verschaffen (Grundpfandrechte, Pfandrecht, Sicherheiten etc.). Über die Prioritätsregel hinaus kennt aber das Einzelvollstreckungsrecht keine Ausgleichsordnung zwischen den konkurrierenden Gläubigern. Wenn das Vermögen des Schuldners nicht für alle Gläubiger ausreicht, muss ein Insolvenzverfahren[3] eingeleitet werden, um die gleichmäßige und abgestimmte Befriedigung aller Gläubiger zu erreichen. Soweit das Insolvenzverfahren zur zwangsweisen Liquidation führt, spricht man auch von Gesamtvollstreckung. Im Falle der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit stellt das deutsche Recht Einzel- und Gesamtvollstreckung wahlweise nebeneinander. Es steht dann zur Disposition der Parteien, ob viele Einzelvollstreckungsverfahren nebeneinander herlaufen oder ob in einem Insolvenzverfahren das Schuldnervermögen koordiniert liquidiert wird[4]. 1.10 Diese Lösung des deutschen Rechts ist nicht selbstverständlich. Rechtshistorisch hat sich die Einzelvollstreckung aus der Gesamtvollstreckung entwickelt[5]. Viele Rechtsordnungen praktizieren für Kaufleute das Insolvenzverfahren, für Nichtkaufleute ein Zwangsvollstreckungsverfahren, das zwischen konkurrierenden Gläubigern ausgleicht[6].
§ 2
Grundzüge des Vollstreckungsverfahrens
I. Die Grundstruktur des Vollstreckungsverfahrens 2.1, 2.2 1. Das Erkenntnisverfahren und seine innere Gliederung 2.1 Das zivilprozessuale Erkenntnisverfahren ist auf den Erlass eines gerichtlichen Urteils gerichtet, das den Rechtsstreit der Parteien entscheidet. Für den Gang dieses Verfahrens von der Klage bis zum Urteil gibt das Gesetz Regeln, die von Prozessrechtsgrundsätzen getragen sind. Sie betreffen das Verhältnis zwischen Gericht und Parteien, den Einfluss der Parteien auf das Prozessgeschehen, die Gewinnung der tatsächlichen Grundlagen des Urteils usw. Alle diese Grundsätze und Regeln sollen letzten Endes das Verfahren so gestalten, dass der Richter das gerechte Urteil finden kann.
1. 1. Das Erkenntnisverfahren und seine innere Gliederung 2.1 Das zivilprozessuale Erkenntnisverfahren ist auf den Erlass eines gerichtlichen Urteils gerichtet, das den Rechtsstreit der Parteien entscheidet. Für den Gang dieses Verfahrens von der Klage bis zum Urteil gibt das Gesetz Regeln, die von Prozessrechtsgrundsätzen getragen sind. Sie betreffen das Verhältnis zwischen Gericht und Parteien, den Einfluss der Parteien auf das Prozessgeschehen, die Gewinnung der tatsächlichen Grundlagen des Urteils usw. Alle diese Grundsätze und Regeln sollen letzten Endes das Verfahren so gestalten, dass der Richter das gerechte Urteil finden kann.
Das Erkenntnisverfahren und seine innere Gliederung 1. Das Erkenntnisverfahren und seine innere Gliederung 2.1 Das zivilprozessuale Erkenntnisverfahren ist auf den Erlass eines gerichtlichen Urteils gerichtet, das den Rechtsstreit der Parteien entscheidet. Für den Gang dieses Verfahrens von der Klage bis zum Urteil gibt das Gesetz Regeln, die von Prozessrechtsgrundsätzen getragen sind. Sie betreffen das Verhältnis zwischen Gericht und Parteien, den Einfluss der Parteien auf das Prozessgeschehen, die Gewinnung der tatsächlichen Grundlagen des Urteils usw. Alle diese Grundsätze und Regeln sollen letzten Endes das Verfahren so gestalten, dass der Richter das gerechte Urteil finden kann.
2.1 1. Das Erkenntnisverfahren und seine innere Gliederung 2.1 Das zivilprozessuale Erkenntnisverfahren ist auf den Erlass eines gerichtlichen Urteils gerichtet, das den Rechtsstreit der Parteien entscheidet. Für den Gang dieses Verfahrens von der Klage bis zum Urteil gibt das Gesetz Regeln, die von Prozessrechtsgrundsätzen getragen sind. Sie betreffen das Verhältnis zwischen Gericht und Parteien, den Einfluss der Parteien auf das Prozessgeschehen, die Gewinnung der tatsächlichen Grundlagen des Urteils usw. Alle diese Grundsätze und Regeln sollen letzten Endes das Verfahren so gestalten, dass der Richter das gerechte Urteil finden kann.
Читать дальше