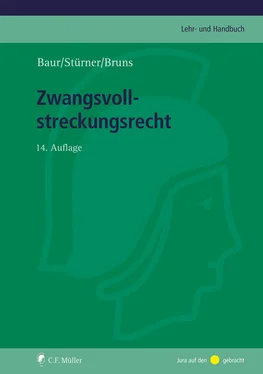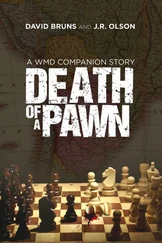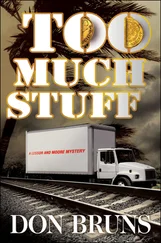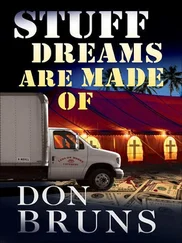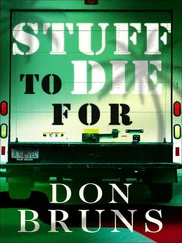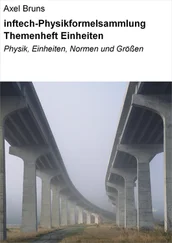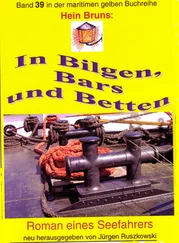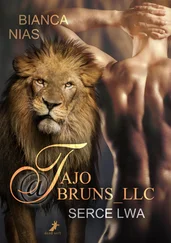2. 2. Das Vollstreckungsverfahren und die vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe 2.2 Das Ziel des Vollstreckungsverfahrens ist der Erlass des Vollstreckungsaktes zur zwangsweisen Verwirklichung des richterlichen Urteils (oder eines sonstigen Vollstreckungstitels). Es wird nicht mehr „abgewogen und entschieden“, sondern „zugegriffen“! Dass für diesen Zugriff exakte rechtsstaatliche Regeln gelten müssen, ist sicher. Aber sie müssen notwendig anders gestaltet sein als die im Erkenntnisverfahren geltenden. Das Verfahren zum Erlass eines Vollstreckungsaktes ähnelt in vieler Hinsicht dem auf Erlass eines Verwaltungsakts gerichteten Verfahren. Davon zu unterscheiden ist das Verfahren zur richterlichen Kontrolle der Vollstreckungsakte (insbesondere auf Anfechtung) und ihrer Verweigerung. Dieses Verfahren enthält notwendig wieder Züge des Erkenntnisverfahrens, da der Richter nunmehr über die Rechtmäßigkeit des Vollstreckungsaktes zu entscheiden hat (s.a. Rn. 7.33 ). Reines Erkenntnisverfahren sind vor allem zwei Rechtsbehelfe des Vollstreckungsrechts: die Vollstreckungsgegenklage und die Drittwiderspruchsklage. Mit der ersten macht der Schuldner geltend, dass durch nachträglich eingetretene Umstände der im Titel verbriefte vollstreckbare Anspruch weggefallen sei (§ 767). Mit der Widerspruchsklage macht ein Dritter geltend, dass ihm am Objekt der Zwangsvollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zusteht; er kämpft also um die Befreiung dieses Objekts von dem Vollstreckungszugriff (§ 771). Zusammenfassend kann man also das „eigentliche“ Vollstreckungsverfahren und das Verfahren der vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe unterscheiden.
Das Vollstreckungsverfahren und die vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe 2. Das Vollstreckungsverfahren und die vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe 2.2 Das Ziel des Vollstreckungsverfahrens ist der Erlass des Vollstreckungsaktes zur zwangsweisen Verwirklichung des richterlichen Urteils (oder eines sonstigen Vollstreckungstitels). Es wird nicht mehr „abgewogen und entschieden“, sondern „zugegriffen“! Dass für diesen Zugriff exakte rechtsstaatliche Regeln gelten müssen, ist sicher. Aber sie müssen notwendig anders gestaltet sein als die im Erkenntnisverfahren geltenden. Das Verfahren zum Erlass eines Vollstreckungsaktes ähnelt in vieler Hinsicht dem auf Erlass eines Verwaltungsakts gerichteten Verfahren. Davon zu unterscheiden ist das Verfahren zur richterlichen Kontrolle der Vollstreckungsakte (insbesondere auf Anfechtung) und ihrer Verweigerung. Dieses Verfahren enthält notwendig wieder Züge des Erkenntnisverfahrens, da der Richter nunmehr über die Rechtmäßigkeit des Vollstreckungsaktes zu entscheiden hat (s.a. Rn. 7.33 ). Reines Erkenntnisverfahren sind vor allem zwei Rechtsbehelfe des Vollstreckungsrechts: die Vollstreckungsgegenklage und die Drittwiderspruchsklage. Mit der ersten macht der Schuldner geltend, dass durch nachträglich eingetretene Umstände der im Titel verbriefte vollstreckbare Anspruch weggefallen sei (§ 767). Mit der Widerspruchsklage macht ein Dritter geltend, dass ihm am Objekt der Zwangsvollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zusteht; er kämpft also um die Befreiung dieses Objekts von dem Vollstreckungszugriff (§ 771). Zusammenfassend kann man also das „eigentliche“ Vollstreckungsverfahren und das Verfahren der vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe unterscheiden.
2.2 2. Das Vollstreckungsverfahren und die vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe 2.2 Das Ziel des Vollstreckungsverfahrens ist der Erlass des Vollstreckungsaktes zur zwangsweisen Verwirklichung des richterlichen Urteils (oder eines sonstigen Vollstreckungstitels). Es wird nicht mehr „abgewogen und entschieden“, sondern „zugegriffen“! Dass für diesen Zugriff exakte rechtsstaatliche Regeln gelten müssen, ist sicher. Aber sie müssen notwendig anders gestaltet sein als die im Erkenntnisverfahren geltenden. Das Verfahren zum Erlass eines Vollstreckungsaktes ähnelt in vieler Hinsicht dem auf Erlass eines Verwaltungsakts gerichteten Verfahren. Davon zu unterscheiden ist das Verfahren zur richterlichen Kontrolle der Vollstreckungsakte (insbesondere auf Anfechtung) und ihrer Verweigerung. Dieses Verfahren enthält notwendig wieder Züge des Erkenntnisverfahrens, da der Richter nunmehr über die Rechtmäßigkeit des Vollstreckungsaktes zu entscheiden hat (s.a. Rn. 7.33 ). Reines Erkenntnisverfahren sind vor allem zwei Rechtsbehelfe des Vollstreckungsrechts: die Vollstreckungsgegenklage und die Drittwiderspruchsklage. Mit der ersten macht der Schuldner geltend, dass durch nachträglich eingetretene Umstände der im Titel verbriefte vollstreckbare Anspruch weggefallen sei (§ 767). Mit der Widerspruchsklage macht ein Dritter geltend, dass ihm am Objekt der Zwangsvollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zusteht; er kämpft also um die Befreiung dieses Objekts von dem Vollstreckungszugriff (§ 771). Zusammenfassend kann man also das „eigentliche“ Vollstreckungsverfahren und das Verfahren der vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe unterscheiden.
II. Die Ausgestaltung des Vollstreckungsverfahrens 2.3 – 2.8 1. Antragsverfahren 2.3 Das Verfahren ist Antragsverfahren, die Zwangsvollstreckung erfolgt nicht von Amts wegen. Der Antrag kann lediglich im Grundsatz formlos gestellt werden, hingegen besteht für die Geldforderungsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher (§ 753 Abs. 3, 4) und den Antrag auf Erlass eines Pfändungsbeschlusses Formularzwang (§ 829 Abs. 4). Der Gläubiger bezeichnet – außer bei der Pfändung beweglicher Sachen – das Vollstreckungsobjekt, sofern es sich nicht schon aus dem Vollstreckungstitel ergibt. Durch den Inhalt seines Vollstreckungsauftrags kann er Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie der Gerichtsvollzieher gegen den Schuldner vorgeht[2]. Der Gläubiger kann jederzeit den Fortgang des Vollstreckungsverfahrens sistieren und bereits erfolgte Vollstreckungsmaßnahmen aufheben lassen, d.h. Pfandgegenstände „freigeben“. Man kann also in gewissem Sinne von der Geltung der Dispositionsmaxime sprechen ( Rn. 6.5 ). Dies bedeutet aber nicht, dass das Zwangsvollstreckungsrecht dispositives Recht sei! Das Gegenteil ist richtig: „Die Voraussetzungen und die Grenzen der staatlichen Vollstreckungshandlungen sind begrifflich den Abmachungen der Parteien entzogen“[3].
1. 1. Antragsverfahren 2.3 Das Verfahren ist Antragsverfahren, die Zwangsvollstreckung erfolgt nicht von Amts wegen. Der Antrag kann lediglich im Grundsatz formlos gestellt werden, hingegen besteht für die Geldforderungsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher (§ 753 Abs. 3, 4) und den Antrag auf Erlass eines Pfändungsbeschlusses Formularzwang (§ 829 Abs. 4). Der Gläubiger bezeichnet – außer bei der Pfändung beweglicher Sachen – das Vollstreckungsobjekt, sofern es sich nicht schon aus dem Vollstreckungstitel ergibt. Durch den Inhalt seines Vollstreckungsauftrags kann er Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie der Gerichtsvollzieher gegen den Schuldner vorgeht[2]. Der Gläubiger kann jederzeit den Fortgang des Vollstreckungsverfahrens sistieren und bereits erfolgte Vollstreckungsmaßnahmen aufheben lassen, d.h. Pfandgegenstände „freigeben“. Man kann also in gewissem Sinne von der Geltung der Dispositionsmaxime sprechen ( Rn. 6.5 ). Dies bedeutet aber nicht, dass das Zwangsvollstreckungsrecht dispositives Recht sei! Das Gegenteil ist richtig: „Die Voraussetzungen und die Grenzen der staatlichen Vollstreckungshandlungen sind begrifflich den Abmachungen der Parteien entzogen“[3].
Antragsverfahren 1. Antragsverfahren 2.3 Das Verfahren ist Antragsverfahren, die Zwangsvollstreckung erfolgt nicht von Amts wegen. Der Antrag kann lediglich im Grundsatz formlos gestellt werden, hingegen besteht für die Geldforderungsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher (§ 753 Abs. 3, 4) und den Antrag auf Erlass eines Pfändungsbeschlusses Formularzwang (§ 829 Abs. 4). Der Gläubiger bezeichnet – außer bei der Pfändung beweglicher Sachen – das Vollstreckungsobjekt, sofern es sich nicht schon aus dem Vollstreckungstitel ergibt. Durch den Inhalt seines Vollstreckungsauftrags kann er Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie der Gerichtsvollzieher gegen den Schuldner vorgeht[2]. Der Gläubiger kann jederzeit den Fortgang des Vollstreckungsverfahrens sistieren und bereits erfolgte Vollstreckungsmaßnahmen aufheben lassen, d.h. Pfandgegenstände „freigeben“. Man kann also in gewissem Sinne von der Geltung der Dispositionsmaxime sprechen ( Rn. 6.5 ). Dies bedeutet aber nicht, dass das Zwangsvollstreckungsrecht dispositives Recht sei! Das Gegenteil ist richtig: „Die Voraussetzungen und die Grenzen der staatlichen Vollstreckungshandlungen sind begrifflich den Abmachungen der Parteien entzogen“[3].
2.3 1. Antragsverfahren 2.3 Das Verfahren ist Antragsverfahren, die Zwangsvollstreckung erfolgt nicht von Amts wegen. Der Antrag kann lediglich im Grundsatz formlos gestellt werden, hingegen besteht für die Geldforderungsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher (§ 753 Abs. 3, 4) und den Antrag auf Erlass eines Pfändungsbeschlusses Formularzwang (§ 829 Abs. 4). Der Gläubiger bezeichnet – außer bei der Pfändung beweglicher Sachen – das Vollstreckungsobjekt, sofern es sich nicht schon aus dem Vollstreckungstitel ergibt. Durch den Inhalt seines Vollstreckungsauftrags kann er Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie der Gerichtsvollzieher gegen den Schuldner vorgeht[2]. Der Gläubiger kann jederzeit den Fortgang des Vollstreckungsverfahrens sistieren und bereits erfolgte Vollstreckungsmaßnahmen aufheben lassen, d.h. Pfandgegenstände „freigeben“. Man kann also in gewissem Sinne von der Geltung der Dispositionsmaxime sprechen ( Rn. 6.5 ). Dies bedeutet aber nicht, dass das Zwangsvollstreckungsrecht dispositives Recht sei! Das Gegenteil ist richtig: „Die Voraussetzungen und die Grenzen der staatlichen Vollstreckungshandlungen sind begrifflich den Abmachungen der Parteien entzogen“[3].
Читать дальше