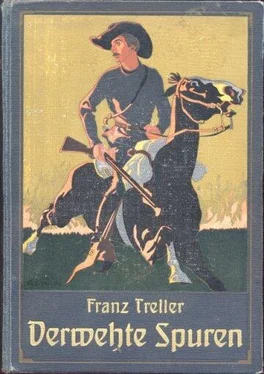Mit großem Wohlgefallen wurden die Geschenke von den Indianern entgegengenommen. [355]
»Auch für die Ladies der Ottawahäuptlinge habe ich Dinge mitgebracht, welche ihnen wohl gefallen werden.« Und er entfaltete rotes Tuch, bunte Bänder, Ohrgehänge, Vorstecknadeln, Kattun.
Lächelnd sagte Amaqua: »Die Squaws der Ottawas werden den jungen Häuptling der Dutchmen in ihr Herz schließen. Doch die Ottawas sind arm, sie haben nichts, was sie dem weißen Bruder dagegen schenken könnten.«
»Ich bin zufrieden, Häuptling, wenn ich mir Eure Freundschaft gewinne, mehr begehre ich nicht.«
Die Indianer waren angenehm überrascht, und Amaqua stand auf, reichte Edgar die Hand und sagte: »Amaqua ist des jungen Dutchman Freund; was er tun kann, um sein Herz zu erfreuen, soll geschehen.«
Edgar hielt es für geraten, gerade auf sein Ziel loszugehen.
»Du hast schon im Fort Jackson gehört, Amaqua, was mich hierher führt. Sind deine Freundschaftsversicherungen nicht nur Worte ohne Inhalt, so hilf mir die Spur meiner Schwester und ihres Kindes aufzufinden, gib mir Gewißheit über ihr Schicksal, und wenn es auch noch so traurig war, ich werde deiner stets in Dankbarkeit gedenken und diese Geschenke reich vermehren. Ihr Ottawas habt von mir nichts zu fürchten, ich bin ein Deutscher und stehe amerikanischer Politik gänzlich fern. Ich gebe euch das Wort eines deutschen Häuptlings, daß nie mein Mund etwas mitteilen soll, was ihr verschwiegen wissen wollt. Nur Gewißheit will ich erlangen über meiner Schwester Schicksal.«
Ernst lauschten die Indianer seinen Worten. Dann sagte Amaqua in wohlwollendem Tone: »Der Häuptling der Deutschen ist ehrlich, er hat nur eine Zunge, er denkt, was er spricht. Die Langmesser sind seine Freunde, die Ottawas sind seine Freunde. Er sucht eine Schwester, welche die Ottawakrieger, als sie die Streitaxt gegen ihren großen Vater in Washington erhoben, geraubt haben sollen. Amaqua weiß nichts davon, diese Häuptlinge hier wissen nichts davon, niemand weiß etwas davon. Mein junger Bruder sage, wo wir ihre Spur suchen sollen, und die Ottawas werden sich aufmachen und ihm suchen helfen.«
Mit trauriger Miene entgegnete Edgar: »Da wären wir so weit wie bisher, Häuptling. Nicht daß ich in deine Worte Zweifel setze, ein Häuptling hat nur eine Zunge, und wenn er sagt: ich weiß nichts von der weißen Frau, so ist es so. Aber es leben gewiß noch Krieger, welche das Schicksal meiner Schwester kennen, wenn Amaqua diese befragen wollte, so wäre ich ihm sehr dankbar.« [356]
Mit immer gleicher Höflichkeit entgegnete der Indianer: »Sie sind befragt, doch niemand entsinnt sich der weißen Frau. Mein Bruder frage selbst, und es soll Amaqua freuen, wenn die Antwort erwünscht lautet.«
Mit schmerzlicher Betroffenheit sah Edgar ein, daß seine Mittel versagten, die Indianer wollten oder durften nicht reden.
Mit leichtem Schritte trat Athoree ins Zimmer und grüßte die Häuptlinge mit einer Neigung des Hauptes.
Amaqua faßte ihn scharf ins Auge und fragte in der Ottawasprache: »Mein Bruder ist ein Wyandot?«
Höflich entgegnete Athoree in englischer Sprache: »Der Häuptling muß mit mir die Sprache der Inglis reden, wenn ich seine Worte vernehmen soll, oder in der Zunge der Wyandots, Athoree versteht nicht die Laute der Ottawas.«
Amaqua sagte freundlich in der Zunge der Engländer: »O, die Wyandots jenseits des Michigan sprechen oder verstehen gemeinhin die Sprache unsrer Brüder, der Saulteux, welche nahe bei ihren Dörfern wohnen. Sollte mein Bruder diese nicht verstehen?«
»Die Wyandots wohnen in den Kanadas, Häuptling, und weitab von den Saulteux. Zwar wissen wir, daß Männer unsres Volkes im Gebiete des großen Vaters in Washington leben, aber ich kenne sie nicht und nicht deine Brüder, die Saulteux, ich kann ihre Sprache nicht sprechen, sie nicht verstehen.«
»So müssen wir uns der Worte der Inglis bedienen, wenn wir den Wyandothäupt-ling an unsern Feuern willkommen heißen wollen,« sagte der Ottawa in verbindlicher Weise.
Dann erhob er sich: »Der Häuptling der Dutchmen ist willkommen bei den Ottawas, er sage, was er wünscht, und er wird es erhalten, wenn wir es geben können.«
Damit packten die Indianer ihre Geschenke auf und gingen hinaus.
Mädchen und Knaben standen harrend vor dem Hause, in welchem die Weißen wohnten, während die Männer sich würdevoll zurückhielten.
Die Geschenke Edgars bereiteten draußen viel Freude und gewannen ihm sofort die Herzen der Frauen.
»So bin ich meinem Ziele nicht einen Schritt nähergekommen,« sagte der Graf traurig, als die Indianer fort waren.
»Sind in den Dörfern der Ottawas, Gutherz, wollen schon Spur finden. Geben etwas Tücher, Kämme, Schmuck für alte Mutter, soll an Ottawasquaws schenken.« [357]
»Nimm, Athoree, was dir gut dünkt, ich gäbe gern das Hundertfache und mehr für eine sichere Nachricht von meiner Schwester.«
Athoree nahm von den zu Geschenken bestimmten Gegenständen, verbarg sie unter der über seiner Schulter hängenden wollenen Decke und ging hinaus.
Nach einiger Zeit folgte ihm auch der Graf.
Er schlenderte, Heinrich hinter sich, langsam zwischen den Hütten umher, zwar folgten ihnen aufmerksame Blicke, aber keine zudringliche Neugier belästigte ihn. Männer saßen und lagen umher, manche grüßten ihn, andre starrten ihn wortlos an.
Vor der Hütte, welche Athoree angewiesen war, sah Edgar wohl einige Dutzend Knaben und Mädchen versammelt, welche Sumach, die vor derselben saß, bewundernd anblickten.
Frau Sumach forderte aber auch die Aufmerksamkeit heraus.
Das brennend rote Kopftuch, die glitzernden Ohrgehänge, die Brosche, das glänzende Armband konnte nur die Frau oder Mutter eines großen Häuptlings tragen.
Die Ottawaweiber unterhielten sich auf das lebhafteste.
Sumach verstand ganz gut, was sie sagten, blieb aber, als verschiedene Anfragen an sie gerichtet wurden, dabei, nur einige Worte Ottawasprache erlernt zu haben.
Die Alte lauschte mit der gespanntesten Aufmerksamkeit auf alles, was die Frauen äußerten, ob sie gleich so teilnahmlos dasaß, als seien die Ottawaweiber kaum vorhanden.
»Die Weißen sind reich,« sagte eine der Frauen, »ich denke, sie bringen für jede Squaw ein Geschenk mit.«
»Was sie nur hier zu suchen haben, die bleichgesichtigen Hunde?« äußerte eine andre mit haßblitzenden Augen.
»Still, es sind keine Langmesser, sagt Amaqua.«
»Gleichviel.«
»Bringen sie Geschenke,« ließ eine dritte sich vernehmen, »sollen sie willkommen sein.«
»Wenn ich doch nur ein solches Tuch erhielte, als diese alte Wyandotsquaw um den Kopf trägt,« sagte die erste wieder.
»Sieh nur die schönen Ohrgehänge.«
»Was tut nur die alte Frau mit so viel Schmuck? Den sollte sie doch jüngeren überlassen.«
»Das finde ich auch.«
»Was mag der weiße Häuptling nur hier wollen, er ist doch sicher nicht allein gekommen, uns Geschenke zu bringen?«
[358]
»Was wollen die weißen Männer bei den Ottawas, alte Wyandotsquaw?« richtete eine der Frauen die Frage an Sumach in gebrochenem Englisch.
»Weiße Männer Geschenke bringen,« entgegnete diese in derselben Sprache.
»Ist der Mann mit dem Haar von der Farbe des Schnees ein Medizinmann, Mutter?« fragte schüchtern ein junges Mädchen.
»Nicht verstehen,« entgegnete Sumach.
Die Fragerin wandte sich, wie es schien, betrübt ab.
»Warum fragst du?« wandte sich eine der Frauen an das Mädchen.
»Die Weißen sind große Medizinmänner, vielleicht könnten sie Miskutake helfen, sie leidet große Schmerzen.«
Bei dem Namen Miskutake zuckte Sumach zusammen, doch so leicht, daß es niemand der Anwesenden bemerken konnte, um so weniger, als sich in ihrem Gesicht nicht ein Zug bewegte. Erst nach einiger Zeit wandte sie das Auge auf das junge Mädchen und prägte sich ihre Züge ein.
Читать дальше