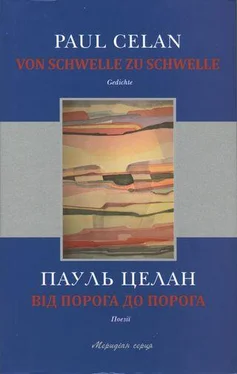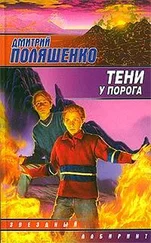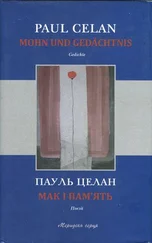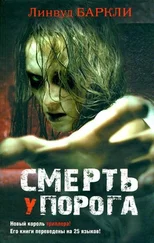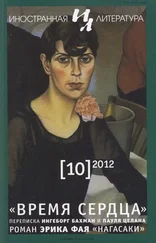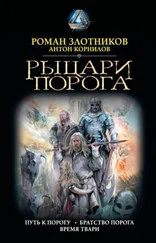Der Titel „Von Schwelle zu Schwelle“, der nach vielen Erwägungen endgültig gewählt wurde, ist programmatisch. In einem Brief vom 22. Februar 1955 an Jürgen Rausch, den damaligen DVA-Mitarbeiter, äußerte sich Celan dazu wie folgt: „Damit ist, so glaube und hoffe ich zumindest, außer einem gewiß nicht unwesentlichen Zug des Dichterischen, seinem liminaren (einleitenden, anfänglichen — P.R.) Charakter nämlich, auch das Nie-zur-Ruhe-Kommen des Poetischen angedeutet und mithin wohl auch der — schlechthin unerfüllbare — Unendlichkeitsanspruch jeglicher Aussage in diesem Bereich“ [5] Editorisches Vonwort. In: Paul Celan. Von Schwelle zu Schwelle. Vorstufen — Textgenese — Endfassung, S. IX.
. Celan betont hier das dynamische Potenzial und die räumliche Offenheit des Schwellenbildes. Der Titel „Von Schwelle zu Schwelle“ stellt eine Periphrase der unaufhörlichen Bewegung und des ewigen Strebens nach dem unerreichbaren Ideal dar. Er wurde dem Gedicht „Chanson einer Dame im Schatten“ aus „Mohn und Gedächtnis“ entnommen und sichert somit die motivische Verbindung mit dem vorherigen Gedichtband des Dichters. Die tiefere Dimension dieses Bildes enthüllt sich, wenn man an die Symbolik des Begriffs „Schwelle“ in seinem mythologischen Ausmaß denkt. „Schwelle“ ist in vielen mythologischen Systemen ein Grenzsymbol, der einen Übergang bedeutet: vom Profanen zum Heiligen, vom Realen zum Transzendenten, von der alten in die neue Welt. Es ist eine Wasserscheide, die Linie der Abgrenzung und des Zusammentreffens. „Diese wird ritualisiert in der Zeremonie des „Niederreißens der Schranken“ bekräftigt, wodurch der Bereich des Raumes in der gleichen Art und Weise neu bestimmt wird wie in Neujahrsfeiern die Zeit. Das Versinken im Wasser, das Betreten eines dunklen Waldes oder eine Tür in einer Wand sind Schwellensymbole für das Betreten des gefahrvollen Unbekannten“ [6] Cooper Jean C. Lexikon alter Symbole. Aus dem Englischen übersetzt von Gudrun u. Matthias Middel. — Leipzig: E. A. Seemann Verlag 1986, S. 171.
. Dies alles sollte der damaligen Weltempfindung Celans entsprechen, der sich in Paris allmählich heimisch macht und den Übergang von seiner unsicheren osteuropäischen Existenz zur Stabilität mehr oder weniger gesicherter Verhältnisse, von der mit tragischen Erfahrungen beladenen Vergangenheit zur relativ ausgewogenen Gegenwart, von seiner Jugend zu seiner Reifezeit verwirklicht. Er selbst nennt sich gelegentlich ein „Schwellenwesen“, „halb von gestern, halb von heute“, „zwischen mehr oder minder geschichtslosen „Östlichkeiten" und herbstendem Okzident“ sitzend [7] Paul Celan — Hanne und Hermann Lenz. Briefwechsel, S. 41.
. Viele Gedichte des Bandes sind von diesem Gefühl des Unterwegsseins gezeichnet.
Auch die innere Gliederung des Bandes entspricht seiner Schwellentendenz. Celan hat sein Buch in drei Binnenzyklen aufgeteilt: „Sieben Rosen später“, „Mit wechselndem Schlüssel“ und „Inselhin“. Alle drei Titel konnotieren die Semantik der zeitlichen oder räumlichen Bewegung und somit die Schwellenproblematik. Der Titel des ersten Zyklus ist dem Gedicht „Kristall“ entnommen, das aus dem vorherigen Band „Mohn und Gedächtnis“ stammt und sorgt wieder dafür, dass die assoziative und motivische Beziehung zwischen beiden Bänden aufrecht erhalten bleibt. Der zweite und derdritte Zyklus verdanken ihre Namen den jeweiligen Gedichten des neuen Bandes. Abgesehen von der „Grabschrift für Frangois“ haben die Gedichte keine genaue Datierung und unterliegen keinem chronologischen Prinzip, so dass ihre zeitliche Nachbarschaft nur gelegentlich ist. Das wird sich ab dem nächsten Band „Sprachgitter“ ändern, denn die Goll-Affäre sollte Celan zur überaus genauen und strengen Dokumentierung jedes seiner poetischen Texte zwingen.
Im ersten Binnenzyklus „Sieben Rosen später“ überwiegt noch die Liebesproblematik, was bereits mit dem Stichwort „Rosen“ als traditionellem Liebessymbol vorgegeben ist. Auch hier ist die Liebe vom Gedächtnis an die jüdischen Toten nicht zu trennen, was für Celan schon in „Mohn und Gedächtnis“ charakteristisch war. In beiden weiteren Zyklen des Bandes taucht diese Verquikkung von Grundmotiven seiner Dichtung wieder auf. Die Liebe ist durch den Tod (auch des eigenen Kindes) überschattet. In diesem Sinne ist „Grabschrift für Francois“, die den zweiten Zyklus „Mir wechselndem Schlüssel“ eröffnet, „Kristallisationspunkt“ des ganzen Bandes, wie es Celan in einem Gespräch mit Otto Pöggeler formuliert hat [8] Pöggeler Otto. Der Stein hinterm Aug. Studien zu Celans Gedichten. — München: Wilhelm Fink, 2000, S. 42.
. Durch dieses trübe Prisma erscheint die Liebe nicht mehr als pure Glücksempfindung, sondern als ein ambivalentes Gefühl, das zugleich Freude und Trauer in sich einschließt. „Innerhalb des gesamten Bandes wird die Gefahr der Verdrängung der Erinnerung an die Toten durch die neue Liebe dadurch gebannt, dass die Gedichte diese Liebe problematisieren und letztlich in den existenziell bestimmenden Diskurs des Totengedenkens eingliedern, wobei der Tod des gemeinsamen Kindes den Angelpunkt dieser Integrationsfigur bildet“ [9] Celan-Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Hrsg. von Markus May, Peter Goßens, Jürgen Lehmann. Stuttgart; Weimar: Verlag J. B. Metzler 2008, S. 65–66.
, — meint Markus May. Es ist daher kaum möglich, das Liebesmotiv von anderen Motiven und Bildkomplexen abzusondern, die das wachsame Gedächtnis des Autors ihm immer wieder liefert, während es auch seine ermordeten Eltern (z. B. in „Mit Äxten spielend“ oder „Vor einer Kerze“) sowie unzählige anonyme Opfern des Holocausts in diesen Kreis hinein nimmt.
Im zweiten und dritten Binnenzyklus nehmen dann religionsphilosophische („Aufs Auge gepfropft“, „Der uns die Stunden zählte“, „Assisi“) und poetologische („Abend der Worte“, „Welchen der Steine du hebst“, „In memoriam Paul Eluards“, „Schibboleth“, „Sprich auch du“, „Mit zeitroten Lippen“, „Argumentum e silentio“, „Die Winzer“) Akzente zu, die vor allem sprachreflexive Fragen intonieren. Viele Gedichte decken dichte intertextuelle Schichten auf, während sie zu philosophischen, kulturhistorischen, literarischen und künstlerischen Anspielungen greifen. Man kann hier Zitate oder Reminiszenzen aus den Werken von Parmenides, Franz von Assisi, Hölderlin, Jean Paul, Gustav Schwab, Nietzsche, Yoice, Yeats, Rilke, Else Lasker-Schüler, Paul Eluard, Martin Bu-ber, Gershom Scholem u. a. finden. Die häufigsten Motive, die immer wieder in den Gedichten des Bandes Vorkommen, sind Auge, Haar, Hand, Mund, Herz, Rose, Baum, Stein, Sand, Wasser, Meer, Wolke, Schnee, Eis, Licht, Schatten, Kerze, Faden, Stunde, Zeit, Nacht, Welt, Name, Wort sowie ihre zahlreichen Derivate. Die meisten dieser Schlüsselbilder, die auch in seinen späteren Gedichtbänden dominieren werden, beziehen sich hauptsächlich auf die Anatomie des Menschen sowie auf ursprüngliche Naturelemente und Naturerscheinungen, viel seltener begegnen wir hier Begriffen und Realien aus abstrakter oder gesellschaftlicher Sphäre.
Auch Celans Vielsprachigkeit hat in Gedichten dieses Bandes ihre Spuren hinterlassen, während er Wörter, Redewendungen oder Sentenzen aus verschiedenen alten und neuen Sprachen verwendet, so z. B. aus dem Hebräischen (Schibboleth), Altgriechischen (Kenotaph), Lateinischen (Argumentum e silentio), Spanischen (No pasaran). Dieser Außenseiter und Fremdling, geboren am Rande des deutschen Sprachraums (was die deutsche Kritik ihm nie verzeihen wollte), demonstriert hier wieder ein erstaunlich feines und tiefes Sprachgefühl und bereichert seine deutsche Muttersprache mit Neuschöpfungen, die wesentlich ihre Grenze erweitern (Baumwort, lidweit, nachtverhangen, sömmernd, gedankenfarben, Flügelnacht, Zwillingsröte, Mittnacht, Doppelsilber, Sonnengrab, Spätmund, Lichtstumpf usw.), oder mit alliterierenden und paradoxen Wortspielen wie „die Zungen der Sehnsucht, / die Zangen“, „und tragen das Grün in dein Immer“, die ihn als einen der hellhörigsten sprachlichen Könner profilieren. Bereits in „Von Schwelle zu Schwelle“ entwickelt der Dichter seine seltene Gabe, durch vielschichtige Wortbedeutungen zu neuen semantischen Dimensionen und noch nicht erschlossenen Bildräumen vorzudringen, worin Jacques Derrida am Beispiel der Schibboleth-Chiffre das Grundprinzip seiner Dichtung durchschaute [10] Derrida Jacques. Schibboleth: Für Paul Celan. Hrsg. von Peter Engelmann. Aus dem Französischen von Wolfgang Sebastian Baur. — Wien: Passagen-Verlag 2002.
. „Schibboleth“, ein Wort aus dem Alten Testament, bedeutet auf Hebräisch „Ähre“ oder „Woge“. Es diente für die Leute Jeftahs als Erkennungszeichen in ihrem Kampf gegen die Ephrai-miter, die es nicht richtig aussprechen konnten (Richter, 12, 1–7). Somit symbolisiert dieser Begriff, den schon Martin Buber für die Begründung seines „dialogischen Prinzips“ verwendete, ein poetologisch-sprachkritisches Problem, wie es noch Hugo von Hofmannsthal in seinem „Brief des Lord Chandos“ verstand, und skizziert Möglichkeiten eines Sprechens schlechthin sowie des von Celan angestrebten anderen Sprechens.
Читать дальше