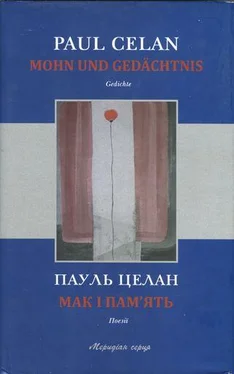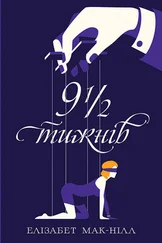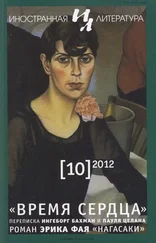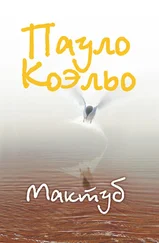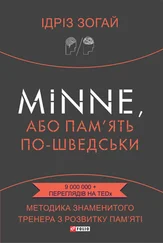Nicht zufällig hatte Celan die „Todesfuge“ etwa in die Mitte seines Gedichtbandes gestellt, wo sie die zentrale Stelle einnimmt. Mit der in ihr gestalteten schrecklichen Problematik des jüdischen Massenmordes wurde die bildliche Semantik des Buchtitels ins Extreme geführt und das Gedenken an die Opfern zum schmerzlichsten moralischen Trauma der Deutschen gemacht, das in ihrem Gedächtnis gleich einer nie schließenden Wunde klaffen soll. Die Schwierigkeiten bei der Rezeption dieses bis heute berühmtesten Gedichts Celans zeigen, dass dies eine der größten Herausforderungen an das deutsche Bewusstsein seit eh’ und je war. Weder die ersten Leser noch die frühen Rezensenten des Celanschen Gedichtbandes haben diese Absicht des Dichters in vollem Maße erfasst, indem sie die „Todesfuge“ als eine „Versöhnungsgeste“, als Überwindung der furchtbaren Wirklichkeit der Todeslager betrachteten und sich von der Ästhetik dieser „schönen“ Sprache eine gewisse Verdrängung der historischen Schuld und eine moralische Entlastung erhofften.
Der Band „Mohn und Gedächtnis“ kristallisiert somit thematische Schwerpunkte, die bereits in „Der Sand aus den Urnen“ angeschnitten und deklariert wurden: Shoa und Andenken, Heimatlosigkeit und Unterwegssein, Eros und Thanatos, Sprache und Zeit. Die Anknüpfung an die kulturelle Tradition erweist sich in der Vielfalt biblischer (Akra, Babel, Ägypten, Ruth, Noemi, Mirjam, Sulamith) und antiker (Jason, Orion, Deukalion und Pyrrha) mythologischen Reminiszenzen, in der Anspielung auf Bilder und Motive der klassischen und modernen Literatur (Luther, Goethe, Heine, Andersen, Rilke, Trakl). Diese überlieferten Namen und Realien werden in seinen Gedichten jedoch immer aktualisiert, sie kommen in neuen, unerwarteten bildlichen Konstellationen vor, welche die ganze Tragik des 20. Jahrhunderts in sich aufnehmen und sie in paradoxen, nicht selten verfremdenden poetischen Strukturen reflektieren. Die für die frühen Gedichte charakteristische daktylische Langzeile schrumpft allmählich zu kürzeren Versen, die Zeilenbrüche werden immer häufiger, die Strophen übersichtlicher und die Sprache insgesamt nüchterner — aus den Gedichten der Pariser Zyklen verschwindet die üppige Bildlichkeit der zahlreichen Epitheta und Genitivmetaphern fast gänzlich. So offenbart sich bereits in diesem Band die generelle Richtung der weiteren dichterischen Entwicklung Celans, die an einer „graueren Sprache“ orientiert ist.
***
Die literaturkritische Reaktion auf das Erscheinen von Celans „Mohn und Gedächtnis“ war sehr rege, aber nicht eindeutig. Von einer Seite, erhielt der Gedichtband eine Reihe von begeisterten Besprechungen in den führenden Presseorganen und literarischen Zeitschriften des deutschen Sprachraums, in denen seine Bedeutung ausdrücklich hervorgehoben wurde. So schrieb Walter Lennig über den durchaus modernen Charakter Celanscher Gedichte, die „auf den Ton gefasster Trauer gestimmt“ seien, in denen „ein neuer Klang“ und „eine persönliche Ausdruckswelt“ zu hören seien, daher solle man hier nicht „um den Rang feilschen“, denn mit diesem Gedichtbuch habe sich Celan „an die Spitze aller jungen deutschen Lyriker gestellt“ („Tagesspiegel“ vom 31.5.1953); Helmuth de Haas unterstrich, dass Celans Erstlingswerk „einen unüberhörbaren Ton habe“, den man nicht mehr vergesse und bezeichnete seine Sprache als „mundfrisch“ und „beginnlich rein“ („Die neue literarische Welt“, 4. 1953, Nr. 1 3 vom 10. Juli); Karl Schwedhelm hob ausdrücklich hervor, dass es eine Sprache ist, die im deutschen Kulturraum noch „ungewohnt“ sei, denn „sie predigt nicht, sie singt nicht, und sie betreibt keine Landschaftsmalerei, vielmehr spricht sie innere Erfahrung durch Bilder aus, und diese Bilder zeugen durch ihre poetische Intensität neue Erfahrungen“ („Wort und Wahrheit“, Juli 1 953).
Von der anderen Seite, gab es auch kritische Stimmen, wie die von Heinz Piontek, der bemerkte, Celans Buch enthalte „zwanzig Gedichte zu viel“ und überhaupt seien diese Verse „poesie pure“, „zaubrische Montage“, die „ganz aus der Metapher, aus Bild und Inbild“ lebten, so dass man sie nicht anders als „Artistik im Sinne Benns“ bezeichnen kann („Welt und Wort", 8. 1953, Nr. 6). Ähnliche Gedanken äußerte auch Hans Egon Holthusen, wenn er meinte, in Celans Band „Mohn und Gedächtnis“ „tritt ein Talent auf den Plan, das gewisse Prinzipien der modernen französischen Lyrik auf die deutsche Sprache zu übertragen scheint“, die auf dem deutschen Boden noch relativ neu sind, wodurch eigentlich seine Wirkung auf den Leser zu erklären sei, und warf dabei dem jungen Autor den Irrationalismus, die Wirklichkeitsferne und willkürlich konstruierte Metaphern vor („Merkur“, Mai 1954). Wie sich später zeigen sollte, schlugen diese letzteren Meinungen ganz fehl, da sie sich auf einseitige, durchaus voreingenommene Urteile gründeten.
Mehr als zwanzig Jahre nach dem Erscheinen des Celanschen Erstlingswerkes veröffentlichte der deutsche Lyriker Karl Krolow in der Zürcher Zeitung „Die Tat“, wo Anfang 1948 zum ersten Mal im deutschen Sprachraum Celans Gedichte publiziert wurden, einen Artikel unter dem Titel „Erinnerung an einen großen Gedichtband. Paul Celans ‘Mond und Gedächtnis’“, in dem es heißt: „Als Celan in der damaligen literarischen Öffentlichkeit zum Vorschein kam und sich in ihr durchsetzte, war man über seine Sprachweise zugleich überrascht und hatte man auf sie gewartet. […] „Mohn und Gedächtnis“ erfüllte […] für Jahre die Vorstellung von Veränderung der Struktur, der Thematik, des Wesens im Gedicht […], erweiterte den Raum sensibler Aufnahmefähigkeit beim Leser deutscher Lyrik zum erstenmal entscheidend seit dem Erscheinen der späten Gedichte Rilkes und ihrer Sensibilitätshöhe. […] Das seiner dekorativen Erscheinung entkleidete Gedicht ist bei Celan zu einem außerordentlich ernst genommenen Gebilde geworden“ (Die Tat, 4.01.1975). Diese Betrachtung, samt der Behauptung von der „unerhörten Qualität“ des Bandes, aus einem längeren zeitlichen Abstand geschrieben, als die scharfen Winde um Celans poetische Botschaft sich schon allmählich gelegt hatten, kann auch heute als Beispiel einer ausgewogenen und objektiven Wertschätzung gelten, die Celans Rolle im deutschen Literaturprozess der Nachkriegszeit nur bestätigt. Umso notwendiger ist es zu erkennen, dass ganz am Anfang dieses exemplarischen Weges des jungen Dichters ein Debütband stand, der das Programm seinerweiteren poetischen Entwicklung bereits im Kerne enthielt, — „Mohn und Gedächtnis“.
Petro Rychlo
Поетичний первісток Пауля Целана: «Мак і пам’ять»
У 1894 р. в одному з лейпцизьких видавництв вийшла у світ книга під назвою «Історія першого твору» [8] Die Geschichte des Erstlingswerks. Selbstbiographische Aufsätze. Eingeleitet von Karl Emil Franzos. — Leipzig: Verlag von Adolf Ditze, o.J. [1894], XVIII, 296 S.
, упорядником якої був Карл Еміль Францоз. Видання містило автобіографічні нариси 19 німецькомовних авторів, серед них Рудольфа Баумбаха, Фелікса Дана, Ґеорґа Еберса, Марії фон Ебнер-Ешенбах, Теодора Фонтане, Пауля Гейзе, Конрада Фердинанда Майєра, Фрідріха Шпільгаґена, Германа Зудермана, Юліуса Вольффа та ін. Сам Францоз був репрезентований там есеєм «Мій перший твір: ‘Євреї з Барнова’». Донині ця книга залишається вельми захопливою лектурою, оскільки вона дуже яскраво показує внутрішній шлях розвитку, що його проходить кожен письменник, перед тим як опублікувати свою першу книжку.
Читать дальше