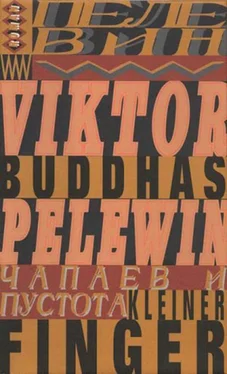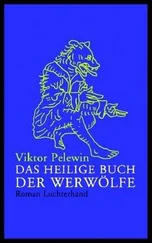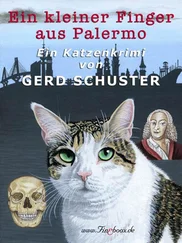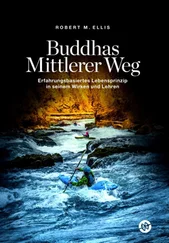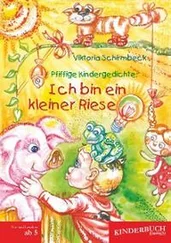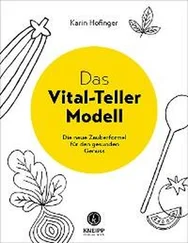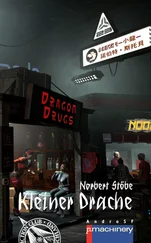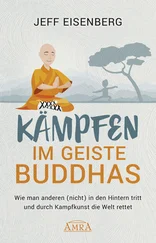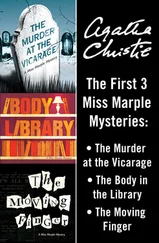Ein paar tiefe Atemzüge in eiskalter Luft brachten mich zur Besinnung; dennoch mußte ich mich an der Hauswand abstützen, so sehr hatte mich der Weg über diesen Korridor er schöpft.
Vielleicht fünf Meter schneebedeckter Asphalt trennten mich von der Tür, als diese noch einmal aufflog – zwei Männer kamen herausgesprungen und rannten zu einem langen, schwarzen Automobil, dessen Kofferklappe sie öffneten. Mit furchtbar ausschauenden Waffen in den Händen stürzten sie, ohne den Kofferraum zu schließen, wieder hinein, so als sei es ihre größte Sorge, ja nichts von dem zu verpassen, was sich dort drinnen abspielte. Mich würdigten sie keines Blickes.
Immer neue Einschußlöcher platzten in die schwarzen Fensterscheiben des Restaurants; man bekam den Eindruck, als wären mehrere Maschinengewehre im Saal zugange. Zu meiner Zeit waren die Menschen gewiß auch nicht besser, dachte ich, aber die Sitten waren entschieden weniger rauh.
Es war Zeit zu gehen.
Ich wankte über den Hof hinaus auf die Straße.
Tschapajews Panzerwagen stand genau dort, wo ich ihn vermutet hatte, und die Schneehaube auf seinem Turm war, wie sie sein mußte. Der Motor lief; ein graues Rauchwölkchen wälzte sich das angeschnittene Heck hinauf. Ich schleppte mich bis zur Tür und klopfte. Die Tür ging auf, ich kroch hinein.
Tschapajew war ganz der alte – nur daß sein linker Arm in einer schwarzen Schlaufe steckte. Das Handgelenk war verbunden. Unter einigen Schichten Mull war die Abwesenheit des kleinen Fingers zu ahnen.
Ich bekam zunächst kein Wort heraus; die Kraft reichte gerade noch, um mich auf die Bank fallen zu lassen. Tschapajew war sofort im Bilde. Er schlug die Tür zu, sprach leise etwas in den Hörer, und der Panzerwagen fuhr an.
»Was macht die Kunst?« fragte er.
»Ich weiß nicht. Das Innenleben hat so viele Widersprüche … In dem Wirbel von Klängen und Farben findet man sich schwer zurecht.«
»Kann ich verstehen«, sagte Tschapajew. »Übrigens, schönen Gruß von Anna. Ich soll dir das hier geben.«
Er beugte sich nach vorn, griff mit der gesunden Hand unter den Sitz und stellte eine leere Flasche mit einem quadratischen Stück Goldfolie als Etikett auf den Tisch. Aus dem Flaschenhals ragte eine gelbe Rose.
»Sie sagte, du würdest das schon verstehen«, erklärte Tschapajew. »Und außerdem hättest du ihr irgendwelche Bücher versprochen.«
Ich nickte, drehte mich zur Tür und preßte das Auge gegen den Spion. Anfangs sah ich nur, wie sich die blauen Lichtpunkte der Laternen durch die klare Frostluft schoben. Doch wir legten an Tempo zu – und bald, sehr bald knirschte der Wüstensand, und es rauschten die Wasserfälle meiner heißgeliebten Inneren Mongolei.
Kafka-Jurte
1923-1925
Der Mythos vom Feldkommandeur
oder: Wer war Wassili Tschapajew?
Anstelle eines Nachworts
Hinter Wassili Tschapajew verbergen sich vier grundverschiedene Personen. Da wäre zunächst der realhistorische Träger dieses Namens, ein Offizier in der Roten Armee, der anno 1919 mit seiner Truppe im Vorland des Uralgebirges gegen die Weißen kämpfte. Zweitens die Hauptfigur aus einem gleichnamigen Film der Gebrüder Wassiljew in den dreißiger Jahren, einem der bedeutendsten und beliebtesten sowjetischen Filmklassiker. Drittens kennen wir Wassili Iwanowitsch Tschapajew aus einer zu Sowjetzeiten weitverbreiteten Endlosserie von Witzen, worin außer ihm noch sein Adjutant Petka, Kommissar Furmanow und die schöne Maschinengewehrschützin Anka vorkommen. Und viertens gesellt sich der literarische Held zweier Tschapajew-Romane dazu. Den einen schrieb in den zwanziger Jahren Dmitri Furmanow, der zuvor Politkommissar des authentischen Tschapajew gewesen war. (Sein Buch diente dem Film der Wassiljews im weitesten Sinne als Vorlage.) Den anderen habe ich geschrieben – oder sagen wir, auch in meinem Buch gibt es eine handelnde Person, die Wassili Tschapajew heißt.
Ein militärischer Vorgesetzter im modernen Sinne ist jener authentische rote Kommandeur Tschapajew beileibe nicht gewesen – eher ließe er sich, mit einem heutigen Begriff, als Feldkommandeur bezeichnen. Dieses Wort kam bei uns erstmals zu Zeiten des von Breshnew angezettelten Afghanistan-Krieges auf und feierte jüngst während des Tschetschenien-Krieges fröhliche Urständ in sämtlichen Zeitungen und Nachrichtenprogrammen. Ein Feldkommandeur ist das Machtzentrum eines bestimmten, flexiblen Territoriums, dessen Grenzen in der Regel in Sichtweite liegen und das er sozusagen als mobiles kleines Fürstentum mit sich führt. Theoretisch ist der Feldkommandeur höheren Chargen in der militärischen Rangordnung unterstellt, in der Praxis jedoch ist diese Unterstellung relativ und unerheblich, denn handeln muß er stets unter den Bedingungen totaler Anarchie und Unsicherheit, mehr noch: Das Auftauchen von Feldkommandeuren ist gerade ein Symptom dafür, daß Chaos herrscht. Sie sind dazu da, der Entropie die Stirn zu bieten, wieder Ordnung ins Leben zu bringen, wenn auch mit ziemlich blutigen Methoden. Ich las einmal in der Zeitung eine hübsche Liste (sie hätte von Borges stammen können), die dem Feldkommandeur folgende typische Eigenschaften zuschreibt: tapfer, ungebildet, reaktionsschnell, stotternd, naiv und grausam.
Warum hat die Figur des Feldkommandeurs einen solch gewichtigen Platz in der sowjetischen Mythologie inne? Zur Erklärung bediene ich mich ungern abstrakter Konzepte, lieber vertraue ich dem persönlichen Erfahrungs- und Erlebnisschatz meiner Moskauer Schulzeit. Geboren in den Sechzigern, bezog ich erste Unterweisungen zur Geschichte meines Landes nicht aus Lehrbüchern, sondern aus der Visualkultur meiner alltäglichen Umgebung. Und da sah die Vergangenheit so aus: Erst kurze Zeit war es her, daß wir das Weltall erobert, alles Irdische hinter uns gelassen und uns für alle Zeiten in der Ewigkeit angesiedelt hatten. Davor hatten wir den furchtbaren und heroischen Großen Vaterländischen Krieg gewonnen. Noch davor lagen die ersten Jahre der Sowjetunion, als das Land, atemlos vor Glück und vom vielen Singen, die großen Fabriken und Elektrizitätswerke erbaute. Und davor schließlich gab es die Revolution, ein halbmythisches, transzendentes Ereignis, von dem nicht so sehr Fakten wie Bilder kündeten: zyklopenhafte Skulpturengruppen, mit Vorschlaghämmern bewaffnete Titanen oder auch (als Mosaik an den Wänden einer Metrostation) eine Schar Reiter mit Budjonnymützen, die in einer gigantischen, glutrot aufgehenden Sonne versinkt. Alles dem Sinn nach verschwommen, doch von stark aufgeladener Emotionalität. Die in der sowjetischen Öffentlichkeit allgegenwärtige sogenannte »Sichtagitation« bewirkte, daß die Geschichte nicht als Abfolge von Ereignissen, sondern als Baukasten emotionaler Codes erschien.
Der sowjetische Gründungsmythos in all seinen Komponenten verwies auf eine sogenannte Frühzeit – die Epoche der Revolution, da die alte Welt zerstört, der alte Gott gekippt und kastriert und ein neuer auf den Thron gehoben wurde. Wiewohl diese Frühzeit, von den fünfziger, sechziger Jahren aus gesehen, chronologisch noch zur jüngeren Vergangenheit gehörte, schien sie aus der Innenperspektive des Mythos unglaublich weit entlegen. Gewissermaßen lagen die Zeiten, in denen Reiterhelden unter den Klängen revolutionärer Lieder durch die Steppen des Südens galoppierten, viel, viel weiter zurück als das Rußland eines Lew Tolstoi und sogar eines Alexander I. Der monströse Bruderkrieg der Jahre 1918-1921 hatte das Land seiner dünnen Schale von Kultur und Zivilisation beraubt; es war fürwahr eine Zeit neuer Titanomachie, da grausame, hundertarmige Wesen einander stürzten und vernichteten, Götter und Heroen miteinander rangen – und es war jene unscharfe Grenze, hinter der das Nichts gähnte und wo die Geschichte erst begann.
Читать дальше