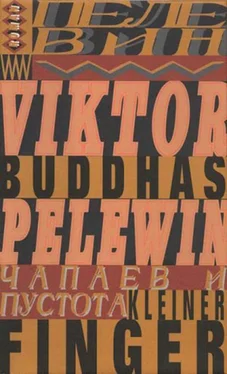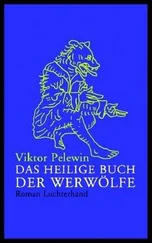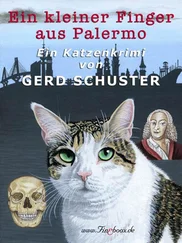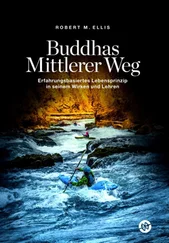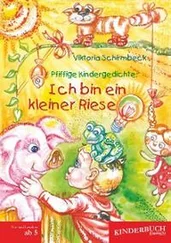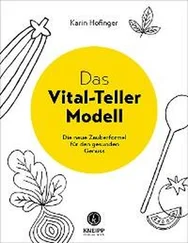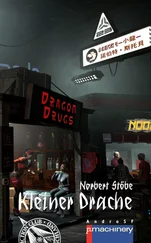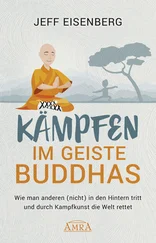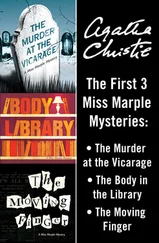Die Portiere am Eingang bewegte sich, und der Mann im roten Hemd schob sich herein. Er schnipste mit den Fingern ins Dunkle und deutete auf unseren Tisch, dann drehte er sich zu uns herum, tat eine knappe, förmliche Verbeugung und verschwand wieder hinter dem Vorhang. Sofort tauchte von irgendwoher ein Kellner auf, mit Tablett in der einen und Kupferteekessel in der anderen Hand (solche Kessel standen auch auf den anderen Tischen). Auf dem Tablett waren ein Teller Piroggen, drei Teegläser und eine winzige Trillerpfeife. Der Kellner baute die Gläser vor uns auf, goß aus dem Kessel ein und verharrte erwartungsvoll. Ich reichte ihm eine Banknote, die ich aufs Geratewohl aus dem Köfferchen gezogen hatte – ich glaube, es war ein Zehndollarschein. Wozu die Pfeife auf dem Tablett lag, war mir zunächst unklar, doch da ertönte von einem der Nachbartische ein leiser, melodischer Pfiff, und der Kellner eilte ihm entgegen.
Sherbunow nippte aus seinem Glas und brummte unzufrieden vor sich hin. Ich tat einen Schluck aus meinem. Es war Chansha, schlechter chinesischer Hirsebranntwein. Ich nahm eine Pirogge und fing an zu kauen, obwohl ich keinerlei Geschmack spürte – das Kokain, das meinen Gaumen narkotisiert hatte, wirkte noch.
»Was ist in den Piroggen drin?« fragte Barbolin mit seiner sanften Stimme. »Soll vorkommen, daß Leute von hier verschwinden. Zuviel Gefräßigkeit könnte einem leid tun.«
»Ich hab schon probiert«, sagte Sherbunow ungerührt. »Schmeckt wie Rindfleisch.«
Den Gedanken weiterzuspinnen fehlte mir die Kraft; ich holte das Döschen hervor, und Barbolin übernahm es, drei gerechte Portionen in die Gläser zu verteilen.
Unterdessen war der Mann im Frack mit seinem Spiel zu Ende gekommen, flink und elegant zog er Strumpf und Schuh an, stand auf, verbeugte sich, ergriff seinen Schemel und verließ unter spärlichem Applaus das Podium. An einem Tisch gleich neben der Bühne erhob sich ein würdiger graubärtiger Herr, um dessen Hals, wie um eine Bißwunde zu verbergen, ein grauer Schal geschlungen war. Verblüfft erkannte ich in ihm den gealterten, abgemagerten Dichter Waleri Brjussow. Er stieg auf die Bühne und wandte sich an den Saal:
»Genossen! Zwar leben wir heute in einer visuellen Epoche, wo die auf Papier abgesetzte Textzeile verdrängt wird von einer halben Bildfolge, um nicht zu sagen, hä …« – hier rollte er mit den Augen, machte eine Pause, und es war klar, daß man jetzt auf einen seiner idiotischen Kalauer gefaßt sein mußte – »um nicht zu sagen, von den Folgen der Halbbildung, hä …, doch gibt die Tradition nicht klein bei und sucht sich neue Formen. Dostojewskis unsterbliche Helden inspirieren die jungen Heißsporne nach wie vor, gleich, ob mit oder ohne Hackebeil. Was Sie heute abend sehen werden, darf ich als markantes Beispiel für die Kunst des egoumbilizistischen Postrealismus bezeichnen. Zur Aufführung kommt eine kleine Tragödie, in einem, hä … in einem Schuß, hä, geschrieben von Kammerdichter Johann Pawluchin, der höchstselbst sein Werk dem tragödischen Fach zugeordnet sehen möchte. Erleben Sie also nun die kleine Tragödie ›Raskolnikow und Marmeladow‹. Bitteschön.«
»Bitteschön«, echote Sherbunow, und wir tranken.
Brjussow ging ab und kehrte zu seinem Tisch zurück. Zwei Männer in Militäruniform trugen eine riesige vergoldete Lyra mit Ständer aus den Kulissen heraus auf die Bühne, dazu einen Schemel. Anschließend brachten sie einen Tisch, stellten eine bauchige Likörflasche nebst zwei Gläsern darauf ab und hängten am Bühnenhintergrund zwei Pappschilder mit den Namen »Raskolnikow« und »Marmeladow« auf (die Endungen wieder in alter Schreibweise, eine noch dazu falsch, und ich entschied sofort, daß dies absichtlich so dastand und eine symbolische Bedeutung hatte), dazwischen kam noch ein Schild mit der rätselhaften, auf ein blaues Fünfeck gemalten Inschrift ЙХВЙ. Nach getaner Arbeit verschwanden die beiden Männer. Eine Frau im langen Chiton trat aus den Kulissen, setzte sich an die Lyra und begann bedächtig die Saiten zu zupfen. So vergingen einige Minuten.
Dann traten vier Männer in langen, schwarzen Mänteln auf. Ein jeder kniete in Schützenstellung nieder und hob den schwarzen Mantelsaum, um sein Gesicht vor den Zuschauern zu verbergen. Jemand klatschte. Zu beiden Seiten der Bühne erschien je eine Gestalt auf hohen Kothurnen, mit langem weißen Chlamys und griechischer Maske. Die beiden schritten langsam aufeinander zu und verharrten, ehe sie sich ganz erreicht hatten. Dem einen hing an rosenumrankter Schlaufe ein Beil an der Seite, und ich verstand, das sollte Raskolnikow sein. Wobei man es auch ohne Beil hätte verstehen können, denn auf seiner Höhe hing das Schild mit dem Namen. Der Schauspieler, der vor dem Schild »Marmeladow« Aufstellung genommen hatte, hob langsam die Hand und begann in hohem, singendem Tonfall:
»Also, ich bin Marmeladow. Mal eben
ganz im Vertrauen: Fi-ni-to. Juchhei!
Ich hab so manches gesehen im Leben,
aber ein Lichtblick war niemals dabei.
Falls Euch nicht stört, daß ich mich offenbare,
und Euch der Mief armer Leute nicht schreckt:
Wollt Ihr ein Schlückchen vom Branntwein?« –
»Bewahre!«
Die Antwort des mit dem Beil bewaffneten Mimen erfolgte mit ebenso singender Stimme, allerdings im Baß; dabei hob er die Hand und streckte sie Marmeladow abwehrend entgegen, welcher sich hastig etwas ins Glas goß und durch das Loch in der Maske kippte, worauf er fortfuhr:
– »Dann eben nicht. Sehr zum Wohl! Mit Respekt:
Ihr seid ja auch nicht ganz koscher, vermut ich.
Zugeknöpft scheint Euer lächelnder Mund,
Blaß ist die Stirn, und die Hände sind blutig.
Sei's drum! Ich sah jedenfalls keinen Grund,
in meinem Innern die gähnende Leere ,
in meinem Kopf das gefräßige Loch
hinter Blasiertheit und …« – »Habe die Ehre!«
– »… Schliff zu verstecken. He, wartet doch noch!«
Sherbunow stieß mich mit dem Ellbogen in die Seite. »Wollen wir?« fragte er leise.
»Es ist noch zu früh«, erwiderte ich flüsternd. »Sehen wir weiter.«
Sherbunow nickte ehrerbietig. Das Geschehen auf der Bühne ging seinen Gang, Marmeladow sprach:
»Hört, ich geb zu, ohne Maske ist's schlimmer!
Jedes Erwachen: ein Blutsturz beinah.
Wie mit dem Beil übern Kopf ist das immer!
Könnt Ihr mir folgen, mein Lieber?« – »Oh, ja.«
– »Drum ist das Tor meiner Seele vergittert.
Drinnen ist's finster und klamm wie im Sarg.
Und diese Leichen im Keller … Ihr zittert?«
– »Bitte! Was wolln Sie? Ich finde es arg!«
– »Ich? Was ich will? Soll ich's wirklich schon sagen?
Nicht vielleicht vorher ein Gläschen Likör?«
– »Gnädiger Herr, mich empört Ihr Betragen!
Welch Penetranz! Wie der letzte Frisör!
Also, adieu.« – »Laßt mich bitte gewähren!
Einen Moment noch, mein Freund! Alldieweil …«
– »Würden Sie mir jetzt gefälligst erklären,
was Ihr Begehr ist?« – »Verkauft mir das Beil!«
Unterdessen hatte ich mich im Saal umgeschaut. An den runden Tischen saßen sie zu dreien oder vieren; das Publikum war sehr gemischt, doch waren, wie es in der Geschichte der Menschheit alleweil zu sein pflegt, schweinsgesichtige Spekulanten und teuer ausstaffierte Huren in der Überzahl. An einem Tisch mit Brjussow saß Alexej Tolstoi, der, seit ich ihn zum letztenmal gesehen hatte, deutlich dicker geworden war; anstelle der Krawatte trug er eine große Schleife. Man konnte meinen, das an ihm aufgeschwemmte Fett wäre zuvor aus dem nun spindeldürren Brjussow abgesogen worden. Sie ergaben ein gespenstisches Paar.
Als ich den Blick weiterwandern ließ, bemerkte ich einen sonderbaren Menschen in mehrfach gegürteter, schwarzer Uniformbluse und mit aufgezwirbeltem Schnurrbart. Er saß allein an seinem Tisch und hatte anstelle des Kupferkessels eine Flasche Sekt vor sich stehen. Mir schien er irgendein hohes bolschewistisches Tier zu sein; ich weiß nicht, was an seinem energischen Gesicht, seiner gelassenen Miene so ungewöhnlich war, daß ich die Augen für einige Sekunden nicht von ihm losreißen konnte. Erst als sich unsere Blicke trafen, drehte ich mich rasch zur Bühne, wo der sinnlose Wortwechsel immer weiterging:
Читать дальше