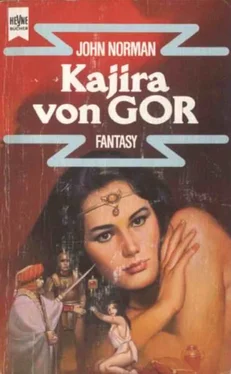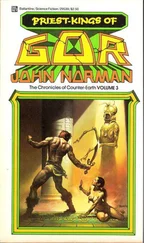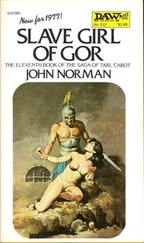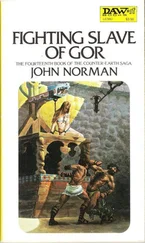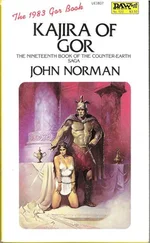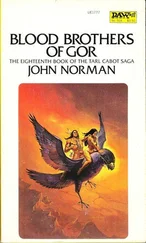»Du hast den Schlüssel nicht?« fragte ich.
»Nein, Herrin«, antwortete sie lachend. »Natürlich nicht.«
Ich erschauderte. »Darf ich dir eine intime Frage stellen, Susan?«
»Natürlich, Herrin«, sagte sie.
»Bist du noch Jungfrau?«
Das Mädchen lachte wieder. »Nein, Herrin, ich wurde den Herren schon vor langer Zeit für ihr Vergnügen zugänglich gemacht.«
»Zugänglich gemacht? Für ihr Vergnügen?«
»Ja, natürlich.«
»Du hast mich ›Herrin‹ genannt. Warum?«
»So reden Mädchen wie ich freie Frauen an«, lautete die Antwort.
»Was für ein Mädchen bis du denn?«
»Ein braves Mädchen, hoffe ich«, erwiderte sie. »Ich werde versuchen, dir gut zu dienen.«
»Bist du Sklavin?« flüsterte ich.
»Ja, Herrin«, entgegnete sie.
Ich trat einen Schritt zurück. Ich hatte versucht, mich dieser Erkenntnis zu widersetzen. Immer wieder hatte ich mir eingeredet, daß das nicht sein konnte, daß es nicht sein durfte. Doch wie einfach, wie offenkundigere plausibel war eine solche Erklärung für alles, das mich verwirrt hatte: für die Kleidung des Mädchens, für das Zeichen an ihrem Bein, für den Kragen, der ihren Hals umschloß.
»Ich bin Sklavin Ligurious’, des ersten Ministers von Corcyrus«, sagte sie, schob den Kragenschutz weiter zurück und zeigte mir mit tastenden Fingern einige Zeichen an dem Stahlband. Symbole waren dort eingraviert. Ich vermochte die Schrift nicht zu lesen. »Diese Information ist dort festgehalten«, erklärte sie und schob den Seidenschutz wieder zurück. »Ich wurde vor beinahe zwei Jahren in den Gehegen des Saphronicus in Cos gekauft.«
»Der Stoff soll also den Kragen verbergen?«
»Nein, Herrin«, sagte sie. »Daß der Kragen vorhanden ist, läßt sich auch durch den Stoffüberzug nicht verhüllen.«
»Ich verstehe«, sagte sie. »Das Gelb paßt gut zum Gelb deines Gürtels«, fuhr ich fort, »und zu den hübschen Blumen auf der Tunika.«
Das Mädchen lächelte. »Die Blumen sind Talenderblumen, eine wunderschöne Blüte. Sie symbolisiert oft die Liebe.«
»Sehr hübsch.«
»Manche freie Frauen haben etwas dagegen, wenn Sklavinnen Talender tragen dürfen«, erklärte Susan, »sei es in natura oder als Darstellung auf ihrem Gewand.«
»Warum sind freie Frauen dagegen?«
»Sie meinen, eine Sklavin, die immer dann lieben muß, wenn es ihr befohlen wird, kann nichts von der Liebe wissen.«
»Oh«, sagte ich.
»Aber ich bin frei gewesen, ehe ich Sklavin wurde«, fuhr sie fort. »Verzeih mir, Herrin, aber ich meine, daß nur die Sklavin in ihrer Verletzbarkeit und Hilflosigkeit wirklich wissen kann, was Liebe bedeutet.«
»Du mußt auf Befehl lieben?« fragte ich entsetzt.
»Wir müssen tun, was uns gesagt wird«, sagte sie schlicht. »Wir sind Sklavinnen.«
Beim Gedanken an die Hilflosigkeit der Sklavin lief mir ein Schauder über den Rücken.
»Natürlich darf jede Sklavin hoffen, einem echten Herrn zu gehören.«
»Geschieht dies denn jemals?« fragte ich.
»Oft, Herrin, denn hier herrscht kein Mangel an solchen Männern.«
Ich fragte mich, an was für einem Ort ich mich befinden mochte, wenn hier kein Mangel an echten Sklavenherren herrschte. In meinem ganzen Leben hatte ich einen solchen Mann bisher nicht kennengelernt. Am nächsten kamen dieser Vorstellung die Männer, die mich vermutlich an diesen Ort gebracht hatten; sie hatten mich wie einen Niemand behandelt. Sie hatten mich dermaßen geschwächt, daß ich sie beinahe darum angefleht hatte, mich zu nehmen, wie ich war. Nun kam mir der entsetzliche Gedanke, daß ich vielleicht für solche Männer geboren war.
»Wie erniedrigend ist doch das Sklavendasein!« rief ich.
»Ja, Herrin«, erwiderte das Mädchen und senkte den Kopf. Ich hatte das Gefühl, daß sie lächelte. Sie hatte mir wohl geantwortet, was ich hören wollte.
»Sklaverei ist illegal!« rief ich.
»Hier nicht, Herrin«, sagte sie.
Ich trat einen Schritt zurück. »Man kann doch andere Menschen nicht besitzen«, flüsterte ich entsetzt.
»Hier ist das möglich«, erwiderte sie. »Du kannst es mir glauben – abseits aller Fragen der Rechtmäßigkeit oder Moral; all diese Fragen wollen wir mal beiseite lassen, denn sie beziehen sich nicht auf die Tatsachen.«
»Dann gibt es hier im Haus also wirklich Sklaven?« fragte ich staunend.
»Ja«, antwortete sie. »Hier und überall.«
Wieder wußte ich nicht, was sie mit ›überall‹ meinte. Sie sprach beinahe, als befänden wir uns nicht auf der Erde, an einem Ort auf der Erde.
Mein Herz hatte heftig zu pochen begonnen. Angstvoll schaute ich mich in dem großen Raum um. Er hatte keine Ähnlichkeit mit anderen Räumen, in denen ich bisher gewesen war. Auf keinen Fall schien er sich in England oder Amerika zu befinden. Ich wußte nicht, wo ich war, auf welchen Kontinent man mich gebracht hatte. Ich war in der Gegenwart einer Sklavin, einer Frau, die einen Besitzer hatte. Ihr Herr war Ligurious, Minister dieser Stadt, die angeblich den Namen Corcyrus trug. Ich blickte auf das Gitterfenster, das barbarische Bett, die Kette am Fußende, die Ringe an der Wand. Und wieder war mir meine Beinahe-Nacktheit auf das unangenehmste bewußt.
»Susan?« fragte ich.
»Ja, Herrin?«
»Bin ich eine Sklavin?«
»Nein, Herrin.«
Ich wurde beinahe ohnmächtig vor Erleichterung. Einen Augenblick lang schien der Raum um mich zu kreisen. Ich war unsagbar froh, keine Sklavin zu sein – doch unerklärlicherweise erfüllte mich plötzlich auch ein tiefer Kummer deswegen. Mir ging zu meinem Schrecken auf, daß in mir etwas danach verlangte, einen Herrn über mir zu wissen. Ich betrachtete das Mädchen. Sie stand im Eigentum eines Mannes! In diesem Moment beneidete ich sie um den Kragen.
»Ich bin auch Sklavin!« sagte ich zornig. »Schau mich doch an. Ich bin nackt und trage einen Fußreif.«
»Ich weiß, daß die Herrin frei ist«, antwortete das Mädchen. »Ligurious, mein Herr, hat es mir gesagt.«
»Aber ich bin nackt.«
»Die Herrin ist nur noch nicht angekleidet«, gab sie zurück, ging zu der Schiebetür an der Seitenwand und öffnete sie. Dahinter hingen zahlreiche Gewänder – offenbar eine umfangreiche, elegante Garderobe.
Sie brachte mir eine hübsche, kurze, gestreifte, mit Schärpen verzierte, schimmernde gelbweiße Robe und hielt sie mir hin.
Ich fand das Gewand bezaubernd, gleichzeitig aber zu aufregend-sinnlich.
»Hast du nichts Einfacheres, Schlichteres?« fragte ich.
»Etwas Männlicheres?« fragte das Mädchen.
»Ja«, antwortete ich unsicher. Dieses Wort hatte ich natürlich nicht im Sinn gehabt, doch schien es mir einigermaßen zu passen.
»Möchte sich die Herrin wie ein Mann kleiden?« fragte Susan.
»Nein, eigentlich nicht.«
Und es stimmte – ich wollte mich nicht wie ein Mann anziehen, doch fühlte ich, daß es besser sei, eine eher strengere Kleidung zu wählen. Hatte man mich nicht gelehrt, daß ich praktisch dem Manne gleich sei?
»Herrin«, sagte das Mädchen und half mir in die Seidenrobe. Ich schloß die gelbseidene Schärpe. Der Rock endete weit über dem Knie. Erstaunt musterte ich mich im Spiegel. In einem solchen Gewand, lieblich gestaltet, meinen Körper eng nachzeichnend, konnte kein Zweifel bestehen, daß ich eine Frau war.
»Die Herrin ist schön«, sagte das Mädchen.
Im gleichen Moment wurde laut an die Tür geklopft. Ich fuhr schreiend zusammen.
Ein großgewachsener, kräftiger Mann stand auf der Schwelle. Er schaute sich um. Sein Blick hatte etwas Durchdringendes. Er besaß breite Schultern und lange Arme. Das braune, von grauen Strähnen durchzogene Haar war ziemlich kurz geschnitten. Er trug eine rot abgesetzte weiße Tunika. Als sein Blick mich traf, wäre ich beinahe ohnmächtig geworden. Es muß an seinem Blick gelegen haben. Ich wußte: Einen solchen Mann hatte ich noch nicht gesehen. Etwas unterschied ihn von allen anderen Männern, denen ich bisher begegnet war. Es war beinahe, als habe in ihm ein Löwe menschliche Gestalt angenommen.
Читать дальше