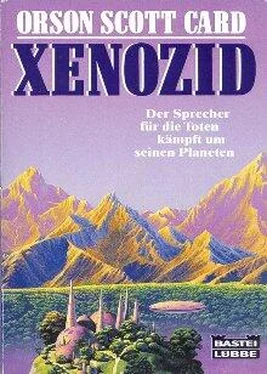Er erhob sich, wurde sich undeutlich bewußt, daß die Leute sich umdrehten, um ihn anzusehen.
»Ach nein?« Seine Stimme war schwer zu verstehen, und er versuchte nicht, sie deutlicher klingen zu lassen. Er machte einen zögernden Schritt in den Gang und drehte sich dann endlich zu ihr um. »So hast du mich in Erinnerung?«
Sie sah zu ihm auf, entsetzt – worüber? Über Miros Sprache, seine unbeholfenen Bewegungen? Oder einfach, weil es ihr peinlich war, weil sich nicht die tragische, romantische Szene ergab, die sie sich seit dreißig Jahren vorgestellt hatte?
Ihr Gesicht war nicht alt, aber es war auch nicht Ouandas Gesicht. Im mittleren Alter, dicker, mit Falten um den Augen. Wie alt war sie? Fünfzig? Fast. Was hatte diese fünfzigjährige Frau mit ihm zu schaffen?
»Ich kenne dich nicht einmal«, sagte Miro. Dann schwankte er zur Tür hinaus und schritt in den Morgen.
Irgendwann später fand er sich im Schatten eines Baumes wieder. Welcher war es, Wühler oder Mensch? Miro versuchte sich zu erinnern – es war schließlich erst ein paar Wochen her, daß er aufgebrochen war –, doch damals war Mensch' Baum nur ein Schößling gewesen, und nun schienen beide Bäume gleich groß zu sein, und er wußte nicht mehr genau, ob Mensch hügelauf- oder abwärts von Wühler getötet worden war. Es spielte auch keine Rolle – Miro hatte nichts zu einem Baum zu sagen, und sie hatten nichts zu ihm zu sagen.
Außerdem hatte Miro die Baumsprache nie gelernt; sie hatten nicht einmal gewußt, daß dieses Schlagen mit Stöcken wirklich eine Sprache war, bis es für Miro zu spät war. Ender beherrschte es, und Ouanda und wahrscheinlich noch ein halbes Dutzend andere, aber Miro würde es niemals lernen, weil Miros Hände die Stöcke ganz einfach nicht halten und den Rhythmus schlagen konnten. Noch eine Sprache, die nutzlos für ihn war.
»Que dia chato, meu filho.«
Das war eine Stimme, die sich nie ändern würde. Und die Einstellung hatte sich auch nicht geändert: Was für ein blöder Tag, mein Sohn. Fromm und verschlagen zugleich – und voller Spott über beide Gesichtspunkte.
»Hallo, Quim.«
»Jetzt heißt es Vater Estevão, fürchte ich.« Quim hatte bereits die vollen Regalien eines Priesters erhalten, mit Robe und allem; nun raffte er sie hoch und setzte sich vor Miro in das niedergetretene Gras.
»Du siehst auch dementsprechend aus«, sagte Miro. Quim war ebenfalls älter geworden. Als Kind hatte er hager und fromm ausgesehen. Die Auseinandersetzung mit der wirklichen Welt anstelle von theologischen Theorien hatte ihm Falten und Runzeln eingebracht, doch das Gesicht, das aus dieser Veränderung resultierte, zeigte Leidenschaft. Und Stärke. »Tut mir leid, daß ich bei der Messe eine Szene gemacht habe.«
»Hast du das?« fragte Miro. »Ich war nicht da. Oder besser, ich war bei der Messe – ich war nur nicht in der Kathedrale.«
»Kommunion für die Ramänner.«
»Für die Kinder Gottes. Die Kirche hat schon ein Vokabular, um sich mit Fremden zu befassen. Wir mußten nicht auf Demosthenes warten.«
»Du mußt deshalb nicht so zynisch sein, Quim. Du hast die Begriffe nicht erfunden.«
»Streiten wir uns nicht.«
»Dann lassen wir uns auch nicht in die Meditationen anderer Leute einmischen.«
»Eine edle Einstellung. Bis auf die Tatsache, daß du dich ausgerechnet im Schatten eines meiner Freunde ausruhst, mit dem ich mich unterhalten muß. Ich dachte, es sei höflicher, zuerst mit dir zu sprechen, bevor ich mit Stöcken auf Wühler schlage.«
»Das ist Wühler?«
»Sag hallo. Ich weiß, daß er sich auf deine Rückkehr gefreut hat.«
»Ich habe ihn nie gekannt.«
»Aber er weiß alles über dich. Ich glaube, du begreifst gar nicht, Miro, was für ein Held du unter den Pequeninos bist. Sie wissen, was du für sie getan hast und was es dich gekostet hat.«
»Und wissen sie auch, was es uns alle am Ende wahrscheinlich kosten wird?«
»Am Ende werden wir alle vor Gottes Gericht stehen. Wenn ein ganzer Planet voller Seelen auf einmal genommen wird, ist es lediglich von Belang, dafür zu sorgen, daß niemand ungetauft geht, dessen Seele unter den Heiligen vielleicht willkommen gewesen wäre.«
»Also ist es dir völlig egal?«
»Mir ist es natürlich nicht egal«, entgegnete Quim. »Doch sagen wir einfach, daß es eine längere Sicht gibt, bei der Leben und Tod nicht so wichtig sind wie die Entscheidung, welches Leben wir führen und was für einen Tod wir haben.«
»Du glaubst wirklich daran, nicht wahr?« sagte Miro.
»Es kommt darauf an, was du mit ›daran‹ meinst. Ja, ich glaube daran.«
»Ich meine das alles. Ein lebender Gott, ein auferstandener Christus, Wunder, Visionen, die Taufe, die Transsubstantion…«
»Ja.«
»Wunder. Heilung.«
»Ja.«
»Wie bei dem Schrein von Großvater und Großmutter.«
»Dort wurden viele Heilungen gemeldet.«
»Du glaubst daran?«
»Miro, ich weiß es nicht – einige davon waren vielleicht hysterisch. Bei einigen handelte es sich um einen Placebo-Effekt. Einige kolportierte Heilungen waren vielleicht spontane Remissionen oder natürliche Besserungen.«
»Aber einige waren echt.«
»Vielleicht.«
»Du glaubst, daß Wunder möglich sind.«
»Ja.«
»Aber du glaubst nicht, daß eins wirklich passiert ist.«
»Miro, ich glaube, daß Wunder geschehen. Ich weiß nur nicht, wie genau die Menschen beobachten, welche Ereignisse Wunder sind und welche nicht. Viele angebliche Wunder waren zweifellos gar keine. Wahrscheinlich wurden aber auch viele Wunder gar nicht erkannt, als sie geschahen.«
»Was ist mit mir, Quim?«
»Mit dir?«
»Warum gibt es kein Wunder für mich?«
Quim zog den Kopf ein und rupfte an dem kurzen Gras vor ihm. Diese Gewohnheit hatte er schon als Kind gehabt, wenn er einer schwierigen Frage ausweichen wollte; es war die Art, wie er reagierte, wenn ihr vermeintlicher Vater, Marcao, wieder auf einer Sauftour war.
»Nun, Quim? Gibt es Wunder nur für andere Menschen?«
»Es gehört zum Wunder, daß niemand weiß, warum es geschieht.«
»Was für ein Betrüger bist du doch, Quim.«
Quim errötete. »Du willst wissen, warum du keine Wunderheilung bekommst? Weil du nicht glaubst, Miro.«
»Was ist mit dem Mann, der sagte: ›Ja, Herr, ich glaube – vergib mir meinen Unglauben.‹?«
»Bist du dieser Mann? Hast du jemals um eine Heilung gebeten?«
»Ich bitte jetzt darum«, sagte Miro. Und dann traten ungewollt Tränen in seine Augen. »O Gott«, flüsterte er. »Ich schäme mich so.«
»Weshalb?« fragte Quim. »Weil du Gott um Hilfe gebeten hast? Oder weil du vor deinem Bruder weinst? Wegen deiner Sünden? Wegen deiner Zweifel?«
Miro schüttelte den Kopf. Er wußte es nicht. Diese Fragen waren zu schwer. Dann begriff er, daß er die Antwort kannte. Er streckte die Arme aus. »Ich schäme mich dieses Körpers«, sagte er.
Quim streckte die Hände aus, ergriff Miros Arme an den Schultern und zog ihn zu sich. Seine Hände glitten Miros Arme hinab, bis sie die Gelenke umklammerten. »Das ist mein Körper, den ich euch gegeben habe, sagte er uns. So, wie du deinen Körper für die Pequeninos gegeben hast. Für die Kleinen.«
»Ja, Quim, aber er hat seinen Körper zurückbekommen, nicht wahr?«
»Er ist aber auch gestorben.«
»Kann ich so geheilt werden? Indem ich eine Möglichkeit finde, mich zu töten?«
»Sei kein Idiot«, sagte Quim. »Christus hat keinen Selbstmord begangen. Das was Judas' Verrat.«
Miros machte seinem Ärger Luft. »All diese Menschen, deren Erkältungen kuriert werden, deren Migräne auf wundersame Weise verschwindet – willst du mir sagen, daß sie vor Gott mehr verdient haben als ich?«
Читать дальше