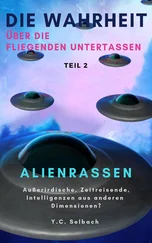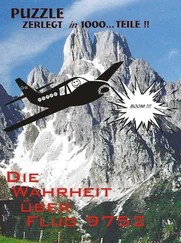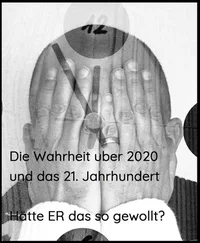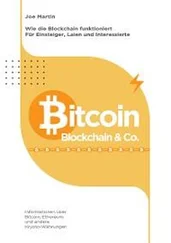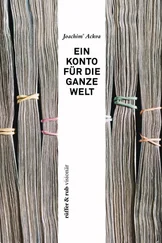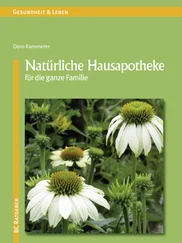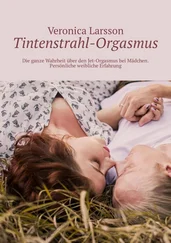Unter Putin wurde keine einzige Erdgaslagerstätte nutzbar gemacht, mit Ausnahme des sogenannten Bovanenkowo-Gasfelds in Westsibirien. Aber mit dessen Erschließung hatte man bereits zu Zeiten von Boris Jelzin begonnen, als Gazprom von einer ganz anderen Mannschaft geleitet worden war, an deren Spitze der Gründer des russischen Gasmonopols gestanden hatte, der Ex-Ministerpräsident des Landes Viktor Tschernomyrdin.
Die 2005 angekündigten Pläne Putins, aus dem heutigen Russland eine »Energie-Supermacht« zu machen, die andere von Russlands Gas abhängig machen würde, sind gescheitert. Es ist kein Zufall, dass der Begriff »Energie-Supermacht«, den der Kreml und Gazprom Mitte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts mit heraushängender Zunge und hervortretenden Augen allen antrugen, mittlerweile aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist.
Aber abgesehen von den genuinen russischen Kohlenwasserstoffen gibt es in der Oeconomia putina keine zuverlässigen Ressourcen. Schwierige technologische Systeme und Projekte sind hier nicht möglich, weil sich die aus Zeiten der UdSSR stammende technologische Haltbarkeit praktisch erschöpft hat. Ein charakteristisches Beispiel ist das Schicksal eines Projekts, das man 2006 und 2007 mit stolzgeschwellter Brust ausgiebig beworben hat: das Kurzstreckenflugzeug Suchoi Superjet 100.
Das Unternehmen, welches den Superjet herstellen sollte, wurde 2006 in Venedig gegründet, zusammen mit der italienischen Firma Alenia Aeronautica. Der recht exotische Ort für den Flugzeugbau wurde, wie mir scheint, deshalb gewählt, weil die russischen Flugzeugbauer neuster Ausprägung es sich in Venedig einfach gut gehen lassen wollten.
Ich bin ziemlich oft in Venedig und beobachte alles aus nächster Nähe. Die Konstrukteure des Superjets mieteten massenhaft Büros, Wohnungen und Paläste an. Ohne ihr technologisches Bewusstsein wiedererlangt zu haben, gingen sie mittags und abends in den besten Restaurants speisen. Mein venezianischer Freund Rossano, Flugzeugingenieur seit fünfunddreißig Jahren, hat mit den Konstrukteuren des SSJ-100 fast ein Jahr zusammengearbeitet und dann die Flucht ergriffen. Er sagte damals etwa Folgendes zu mir: »Diese Leute werden das Flugzeug nicht bauen. Das Flugzeug interessiert sie überhaupt nicht, es ist etwas ganz anderes, was sie interessiert.«
Rossanos Prognose erwies sich als richtig. Im Mai 2012 stürzte das Flugzeug bei einem Probeflug nach Indonesien wegen des Versagens der Navigation ab und zerschellte an einem Berg. Es kamen fünfundvierzig Menschen ums Leben. Nach diesem Vorfall erteilten die vorrangigen Käufer des unheilvollen Pseudoflugzeugs dem Projekt eine Absage: die Fluggesellschaft Alitalia (ihr ursprüngliches Interesse an dem Superjet gründete auf einer vertraulichen Vereinbarung zwischen Wladimir Putin und Silvio Berlusconi) und Armavia, die staatliche Fluggesellschaft von Armenien. Auch die russische staatliche Fluggesellschaft Aeroflot möchte nun von der fliegenden Bastelarbeit Abstand nehmen; die sie kontrollierende russische Regierung hatte ihr den Superjet geradezu aufgezwungen. Nach Angaben von Aeroflot entfallen 40 Prozent aller Störfälle bei den Flügen der Gesellschaft auf das neue Kurzstreckenflugzeug russischer Erfindung und Herstellung.
Der größte potenzielle Kunde jedoch, die indonesische Kartika Airlines, die ganze dreißig Maschinen des SSJ-100 kaufen wollte, hörte vor kurzem ganz einfach auf zu existieren – wahrscheinlich vor Schreck und aus Angst vor der Aussicht, Fluggeräte kaufen zu müssen, die eigentlich fluguntauglich sind.
Die Pläne für das neue Flugzeug sind nunmehr nichts weiter als ein schlechter Witz, der erneut bestätigt: In Russland gibt es keinen Flugzeug- oder Maschinenbau wie früher. Die Oeconomia putina musste alle hochtechnologischen Zweige vernichten und hat das praktisch auch geschafft. Denn das gehört zur Logik der Chaljawa-Wirtschaft.
Es gibt noch ein weiteres Prinzip der Oeconomia putina, über das zu sprechen sich lohnt. Da die Einnahmen aus den einträglicheren Branchen – Öl- und Gasförderung – zwischen einer kleinen Gruppe von Privatpersonen aufgeteilt werden, müssen die Ausgaben für die Modernisierung der nationalen Infrastruktur (Straßen, Rohrleitungen, kommunale Netze) auf die Bevölkerung abgewälzt werden, also auf die Durchschnittsverbraucher kommunaler Dienstleistungen. Diese Ausgaben sind jedoch riesig und wachsen immer weiter, weil die Infrastruktur, in die seit Leonid Breschnew, also seit dreißig Jahren, keine nennenswerten Gelder investiert wurden, einem völligen Kollaps nahe ist.
In Putins Russland steigen die kommunalen Tarife heftig an. 2012 beispielsweise stieg das Mietniveau in der nördlichen Hauptstadt Sankt Petersburg um 40 Prozent und in einigen Regionen an der Peripherie – dem Verwaltungsgebiet von Murmansk und in der Region Altai – um 226 (!) Prozent. Die Nachricht vom sprunghaften Anstieg der Tarife versetzte sogar Putin in Panik, der sich plötzlich (»plötzlich« ist das Schlüsselwort der Prognostiker der Oeconomia putina) bewusst wurde, dass das zahlungsunfähige Volk kurz davor stand, auf die Straße zu gehen. Der russische Präsident forderte, die kommunalen Preise müssten drastisch gesenkt werden. Allerdings ist äußerst zweifelhaft, ob irgendjemand diese Forderung umsetzen will und kann.
Der bekannte russische Wirtschaftswissenschaftler Nikita Kritschewski schreibt dazu:
Der Rückzug des Staates aus den Bereichen Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen ist einer der größten Misserfolge der liberal-ökonomischen Politik des neuen Russland. Nicht die Entstaatlichung des Eigentums, sondern die Privatisierung der vormals eindeutig staatlichen Funktionen ist die eigentliche Erklärung für den beklagenswerten Zustand des sozialen Klimas im Land.
Wie der glänzende US-amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs richtig anmerkte, ist die Übergabe der Verpflichtungen für die Gewährung gesellschaftlich wichtiger Dienstleistungen an das Business »gleichbedeutend mit einer Umwandlung des staatlichen Monopols in ein privates Monopol, bei dem es keine Konkurrenz für die Dienstleistungen gibt«. Meine Herren Bürokraten, wenn das Volk demnächst massenhaft auf die Straße geht, wie es vor kurzem in Bulgarien der Fall war, dann werdet ihr nicht sagen können, man habe euch nicht gewarnt.
Präsident und Regierung sind ein Spielzeug in den Händen von Lobbyisten der Korporationen und korrupten Geschäftemachern auf allen Ebenen, die sich nur darum kümmern, dass ihre eigenen Taschen voll und die Oligarchen zufriedengestellt sind, von denen sie angemietet werden wie Prostituierte. Die beste Art, an Geld zu kommen – die Abgabenbesteuerung der gesamten Gesellschaft –, hat sich im Bereich der Wohnungsbau- und Kommunalwirtschaft voll entfaltet. Das Kalkül ist fehlerlos: Man kann zwar mit Ach und Krach auf viele Lebensmittel, Massenbedarfsgüter und Haushaltstechnik verzichten, nicht jedoch auf Wasser, Wärme und Strom. Die Zügel im kommunalen Bereich wurden denen überlassen, die dafür den höchsten Preis geboten haben.
Der jetzige Kollaps des Kommunalsystems geht einher mit einem demütigenden Verlust der führenden Position des Staates in den Wechselbeziehungen mit den Geschäftemachern. Nicht umsonst wechseln in der Wortverbindung Public Private Partnership die beiden Seiten der Zusammenarbeit immer öfter ihre Position, und an der Spitze des Prozesses steht der profitsüchtige Geschäftsmann.
So ist es also um die Oeconomia putina bestellt.
Die 70 bis 80 Milliarden Dollar, die nach Angaben der Russischen Zentralbank jedes Jahr aus dem Land fließen, sind keine mystischen »ausländischen Investitionen«. Es sind die Mittel der Großunternehmer und der einflussreichen Beamten Russlands, die nicht glauben, dass ihre Heimat eine Zukunft und Perspektiven hat.
Und Putin? Er ist für all das verantwortlich. Je schneller er verschwindet, desto weniger Verantwortung wird er tragen müssen. Aber die Trümmer des Zusammenbruchs der Oeconomia putina werden auch Europa treffen, das ist offensichtlich.
Читать дальше