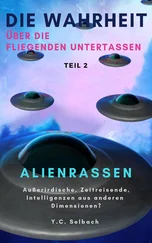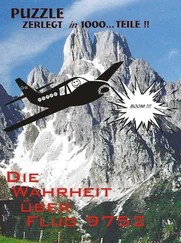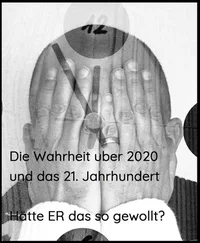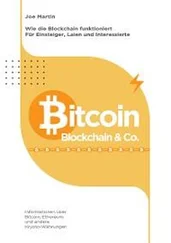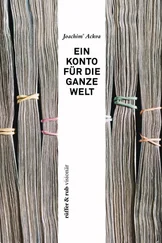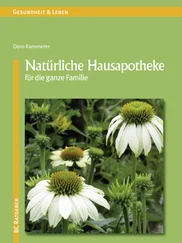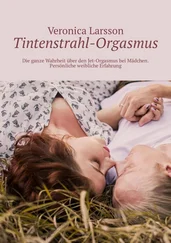Damit ist folgendes Szenario am wahrscheinlichsten: Wegen der fehlenden Kapazitäten wird man in der Stadt während der Olympiade im Dunklen bei Kerzenlicht sitzen, während die Wärmekraftwerke von Sotschi und Adler die Olympiade ausleuchten. Aber Sotschi ist noch nicht einmal die größte Finanzkatastrophe in Putins Russland. 2007 vereinbarten der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew und der Verteidigungsminister Anatoli Serdjukow ein Programm für die Neubewaffnung der russischen Armee – zu Kosten von 23 Trilliarden Rubel, also fast 600 Milliarden Euro. Worin das Programm bestehen soll, wurde bisher nicht verlautbart. Aber eines ist klar: Das hehre Ziel, den militärisch-industriellen Komplex des untergegangenen Imperiums zu erneuern, kann nicht erreicht werden, weil die russische Rüstungsindustrie hoffnungslos veraltet ist und keine moderne Technik herstellen kann. Beispiel dafür sind die zahlreichen glücklosen Starts von brandneuen Weltraumsputniks, welche die sowjetische Technologie in einer unverhohlen parodistischen Variante beerbt haben, sowie der skandalösen Rakete Bulawa, über die man nur gleichzeitig lachen und weinen kann.
Alternativlos werden die 600 Milliarden Euro also für den Import von Waffen ausgegeben, die man in den USA und den EU-Ländern kaufen wird, vor allem in Deutschland und Frankreich.
2010 hat Russland bereits für einen solchen Präzedenzfall gesorgt. Es kaufte von Frankreich vier Mistral -Korvetten. Nach einer der Versionen, die Licht ins Dunkel bringen sollen, wollte Dmitri Medwedew Nicolas Sarkozy damit helfen, die Wahlen in Frankreich 2011 zu gewinnen – der französische Präsident sollte die Werft in Nanterre, wo Mistral hergestellt wird, mit Arbeit überhäufen. 2012 stellte sich dann heraus, dass es in Russland für die Mistral -Korvette schlicht an Brennstoff fehlt. Dieser kann nur in Frankreich gekauft werden, wo mittlerweile Sarkozys ehemaliger Konkurrent, der Sozialist François Hollande, Präsident ist.
Vor diesem Hintergrund wirkt der Versuch des Beauftragten für die Rechte Minderjähriger in Russland, Pawel Astachow, einem ehemaligen Anwalt vieler Popstars, an die 20 Milliarden Dollar für die Umsetzung eines Verbots der Adoption russischer Waisen durch Ausländer zu erhalten, nicht mehr ganz so seltsam.
Bei alldem ist die Oeconomia putina nicht einmal Herr ihrer selbst. Sie wird durch zwei äußere Parameter bestimmt, auf die Russland keinen Einfluss nehmen kann:
•durch den Ölpreis und
•durch die Höhe ausländischen Spekulationskapitals innerhalb des russischen Finanzsystems.
Während der Krise 2008, als der Ölpreis von 120 auf 60 Dollar pro Barrel sank, bildete sich im russischen Staatshaushalt recht bald ein Loch von 100 Milliarden Dollar. Die panische Flucht der spekulierenden Investoren führte zu einem Sturz der russischen Fondsindexe um ungefähr das Dreifache.
Russische Experten aus dem Regierungsumfeld – zum Beispiel das sogenannte Zentrum für strategische Entwicklungen, das 1999 zur intellektuellen Betreuung der herrschenden Elite aus Putins Generation gegründet worden war – mahnen in einem fort, dass der Einbruch des Ölpreises auf dem Weltmarkt unter 80 Dollar pro Barrel zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft des Landes führen wird. Also nicht nur zu einer weiteren Krise, sondern zu einem richtigen Zusammenbruch, weil die Reserven aus den Finanzfonds, die während der Regierungszeit von Wladimir Putin geschaffen wurden, in einem solchen Fall nicht ausreichen, um die Löcher im Staatshaushalt zu stopfen. Ganz zu schweigen von der Modernisierung der nationalen Infrastruktur (Straßen, Rohrleitungen und so weiter), deren Zustand mit jedem Tag beklagenswerter wird.
Dieser Ansicht schloss sich in letzter Zeit der berüchtigte Alexei Kudrin an, der ungeachtet seines Rücktritts aus der Regierung Ende 2011 allem Anschein nach Putins Freund und Vertrauter geblieben ist. Das von Kudrin geleitete »Komitee für zivile Initiativen« ist heute eine der wichtigsten Institutionen für das Alarmschlagen in putinnahen Kreisen. Von dort ist ein beständiges griesgrämiges Nörgeln zu vernehmen: Bald gibt es kein Öl mehr, und Russland und seine Wirtschaft sind darauf nicht vorbereitet. Es ist Zeit, Vernunft anzunehmen und unter anderem die wahnsinnigen und sinnlosen Ausgaben des Staatshaushalts zu kürzen, einschließlich des 600-Milliarden-Programms von Medewedew und Serdjukow. In der Tat: Warum sollte man die Armee neu bewaffnen, wenn sie immer weiter schrumpft wie Chagrinleder und dabei immer weniger militärische als vielmehr polizeiliche Funktionen übernimmt? Auf einen großen Krieg wird sich die russische Armee nicht mehr vorbereiten, dafür könnte die Niederschlagung von Unruhen der von Putins Regime enttäuschten russischen Bürger durch die Streitkräfte der Armee durchaus aktuell werden.
Experten zählen viele potenzielle Gründe für das Sinken des Ölpreises auf. Der wichtigste ist eine wahrscheinliche wirtschaftliche Instabilität der Europäischen Union und der Euro-Zone. Sowohl das Zentrum für strategische Entwicklungen als auch die Gruppe um Kudrin sind sich darin einig, dass zum Beispiel der Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone und die Wiedereinführung der ursprünglichen Währung, der Drachme, das finanzwirtschaftliche System von Russland erschlagen könnten. Denn Europa ist der Hauptabnehmer russischer Energieressourcen, also der Ware, die das Land hauptsächlich exportiert. Deswegen wird jede wirtschaftliche Malaise Europas auch Auswirkungen auf Russland haben.
Dazu kommt die sinkende europäische Nachfrage nach Erdgas, an dem das gigantische und, wie Spezialisten meinen, völlig ineffektiv geleitete Unternehmen Gazprom das Liefermonopol ins Ausland hält. Die Gewinne dieser Korporation, die als »nationales Eigentum« und Stolz der gesamten Oeconomia putina gilt, sind 2012 um 15 Prozent gesunken. Ihr Anteil am europäischen Markt ging von 27 auf 25,6 Prozent zurück. Dieser Trend ergab sich gleich nach der Krise von 2008 und ist scheinbar unumkehrbar.
Die langfristigen Verträge mit dem russischen Monster sind für die europäischen Verbraucher immer unbefriedigender: Mittlerweile ist es bereits vorteilhafter, das »schwarze Gold« auf dem sogenannten Spotmarkt zu kaufen (also mit kurzen Erfüllungsfristen). Immer größere Konkurrenten für Gazprom sind mittlerweile Katar und Algir, die Europa mit Flüssiggas versorgen. Innerhalb der letzten vier Jahre ist der Anteil Norwegens am europäischen Gasmarkt um 15 Prozent gestiegen – nicht zuletzt wegen der skandalösen »Gaskriege«, die zwischen 2005 und 2010 von Gazprom mit recht unkonventionellen Methoden gegen die Transitländer Ukraine und Belarus geführt wurden. Auch die Entdeckung von großen Mengen an Schiefergas in den USA, dessen Selbstkostenpreis um ein Vielfaches unter dem der Lieferungen von Gazprom liegt – an die 110 Dollar für 1.000 Kubikmeter –, lässt an den Perspektiven Russlands als strategischer Energielieferant für den Westen starke Zweifel aufkommen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich vom Importeur in einen selbstständigen Produzenten und Exporteur von Gas verwandelt, der in diesem Sinne das Interesse an dem fernen, erschlafften und in seinem politisch-wirtschaftlichen Verhalten nicht immer ganz angemessen agierenden Putin-Russland verloren hat. Und man muss schon der Oberste Geschäftsführer von Gazprom Alexei Miller sein, der 1991 bis 1996 Schlüsselwart von Wladimir Putins Privatsafe im Smolny war (dem Bürgermeisteramt von Sankt Petersburg), um das nicht zu verstehen.
Schlusseffekt der aktuellen Gazprom-Krise wurde die Einstellung der Erschließung des Stockmannfeldes in der Barentssee, der größten Lagerstätte in Europa, im Mai 2012. Zunächst hatte man den Beginn der Arbeiten auf 2018 verschieben wollen, und dann wurde alles gänzlich liquidiert. Der Grund für diesen verzweifelten Schritt liegt auf der Hand: Das Gas aus dem Stockmannfeld hatte man eigentlich in die USA liefern wollen, aber jetzt braucht man es dort nicht einmal mehr als Geschenk.
Читать дальше