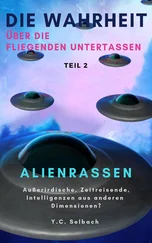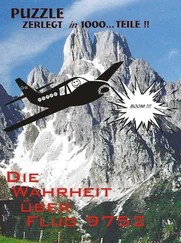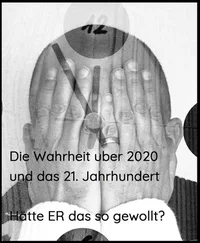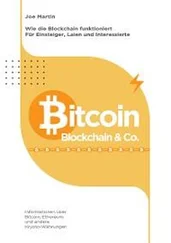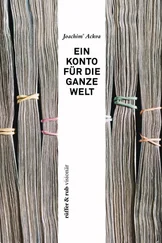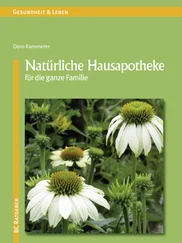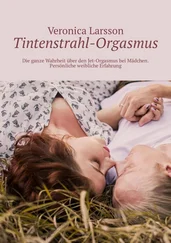Gleichzeitig weist Alexei Nawalny ganz eindeutige Anzeichen von Soziopathie auf. Für ihn sind nicht persönliche Beziehungen, sondern nur pragmatische Interessen wichtig. Nur zwei Subjekte haben für den heutigen Oppositionellen Nummer eins wirklich eine Bedeutung – er selbst und die Macht. Die begehrte Macht, für deren Besitz er wirklich bereit ist, viel zu geben, wenn nicht alles.
Nicht zufällig wurde der Top-Oppositionelle dafür kritisiert, dass er kein detailliertes Wahlprogramm oder eine Ideologie vorzuweisen hat. Er kann sie auch gar nicht haben. Denn alles Fixierte, alles Feste, alles unumkehrbar Formulierte bindet ihm Arme und Beine im Kampf um die Macht. Das wichtigste Postulat für Nawalny ist: Erst einmal stoßen wir das blutrünstige Regime Putins vom Thron und nehmen uns die Macht, und dann sehen wir weiter.
Viele Arrestanten des »Sumpf-Prozesses« konnten nur staunen: Warum lässt Nawalny ihnen und ihrem dramatischen Schicksal nicht die gebührende Aufmerksamkeit zukommen? Schließlich haben sie als Statisten des geheimen radikalen Aktionsszenarios vom 6. Mai 2012 viel Leid ertragen, das nicht zuletzt vom künftigen brutalen Mitbewerber um den Posten des hauptstädtischen Bürgermeisters erdacht worden war.
Ich würde auf diese Frage folgendermaßen antworten: Alexei Nawalny möchte als Pragmatiker und Soziopath nicht, dass die Aufmerksamkeit der oppositionellen Öffentlichkeit und des Russischen Bildungsbürgertums RuBiBü im Ganzen von ihm auf irgendjemand anderen schwenkt, einschließlich der Arrestanten des »Sumpf-Prozesses«. Je länger der Prozess in der »Sumpf-Strafsache« anhält und je härter die Strafen ausfallen, umso leichter wird Nawalny wieder einmal die totalitäre Sekte seiner Anhänger für die Fortsetzung des Kampfes um seine geliebte Frau – die Macht – mobilisieren können.
Die erste Perestroika von Michail Gorbatschow brachte uns einen alternativlosen Oppositionsführer – Boris Jelzin. Für ihn waren wir Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre bereit, durchs Feuer zu gehen. Danach mussten wir uns davon überzeugen, dass wir uns mit eigenen Händen ein autoritäres, korrumpierbares oligarchisches Regime an den Hals geschafft hatten, das den heute vielen verhassten Wladimir Putin hervorbrachte.
Die zweite Perestroika von Wladimir Putin bietet eine neue Verführung – Alexei Nawalny.
Russland jedoch braucht keinen neuen Führer. Russland braucht eine parlamentarische Demokratie nach europäischem Muster, in der legale und legitime und bei regelmäßigen Wahlen austauschbare politische Institutionen regieren, keine bis zur Alternativlosigkeit exklusiven charismatischen Führer und von ihnen geschaffene Sekten.
Der Mechanismus einer ständigen Wiederaufbereitung des typisch russischen Autoritarismus muss gestoppt werden. Nawalny könnte ein guter Leiter eines staatlichen Konzerns wie Gazprom werden (der Diebstahl würde sich unter ihm deutlich verringern) und ein hervorragender Chef einer starken parlamentarischen Fraktion, vielleicht sogar das Oberhaupt einer Koalitionsregierung in einer parlamentarischen Republik. Aber kein Präsident des Typus Jelzin/Putin, Gott bewahre.
Darüber sollte man sich schon jetzt Gedanken machen, nicht nur in Russland, sondern auch innerhalb der Kreise im Westen, die sich für Russland interessieren.
3 Bewerber zu den Bürgermeisterwahlen in Moskau müssen sich die Unterstützung von 6 Prozent der Stadtabgeordneten sichern, um eine Kandidatur zu erlangen. Anm. d. Ü.
Kapitel 22: Der Zusammenbruch der Oeconomia putina – wie und wann?
In absehbarer Zeit kommen auf Russland ernsthafte wirtschaftliche Probleme zu. Davor haben Experten, zu denen auch der Autor dieser Zeilen gehört, seit 2004/2005 gewarnt. Doch die herrschende russische Elite hat diese Warnungen nicht ernst genommen: Sie meinte, man könne mit dem steigenden Ölpreis alles überdecken, abdecken und abschreiben – für zwanzig bis dreißig Jahre im Voraus.
Eine gewisse Ernüchterung setzte erst im Herbst 2008 ein, als die weltweite Wirtschaftskrise einsetzte und Russland besonders hart traf. Mittlerweile kostet das Öl wieder verhältnismäßig viel, aber den russischen Eliten ist nun klar, dass das Ende nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wladimir Putin muss weise genug sein, nicht länger als bis 2018 auf seinem Posten zu bleiben. Dann bleibt ihm die Möglichkeit, den Zusammenbruch der Wirtschaft auf kommende Machthaber abzuwälzen. Die Frage ist nur: Weiß er das? Im Hinblick auf seine Aktionen und Entscheidungen können daran Zweifel entstehen.
Bevor wir näher auf den möglichen Zusammenbruch eingehen, sollten wir genauer klären, was sich hinter der »Oeconomia putina« verbirgt. Der Begriff ist selbstverständlich relativ. Die Ausbildung dieses postsowjetischen Wirtschaftmodells begann bereits Anfang der 1990er-Jahre unter Boris Jelzin. Seine endgültigen Züge hat es jedoch erst unter dem zweiten russischen Präsidenten angenommen.
Die Oeconomia putina hat zwei wesentliche Eigenschaften. Erstens handelt es sich dabei um eine Chaljawa-Wirtschaft. Das Wort chaljawa habe ich bereits im Kapitel 1 erläutert. Jeder Russe versteht es ohne weitere Erklärungen – wahrscheinlich weil es ihm bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist. Zweifellos hat es seinen Ursprung im russischen Volksmärchen, wo für wirtschaftliche Fragen ein Wundertischtuch verantwortlich war, das seine Besitzer kostenlos mit Essen versorgte. Dort gab es auch einen Ofen, von dem die Märchenfigur Jemelja nicht einmal herunterzurutschen brauchte, wenn er folgenreiche Entscheidungen treffen musste. Mit einem schnöden juristischen Wörterbuch könnte man chaljawa als »unberechtigte Bereicherung« bezeichnen. In der Oeconomia putina ist man gewohnt, ein Ergebnis ohne reale geistige oder physische Anstrengungen zu erreichen. Die Schritte, die eine solche Investition erforderlich machen, werden einfach nicht unternommen.
Zweitens handelt es sich um eine Korruptionswirtschaft. Die wichtigsten wirtschaftlichen (und sie befördernden politischen) Entscheidungen werden ausschließlich dann getroffen, wenn es viel zu stehlen gibt. Gibt es nichts zu stehlen, wird keine Entscheidung getroffen, oder sie wird auf die lange Bank geschoben. Hier begegnet uns wieder der Begriff ROS – RASPIL (Um- und Neuverteilung), OTKAT (Cashback) und SANOS (Bakschisch).
Die Oeconomia putina erschafft nichts, sondern verteilt. Die unerschöpfliche Quelle der zu verteilenden Güter ist der russische Staat. Der Gegenstand der Bemühungen der Oeconomia putina ist die Verwertung des Erbes der UdSSR, denn nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist auf russischem Territorium in Wirtschaft, Infrastruktur, Wissenschaft oder Technik nichts Wesentliches geschaffen worden.
Gelenkt wird die Oeconomia putina durchaus nicht vom Staat, wie viele Westeuropäer fälschlicherweise meinen, die zu oft eigene und russische Zeitungen gelesen haben. Der Staat ist in diesem Zusammenhang Ressourcenquelle und ein Mechanismus der Beschaffung von Einkünften aus Korruption, aber keineswegs ein vollwertiges Subjekt, das dazu berufen und in der Lage ist, Entscheidungen im eigenen (das heißt, im nationalen) Interesse zu treffen. In der Oeconomia putina geben zwei Kategorien von Menschen den Ton an:
•die Geldzerstückeler, die für die Verteilung der Mittel, ihre Instrumentalisierung und Proportionierung zuständig sind, und
•die Wachmänner, die das Zerstückelte hüten (oder die vom Zerstückelten verbleibende Illusion eines materiellen Nutzens).
Beide Tätigkeiten sind recht simpel. Sie basieren auf der Annahme, dass der Mensch jeglichen Wohlstand durch chaljawa bekommt und dass für die Erlangung von Wohlstand weder eine ernst zu nehmende Bildung noch eine kontinuierliche Tätigkeit vonnöten sind. Man muss nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein, zum Beispiel durch Vermittlung eines Cousins dritten Grades den Stellvertreterposten des Direktors von Gazprom einnehmen und für den Kauf von Pflanzenfetten verantwortlich sein.
Читать дальше