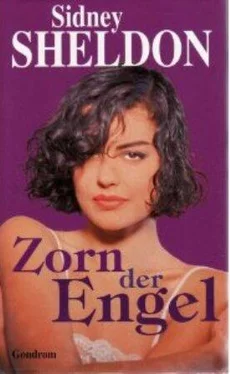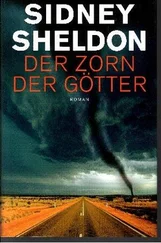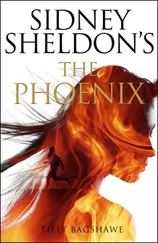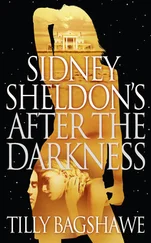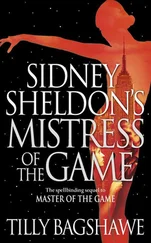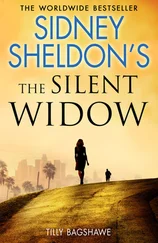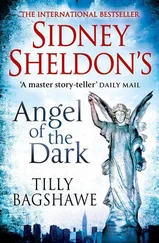»Haben Sie jemals Ameisen mit Schokoladenguß gegessen?« fragte er. »Nein.«
Er grinste. »Sie schmecken besser als Grashüpfer mit Schokoladenguß.«
Er erzählte von einem Jagdausflug in Alaska, auf dem er von einem Bären angegriffen worden war. Er sprach über alles, nur nicht über das, weswegen sie hier waren. Jennifer hatte sich für den Augenblick gewappnet, wenn Adam anfangen würde, sie auszufragen, aber als es schließlich soweit war, versteifte sich ihr ganzer Körper. Er war mit dem Dessert fertig und sagte ruhig: »Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen, und ich möchte nicht, daß Sie sich aufregen. Okay?«
In Jennifers Kehle saß plötzlich ein Kloß. Sie war nicht sicher, ob sie imstande war, zu sprechen. Sie nickte. »Ich möchte, daß Sie mir genau erzählen, was an jenem Tag im Gerichtssaal passierte. Alles, woran Sie sich erinnern, alles, was Sie gefühlt haben. Lassen Sie sich Zeit.« Jennifer hatte vorgehabt, ihn herauszufordern, ihm zu sagen, er könne mit ih r tun, wozu immer er Lust habe. Aber irgendwie war ihr ganzer Widerstand wie weggeblasen. Der Vorfall war noch immer so lebendig für sie, daß es weh tat, auch nur daran zu denken. Sie hatte mehr als einen Monat lang versucht, alles zu vergessen. Nun verlangte er von ihr, alles noch einmal zu durchleben.
Sie holte tief Luft und sagte: »In Ordnung.« Stockend fing sie an, ihm über die Ereignisse im Gerichtssaal Bericht zu erstatten, und als alles wieder zum Leben erwachte, sprach sie schneller und immer schne ller. Adam saß schweigend auf der anderen Seite des Tisches, hörte zu und ließ sie dabei nicht aus den Augen.
Als sie geendet hatte, fragte er: »Der Mann, der Ihnen den Umschlag gegeben hat - war er im Büro des Staatsanwalts, als Sie am Morgen vereidigt worden waren?«
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Es waren so viele Leute im Büro an diesem Morgen, und ich kannte keinen von ihnen.«
»Haben Sie den Mann schon mal irgendwo anders gesehen?« Jennifer schüttelte hilflos den Kopf. »Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht.«
»Sie haben gesagt, er hätte mit dem Staatsanwalt gesprochen, bevor er Ihnen den Umschlag gab. Haben Sie gesehen, wie der Staatsanwalt ihm den Umschlag aushändigte?«
»Ich - nein.«
»Haben Sie tatsächlich gesehen, wie dieser Mann mit dem Staatsanwalt sprach, oder stand er nur in der Gruppe um Di Silva?«
Jennifer schloß für eine Sekunde die Augen, versuchte, den Moment zurückzubringen. »Es tut mir leid. Alles ging so durcheinander. Ich... ich weiß es einfach nicht mehr.«
»Haben Sie eine Ahnung, woher er Ihren Namen kannte?«
»Nein.«
»Oder warum er gerade Sie ausgesucht hat?«
»Das ist nicht schwer zu erraten. Wahrscheinlich erkannte er einen Idioten, wenn er einen zu Gesicht bekam.« Sie schüttelte noch einmal den Kopf. »Nein. Es tut mir leid, Mr. Warner, aber ich habe keine Ahnung.«
Adam sagte: »In dieser Angelegenheit wird eine ganze Menge Druck ausgeübt. Staatsanwalt Di Silva war schon eine Ewigkeit hinter Michael Moretti her. Bis Sie auftauc hten, hatte er einen wasserdichten Fall. Er ist nicht besonders gut auf Sie zu sprechen.«
»Ich bin auf mich selber nicht gut zu sprechen.« Jennifer konnte Adam Warner nicht übelnehmen, was er vorhatte. Er tat nur seine Arbeit. Sie wollten ihr den Fangschuß versetzen, und sie würden es tun. Adam Warner war nicht dafür verantwortlich; er war nur das Werkzeug, dessen sie sich bedienten. Jennifer fühlte einen plötzlichen, überwältigenden Drang, allein zu sein. Sie wollte nicht, daß irgend jemand sie in ihrem Elend sah.
»Es tut mir leid«, entschuldigte sie sich. »Ich... ich fühle mich nicht sehr gut. Ich würde gern nach Hause gehen.« Adam betrachtete sie einen Moment lang. »Würde es Ihnen besser gehen, wenn ich Ihnen sagte, daß ich empfehlen werde, Sie nicht auszuschließen?«
Es dauerte einige Sekunden, bis sie begriff, was er gesagt hatte. Jennifer starrte Adam an, versuchte, den Ausdruck seines Gesichts zu ergründen, blickte in diese graublauen Augen hinter den Brillengläsern. »Meinen... meinen Sie das im Ernst?«
»Ihr Beruf ist Ihnen sehr wichtig, nicht wahr?« fragte Adam. Jennifer dachte an ihren Vater und seine gemütliche kleine Praxis, sie dachte an ihre Gespräche, die langen Jahre an der Universität, an ihre gemeinsamen Hoffnungen und Träume. Wir werden Partner, du und ich, Jennie. Beeil dich, damit du deinen Titel bekommst. »Ja«, flüsterte Jennifer.
»Wenn Sie den rauhen Wind am Start überstehen, dann werden Sie, glaube ich, eine sehr gute Anwältin sein.« Jennifer lächelte ihn dankbar an. »Danke. Ich werde es zumindest versuchen.«
Sie wiederholte die Worte in ihrem Kopf. Ich werde es zumindest versuchen. Es war unerheblich, daß sie ein kleines, schäbiges Büro mit einem heruntergekommenen Privatdetektiv und einem Mann, der unbezahlte Autos zurückholte, teilen muß te. Es war das Büro eines Anwalts. Sie war ein Mitglied des Anwaltsstandes, und man ließ sie weiter praktizieren. Jubel stieg in ihr auf. Sie blickte Adam an und wußte, daß sie diesem Mann ihr Leben lang dankbar sein würde. Der Kellner räumte das schmutzige Geschirr vom Tisch. Jennifer wollte etwas sagen, aber heraus drang nur ein Geräusch, das halb Lachen und halb Schluchzen war. »Mr. Warner...« Er sagte würdevoll: »Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, sollte das Adam heißen.«
»Adam...«
»Ja?«
»Hoffentlich bedeutet es nicht das Ende unserer Bekanntschaft«, stöhnte Jennifer, »aber ich komme um vor Hunger.«
Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug. Jennifer war vom frühen Morgen bis spät in die Nacht damit beschäftigt, Vorladungen aller Art zuzustellen. Sie wußte, daß sie keine Chance hatte, jemals in einer großen Kanzlei zu arbeiten, denn nach dem Fiasko, an dem sie beteiligt gewesen war, dachte niemand im Traum daran, sie zu beschäftigen. Sie konnte nur darauf hinarbeiten, sich selber einen Namen zu machen, und dabei mußte sie ganz von vorn beginnen. In der Zwischenzeit häuften sich Vorladungen von Peabody & Peabody auf ihrem Schreibtisch. Sie verrichtete zwar nicht gerade die Arbeit eines Anwalts, aber sie verdiente zwölf Dollar fünfzig plus Spesen.
Gelegentlich, wenn Jennifer bis in die Nacht zu arbeiten hatte, lud Ken Bailey sie zum Abendessen ein. Oberflächlich betrachtet, war er ein Zyniker, aber Jennifer hatte das Gefühl, daß es sich dabei nur um eine Fassade handelte. Sie spürte, daß er einsam war. Er hatte die Brown-Universität absolviert, war intelligent und belesen. Sie konnte nicht verstehen, warum er damit zufrieden war, in einem billigen Büro zu sitzen und sein Leben damit zu verbringen, streunende Ehemänner und Ehefrauen aufzuspüren. Es war, als hätte er sich damit abgefunden, ein Versager zu sein, als hätte er Angst davor, um den Erfolg zu kämpfen.
Einmal hatte Jennifer versucht, mit ihm über seine Ehe zu sprechen, aber er hatte nur geknurrt, »Das geht Sie nichts an«, und sie hatte das Thema nie wieder erwähnt. Otto Wenzel war völlig anders. Der kleine, schmerbäuchige Mann war glücklich verheiratet. Er behandelte Jennifer wie eine Tochter und brachte ihr dauernd Suppen und Kuchen, die seine Frau zubereitet hatte. Leider war seine Frau eine miserable Köchin, aber Jennifer zwang sich, alles zu essen, was Otto Wenzel ihr gab, weil sie ihn nicht verletzen wollte. Eines Freitagabends wurde sie zu den Wenzels zum Abendessen eingeladen. Mrs. Wenzel hatte gefüllten Kohlkopf gekocht, ihre Spezialität. Der Kohl war matschig, die Fleischfüllung zu hart und der Reis nur halbgar. Die ganze Mahlzeit schwamm in einem See aus Fett. Jennifer nahm wacker den Kampf mit dem Kohl auf, konnte sich aber nur zu kleinen Bissen überwinden und schob die Speisen auf ihrem Teller hin und her, damit es so aussah, als lange sie kräftig zu. »Wie schmeckt es Ihnen?« strahlte Mrs. Wenzel. »Es ist... es ist eins meiner Lieblingsgerichte.« Von da an wurde Jennifer jeden Freitag zu den Wenzels zum Abendessen eingeladen, und Mrs. Wenzel kochte ihr stets ihre Lieblingsmahlzeit.
Читать дальше