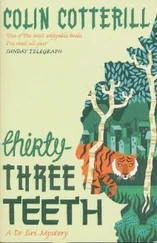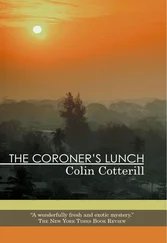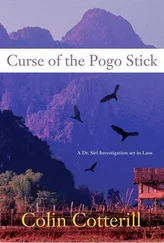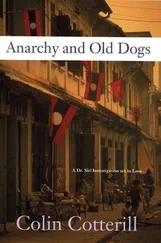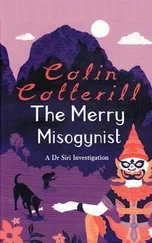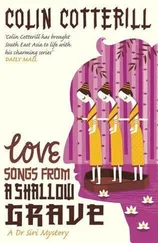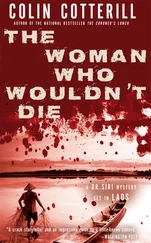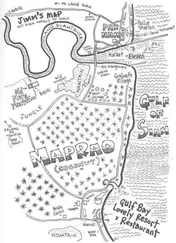»Na schön, vielleicht nicht dumm, aber doch … unbedarft.«
»Sie haben heute viel Gutes getan.«
»Dafür hatte ich in vielen anderen Fällen keinen Schimmer, was ich tun sollte. Es ist frustrierend. Jetzt erst wird mir klar, was Leute wie mein Chef und Dr. Santiago leisten. Tagaus, tagein, Jahr um Jahr retten sie Menschenleben, als wäre es das Natürlichste von der Welt.«
»Eines Tages bin ich hoffentlich auch Chirurg«, sagte Singsai und richtete den Blick gen Himmel, als könne der ihm diesen Wunsch erfüllen. Er war Mitte fünfzig und hatte keinerlei Beziehungen, darum standen seine Chancen nicht besonders gut.
Dtui wechselte eilig das Thema. »Behandeln Sie hier eigentlich nur Notfälle?«
»Nein, wir haben auch ein oder zwei Malariapatienten«, sagte er. »Und einen kleinen Jungen mit chronischem Durchfall. Die bei Weitem gefährlichste Kinderkrankheit in ganz Südostasien. Die meisten sterben daran, aber der Kleine hält sich wacker. Er hat großes Glück gehabt. Ach, und dann ist da noch Frau Duaning.«
»Und was fehlt ihr?«
»Das wüssten wir auch gern. Sie liegt seit zwei Wochen im Koma. Wir haben sie auf der Straße gefunden.«
»Und sie wird von niemandem vermisst?«
»Nein.«
»Woher wissen Sie dann, wie sie heißt?«
»Wissen wir ja gar nicht, aber sie ist ohne Zweifel eine Hmong. Also hat einer unserer Hmong-Pfleger sie ›Duaning‹ getauft. Was so viel wie ›wunderlich‹ bedeutet.«
Sie statteten Frau Wunderlich einen Besuch ab. Sie lag in einem kleineren, separaten Raum, wo die nicht lebensbedrohlichen Fälle untergebracht waren. Sie lag auf dem Rücken, starrte mit weit aufgerissenen Augen an die Decke und murmelte irgendetwas vor sich hin.
»Was redet sie denn da?«, fragte Dtui.
»Sie spricht erst seit vorgestern. Sie sagt immer wieder dasselbe.«
Dtui beugte sich über sie und horchte. Die Stimme der alten Frau klang nicht halb so rau, wie man es bei einem siechen alten Weib hätte vermuten können. Ihr Atem roch modrig. »Panoy muss essen«, sagte sie. »Panoy muss essen.«
»Könnte es nicht sein, dass sie Panoy heißt?«
»Die Alte? Nein. Das wäre ein sehr untypischer Name für eine Hmong.« Als er ihr die dünne Decke unters Kinn zog, kamen ihre Füße darunter zum Vorschein. »Heiliger …«
Die Fußsohlen der Frau waren mit einer verkrusteten kastanienbraunen Masse überzogen. »Ist sie draußen herumgelaufen?«
»Nein. Soviel ich weiß, hat sie sich nicht vom Fleck gerührt. Und das sieht mir auch nicht nach Erde aus.«
Dtui kratzte mit dem Fingernagel an einer Sohle. Sie wusste sofort, womit sie es zu tun hatte. »Das ist geronnenes Blut.«
»Und woher …? Hat sie irgendwelche Verletzungen?«
Dtui nahm ein feuchtes Tuch aus der Waschschüssel neben dem Bett und rieb vorsichtig an einem Fuß. »Nein.«
»Aber wie …?«
»Das sieht ganz nach einem Muster aus, Singsai. Schauen Sie sich den anderen Fuß an. Als hätte ihr jemand Symbole auf die Sohlen gemalt.«
»Mit Blut? Und wozu?«
»Vielleicht kann Ihr Hmong-Pfleger uns weiterhelfen.«
»Wir werden sehen. Ich möchte ihn jetzt nicht wecken, aber morgen früh werde ich ihm mal ein wenig auf den Zahn fühlen. Ich bin gespannt, ob er eine Erklärung dafür hat.«
»Ich auch«, sagte Dtui. »Ich auch.«
Wegen zwei weiterer Notfälle kam Dtui erst gegen sieben Uhr morgens ins Bett. Die leichte Brise, die durch die dünnen Baumwollvorhänge ins Zimmer wehte, weckte sie um zehn. Auf ihrem Weg in den Hauptkrankensaal schaute sie rasch bei Frau Wunderlich vorbei. Die lag zwar noch immer auf dem Rücken, sang jetzt jedoch ein anderes Lied.
»Panoy ist schwach. Panoy ist schwach«, sagte sie.
»Wer ist Panoy?«, fragte Dtui.
»Panoy ist schwach.«
Dtui strich der Frau das weiße Haar aus dem Gesicht und legte die Hand auf ihre kalte Stirn. Ihre Haut wirkte stumpf, wie mit einer feinen Staubschicht überzogen. Ihr Puls war schwach. Dtui fragte sich, ob die Alte den heutigen Tag wohl überleben würde. Bevor sie aus dem Zimmer ging, hob sie die Decke, um sich die Füße der Frau noch einmal anzusehen. Die linke Sohle, die sie in den frühen Morgenstunden gesäubert hatte, war von Neuem mit getrocknetem Blut bedeckt.
Dr. Siri saß im Speisesaal des Gästehauses und blätterte in einer vier Wochen alten Ausgabe der Pasason Lao . Dabei stieß er auf ein Foto, auf dem sein alter Freund Civilai einem mongolischen Diplomaten die Hand schüttelte. Beide lächelten breit, aber wenig überzeugend. Er wusste genau, was der Genosse Civilai, sein einziger Verbündeter im Politbüro, gerade dachte. Es erinnerte ihn an alte Zeiten und zwei junge Männer voller Ideale.
Siri und seine Frau Boua hatten seit Jahren der Lao Issara, dem Freien Laotischen Widerstand, angehört. Boua wollte die französischen Besatzer systematisch bekämpfen, statt ihnen nur hin und wieder ein paar Nadelstiche zu versetzen. Sie war eine überzeugte Kommunistin, und Siri folgte ihr an die Ngyuen-Ai-Quoc-Universität in Hanoi, wo er Vietnamesisch lernte und Kurse in kommunistischer Ideologie belegte. Er wurde mit roter Farbe getauft und so lange in den Bottich getunkt, bis er Marx atmete und Lenin schiss. Derart gerüstet, war er durch die vietnamesische Provinz getingelt und hatte die Bauern davon überzeugt, dass nur der Kommunismus sie vom Joch der französischen Fremdherrschaft befreien könne. Er arbeitete in Lazaretten im Norden des Landes und fand selbst nach einer blutigen Achtzehn-Stunden-Schicht noch Zeit, die Dorfbewohner in ideologische Grundsatzdiskussionen zu verwickeln.
Diesen Abschnitt seines Lebens nannte er inzwischen nur noch »die Jahre, in denen ich meinen Verstand verborgte«. Erst als er einen anderen begeisterten Kader kennenlernte, einen treuen Genossen der Laotischen Volkspartei und alten Kommunisten namens Civilai, war Siri in der Lage, die Dinge mit anderen Augen zu betrachten. Zwar hatte man ihm eingebläut, jeden Genossen, der vom Pfad der Tugend abgewichen war, unverzüglich der Parteiführung zu melden, doch Civilai schien so erfahren und intelligent, dass Siri gar nicht anders konnte, als sich seine Worte zu Herzen zu nehmen und sein eigenes wirres Weltbild zu überdenken. Civilai war ein glühender Anhänger des Kommunismus. An seiner Loyalität gegenüber der Partei bestand kein Zweifel. Aber er glaubte an eine Form des Kommunismus, die ohne Terror und Unterdrückung auskam. Wegen seiner Ansichten galt er als abgehobener Spinner. Doch da er einen hohen Rang bekleidete und bei den »Massen« zudem recht beliebt war, durfte er seinen Posten im Zentralkomitee behalten, auch wenn seine Bemühungen in aller Regel wirkungslos verpufften.
Siri hatte sich sofort für Civilais goldenen Mittelweg begeistern können, und so wurde auch er von den Parteibonzen geächtet. Während Boua sich unermüdlich der ideologischen Erziehung des Proletariats widmete, hängte Siri seine rote Fahne an den Nagel und konzentrierte sich auf seinen Beruf als Arzt. Bouas Liebe zu ihm schwand nach und nach dahin. Er hingegen liebte sie bis zu ihrem Tod heiß und innig, obwohl er wusste, dass sie ihn für einen Versager hielt. Allein seine Freundschaft zu Civilai bewahrte ihn davor, den Verstand zu verlieren, und während die Partei Civilai immer sinnlosere Pflichten aufbürdete, war es Siri, der seinem Freund Halt und Unterstützung bot.
Das Zeitungsfoto zeigte einen von unzähligen symbolischen Handschlägen mit einem von unzähligen ausländischen Würdenträgern. Ein weiterer Schnappschuss für das diplomatische Fotoalbum. Er werde allmählich zur Micky Maus des neuen Regimes, hatte Civilai geklagt. Er …
»Genosse?« Siri blickte auf und sah sich dem Wachposten gegenüber, der normalerweise vor der Sperrholzwand im ersten Stockwerk saß. Kreidebleich stand er in der Tür. »Sie sind doch Arzt, nicht wahr?«
Читать дальше